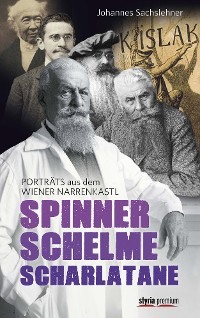Kitabı oku: «Spinner. Schelme. Scharlatane», sayfa 3
AERONAUTISCHES ZWISCHENSPIEL
Noch jahrelang bemüht sich Thun vergeblich um Anerkennung für seine Erfahrungen, die er in der Gablidone-Brüderschaft gemacht hat. Auch der ersehnte neue „Rechner“, der den Namen „Masson“ tragen soll, erscheint nicht und so entdeckt er schließlich ein neues Steckenpferd: die Aeronautik. Die Luftschifffahrt ist die technische Sensation jener Tage, für den wachen Geist des Grafen die richtige Herausforderung. Gemeinsam mit einem Baron Lütgendorf geht er nach Augsburg, im August und September 1786 wollen sie hier mit einer großen Montgolfière zu einer Luftreise aufsteigen. Glaubt man Wilhelm Ludwig Weckhrlin, der in seiner Zeitschrift Das graue Ungeheuer (8. Band) über die große „Mystification zu Augsburg“ berichtet, so hat der Graf mit seinem Gefährten nicht die beste Wahl getroffen – Lütgendorf, der aus Franken stammt, gilt als Abenteurer, der ihm, wie Brabbée vermutet, „den Beutel tüchtig fegen will“. Zur Illustration seines Urteils erzählt Weckhrlin noch eine Episode vom Wiener Aufenthalt Lütgendorfs: Wie Christus auf dem Meere wollte dieser offenbar über die Donau gehen, sei dabei aber fast ertrunken, die Wiener mussten ihn aus dem Wasser ziehen.

Berichtet in seiner Zeitschrift „Das graue Ungeheuer“ aus Augsburg: Wilhelm Ludwig Weckhrlin.
Der Aufstieg der Montgolfière ist ursprünglich für den 25. August 1786 geplant, wird aber von Regen verhindert, dann zeigen sich plötzlich mysteriöse Löcher in der Ballonhaut – Gerüchte werden laut, dass Lütgendorf die Schäden aus Angst vor der Luftreise selbst bewerkstelligt habe. Der Aufstieg muss zum Leidwesen des ungeduldigen Publikums jedenfalls neuerlich verschoben weden. Weckhrlin schildert seinen Lesern die Lage in Augsburg:
„4. September. Morgen soll ein neuer Versuch gemacht werden. Graf Thun, der berühmte Wissenschafts-Enthusiast, der den Künstler in Schutz genommen, besteht darauf. Dieser Herr ist einer der fleissigsten Grossen unserer Nation, leidenschaftlicher Priester im Tempel der Musen, und für sein Lieblingsfach, Physik und Mathematik, Professor. Er ist’s, der die Physiognomik, eine Theorie, die uns einst Ehre machen wird, wenn sie, so wie alle andern, dem Spott genugsam gezollt hat, in Schutz nahm, und sich dadurch ein Denkmal in den Fragmenten Lavater’s erwarb. Nächstdem ein edler und liebenswürdiger Charakter voll Licht und Güte. Und dieser Charakter ist kein Gemeingut der heutigen Epoche in Oesterreich. Graf Thun philosophirte und studirte schon in Theresianischen, d. i. in Zeiten, wo der (sic!) Genie nicht in der Mode war. Ein Verdienst mehr!“ – Mit dem Aufstieg scheint es aber auch am 5. September nicht geklappt zu haben, denn Weckhrlin nennt Lütgendorf später einen „Betrüger der niedrigsten Klasse“, der mit Fleiß dem Burgunder zuspricht, während die Augsburger noch immer auf das Ballonspektakel warten – das geplante aeronautische Abenteuer wird zum Fiasko.
Lütgendorfs und Thuns Wege trennen sich in der Folge, der Sommer des Jahres 1787 sieht den Grafen in Karlsbad, wo er die hier versammelte haute volée mit neuen Ideen unterhält. In einem „Schreiben aus Karlsbad“ vom 6. Juli 1787 berichten die österreichischen Provinzial-Nachrichten: „Vorige Woche wurde auf einem Balle von dem in Erfindung und schönen Geschmack berühmten Herrn Grafen von Thun ein ganzes Schachspiel von Masken vorgestellt und so, wie man sagt, auch wirklich von zwei Kavalieren gespielt; sie waren beide im Nebenzimmer und riefen bloß die Nummern der Statisten aus, die, so oft eine gehoben wurde, von zween Masken abgeführt ward.“ Gleich darauf gibt Thun wieder den Mann der Wissenschaft, und zwar den „Professor der Physik“. Angeblich hat er eine Maschine entwickelt, die jene „Luft“ auffängt, die aus dem Karlsbader Sprudelwasser entweicht. Das Experiment findet in Gegenwart mehrerer Ärzte statt, Ziel ist es herauszufinden, wie viel das Karlsbader Mineralwasser „verlieren muss, wenn es in die entfernten Häuser getragen wird“. (Zitiert nachProvinzial-Nachrichten, 8. August 1787)
DER WUNDERHEILER
Bereits während der Abenteuer mit den Homunculi des Grafen Kueffstein hatte sich Thun unter dem Eindruck der Lehre Franz Anton Mesmers vom „Animalischen Magnetismus“ mit der Heilkraft von Magneten beschäftigt und selbst auch Heilmagneten eingesetzt. Durch Zufall gewinnt er im Herbst 1787 jedoch eine völlig neue Erkenntnis: Er benötigt gar keinen Heilmagneten, denn die heilende Kraft wohnt in seinen Händen und mit dieser Kraft kann er wahre Wunder bewirken.
Über diesen „Zufall“ wird er 1794 in der Juliausgabe der Berlinischen Monatsschrift Folgendes erzählen: „Ein Buch, welches ich meinem Buchbinder zum Einbinden schickte, ward mir von demselben so lange vorenthalten, dass ich endlich verdrossen ward, und selbst zu ihm ging, um ihn zur Rede zu stellen. Während er nun wegen einer Lähmung seines Armes sich entschuldigen wollte, legte ich von ungefähr meine rechte Hand auf den kranken Theil. Augenblicklich hatte der Mann eine veränderliche Empfindung, und indem er fortfuhr zu sprechen, fühlte er sich endlich von seinen Beschwerden so erleichtert, dass er verwunderungsvoll ausrief: ‚Herr Graf, was haben Sie in Ihrer Hand?‘ – Ich stutzte. Aber der gute Mann betheuerte mir höchlich, dass seine Empfindung nichts weniger als Täuschung sei. Er, seine Frau und ich erstaunten, dass er sich seines Armes, den er wegen eines krampfhaften Schmerzes schon seit einigen Monaten nicht gebraucht hatte, itzt ohne Beschwerden bedienen konnte. Sie können leicht denken, dass ich seit der Zeit auf die Wirkungen meiner Hand aufmerksam ward. Ich versuchte es mit ihr seitdem an verschiedenen anderen Kranken der Art; ich sah dieselbe Wirkung erfolgen. Kaum war in Wien von einigen Zirkeln davon gesprochen, so hatte ich einen solchen Zulauf, dass ich oft meine Patienten durch Militär in Ordnung halten musste, so sehr drängte sich alles zu mir, um meiner Hilfe theilhaftig zu werden. Ich konnte wohl in Wien allein an 30.000 Kranke (sic!) zählen, denen, wenn auch nicht immer mit dem besten Erfolge, ich meine Hilfe angedeihen liess.“
Auch wenn Thun mit der Zahl seiner Patienten hier übertreiben mag – der Zulauf zum „neuen Messias aller Gichtbrüchigen und Lendenlahmen“ ist groß, dem Grafen muss man zugute halten, dass er für seine „Behandlung“ kein Honorar verlangt, auch das wohl ein Grund für viele Kranke, es auch bei ihm zu versuchen. 1793 verlässt er Wien und geht zunächst nach Karlsbad, im Frühjahr 1794 taucht er zur Ostermesse in Leipzig auf und sorgt hier gleich für Aufsehen: Er lässt verkünden, „dass er, vermöge einer in seiner rechten Hand wirkenden Materie, die Kraft besitze, gewisse rheumatische Schmerzen, gichtische Lähmungen und podagrische Stockungen vermittelst blosser Berührung zu heben. Dass dies keine grundlose Behauptung sei, wolle er durch seinen Stand und seinen Reichthum, der ihn vor der Beschuldigung eines jeden daraus zu ziehenden Gewinnstes hinlänglich sichere, und durch die Menge auffallender Kuren, welche er in Wien und an verschiedenen anderen Orten verrichtet habe, erhärten.“ Sein „einziger Beweggrund“ für die Reise nach Leipzig „wäre, die hiesige Fakultät aufzufordern, die in seiner Hand sich äussernde Materie und die dadurch entstehenden Wirkungen sorgfältiger zu untersuchen, als dies bisher geschehen sei“. (Zitiert nach Brabbée, Der Thaumaturg.) Die letztere Bemerkung stößt jedoch vor Ort auf Kritik: Der Schriftsteller Saul Ascher, der von der Berlinischen Monatsschrift nach Leipzig geschickt wird, um über Thun zu berichten, weiß um die Vergangenheit des Grafen und kennt auch die Gablidone-Affäre. Ascher stellt Thun daher als Schwärmer dar, der einer Selbsttäuschung zum Opfer falle oder einfach schon wieder betrogen werde. Weiters stellt Ascher die nicht unberechtigte Frage, warum Thun nicht bereits die Professoren der Wiener Universität in seiner Sache um eine Expertise gebeten habe. Aschers Resümee: „Ein Mann, der eine so entzündbare Einbildungskraft besitzt (…) kann schwerlich, bei all seiner Ehrlichkeit, für unbefangen genug gehalten werden, um Glauben zu verdienen, wenn er itzt mit einem Wunder auftritt.“ (Zitiert nach Cerman, Aufklärung oder Illuminismus.)

Wien wird zu einem Zentrum der Freimaurerei: Sitzung der Loge „Zur gekrönten Hoffnung“ mit Mozart und Emanuel Schikaneder.
Thun lässt sich zunächst nicht beirren: In einem angemieteten Haus empfängt er während der Messe zahlreiche Patienten, seine „Heilmethode“ ist nach wie vor unspektakulär: Er legt seine Hand auf den schmerzenden Körperteil des Patienten und lässt diese so lange liegen, bis der Kranke ein Brennen oder einen Kitzel empfindet. Dann streicht er mit den Fingern über die Stelle, um den Schmerz in Richtung Hand oder Fuß des Patienten abzuleiten. Tatsächlich hat Thun damit auch Erfolg: Alle, die sich der „Wunderheilung“ unterziehen, behaupten unmittelbar danach, dass sie von ihrem Leiden geheilt seien, das ändert sich allerdings nach einigen Tagen: Nun klagen manche der Behandelten, dass sie ihr altes Gebrechen wieder verspüren würden.
Die Medizinische Fakultät der Universität Leipzig hat inzwischen beschlossen, dem Wunsch des Grafen Thun nachzukommen und die Wirkkraft seiner Hand wissenschaftlich zu untersuchen. Ein Privatarzt namens Langermann, der zuvor bereits Zeuge von Thuns Handauflegungen geworden ist, organisiert eine erste Sitzung, an der auch ein angesehener Universitätsprofessor teilnimmt. Während der Behandlung der Patienten ruft Thun dabei angeblich wiederholt „Und das ist Imagination!“, um so den Haupteinwand seiner Gegner von vornherein zu entkräften. Die Behandlungen an diesem Tag verlaufen erfolgreich, der Universitätsprofessor zeigt sich beeindruckt. Das ändert sich jedoch bei einer zweiten Sitzung: Thun ist an diesem Tag in schlechter Verfassung, die Handauflegungen zeitigen keinen Erfolg. Der Graf ist enttäuscht, die Stimmung wird jedoch vollends eisig, als er von einem Experiment Langermanns erfährt: Der Arzt führt Kranke mit verbundenen Augen in ein Zimmer, in dem ihnen angeblich Thun die Hand auflegt, tatsächlich ist dort jedoch eine andere Person – dennoch behaupten manche der Patienten, dass sie nun geheilt seien. Langermann, bis dahin ein Bewunderer Thuns, verliert damit seinen Glauben an die Wunderkraft in Thuns Hand, der Graf beschließt, das „undankbare Leipzig“ zu verlassen.

Eine Schar von Patienten wartet auf die Behandlung mit Franz Anton Mesmers heilkräftigem Magneten. Stich von Henri Thiriat.

Die „magischen Finger“: satirisches Blatt zu der von Mesmer angeblich entdeckten neuen „Naturkraft“, um 1778.
Öffentliche Polemik muss Thun in Leipzig auch von Seiten der Kirche hinnehmen. Ignaz Spalt, der Superior der Leipziger katholischen Gemeinde, wirft ihm vor, ein Scharlatan und Enthusiast zu sein, und mahnt ihn, die Heilungen aufzugeben. Spalt, der befürchtet, Thuns Wunderheilungen könnten die antikatholischen Vorurteile wieder bestärken, beruft sich in seinem Urteil auf eine Entscheidung der französischen königlichen Kommission des Jahres 1785, die das Prinzip der mesmerischen Heilungen damals verworfen hatte. In einem Brief an Spalt rechtfertigt sich Thun mit dem Hinweis, dass seine Fähigkeit ein physikalisches Phänomen sei und mit Religion nichts zu tun habe.
Die „Niederlage“ in Leipzig entmutigt den 60-jährigen Grafen nicht – jetzt wendet er sich an die Medizinische Fakultät der Universität Wien und bittet um eine wissenschaftliche Prüfung seiner Fähigkeit. Die Fakultät schickt ihm einen Fragebogen zu, den Thun auch ausfüllt. Seine heilende Kraft, so gibt er an, „sei eine Art elektrische Energie, die sich durch eine wandelnde Kombination der Naturkräfte äußere“. (Zitiert nach Cerman, Aufklärung oder Illuminismus.) Wie die Fakultät auf diese Ausführungen reagierte, ist nicht überliefert, das Schweigen der Quellen lässt vermuten, dass er seine Wunderheilungen auch in Wien allmählich eingestellt hat – der Spott in Leipzig hat ihn doch schwer getroffen. In der Folge widmet er sich ganz der Arbeit an seiner großen „Enzyklopädie“, einer „Sammlung alphabetisch niedergeschriebener Wahrheiten“ – das Manuskript dieses Kompendiums zum esoterischen Wissen der Zeit ist im Nachlass im Familienarchiv in Tetschen (Decin) erhalten und umfasst etwa 2.000 Seiten. Im Artikel Glaubens-Bekanntnuß der Enzyklopädie gibt der alternde Mystiker und Schwärmer zu, dass er Fehler begangen habe und sich von Freunden und Verwandten betrügen habe lassen. Er bedauere dies jedoch nicht, „da ihm all das Böse und das Gute die Geheimnisse des menschlichen Herzens offenbart hätten. Ohne all dies hätte er den Menschen nicht kennen gelernt.“ (Zitiert nach Cerman, Aufklärung oder Illuminismus.)
Franz Joseph Thun stirbt 1801 in Wien, ein Jahr nach seiner Frau Maria Wilhelmine.

1756–1819
DER NARREN-
DATTEL
JOHANN
LOCHNER
Jeder, der zum Narrendattel geht, Hat die Absicht, daß er Spaß versteht …
Aus dem Narrendattellied
Donnerstag, 4. März 1813. Europa steht im Zeichen des Kampfes gegen Napoleon. Russische Truppen ziehen in das von den Franzosen geräumte Berlin ein, Preußen steht knapp vor der Kriegserklärung an Frankreich. In der kaiserlichen Residenzstadt Wien hat man anderes im Blick: Die hochlöbliche Polizei-Oberdirektion sieht sich mit einer heiklen Beschwerde konfrontiert: Fürsterzbischof Sigismund Anton von Hohenwart zeigt erbost an, dass sich der Vorstadt-Gastwirt Johann Lochner „vulgo Narrendattel“ am Abend des Faschingdienstags erkühnt habe, in seinem Bierhaus in Lichtental ein „nach kirchlichem Gebrauch eingerichtetes Begräbniß des Faschings“ zu inszenieren, dabei habe er eine „lächerliche pöbelhafte Leichenpredigt“ gehalten. Die Polizei-Oberdirektion sieht den Tatbestand „Herabwürdigung der katholischen äußerlichen Religionsübungen“ erfüllt und lässt den „Narrendattel“ verhaften. Der Übeltäter ist kein Unbekannter, sondern stadtbekanntes Original: Johann Lochner, der Wirt vom Bierhaus „Zur heiligen Anna“ in der Badgasse in Lichtental (Nr. 130, heute Badgasse 29), berühmt für seine Grobheiten, die er den Gästen an den Kopf zu werfen pflegt.

Des Narrendattels „Leichenpredigt“ ist ihm ein Dorn im Auge: Sigismund Anton von Hohenwart.
Für die Predigtparodie wird eine Geldstrafe von 100 Gulden beantragt, die dem Armenfonds zufallen solle, eine Arreststrafe will man dem Hausinhaber und Wirt nicht antun; für die Zukunft werden ihm jedoch „alle unanständigen Scherze bei strenger Verantwortung, alle Beziehungen und Gespräche von Religion sowie die Produzierung kirchlicher Ceremonien“ streng untersagt, ansonsten drohe ihm der Verlust seines Gewerbes. Der Polizeibezirks-Direktion wird aufgetragen, dem zuvor bereits zweimal verwarnten Narrendattel „ununterbrochen“ ihre Aufmerksamkeit zu schenken, immerhin habe man die Gewinnsucht als „Triebfeder seiner pöbelhaften, oft anstößigen Scherze“ erkannt. Johann Lochner betreibt sein Wirtshaus „auf der Wiesen“, wie die Wiener das Lichtental auch nannten, zusammen mit seiner Frau Maria Anna seit dem Jahre 1800; die Bezeichnung „Zur heiligen Anna“ wird 1726 erstmals erwähnt, das Grundstück hat eine Gesamtfläche von 75 Wiener Quadratklaftern, also etwa 270 m2. Das Wirtshaus hat hier Tradition: Auf dem Besitz haftet seit 1699 eine Bierschank-Gerechtigkeit – im Lichtental nichts Außergewöhnliches: Etwa ein Fünftel aller Häuser sind Gaststätten. Das kleine Lokal umfasst ein Schank- und ein Extrazimmer, zehn Tische, drei Doppelbänke, 27 Sessel und ein Kanapee – für die feineren Gäste – bilden die ganze Einrichtung. Über einen kleinen Hof gelangt man zum Gastgarten, von Josef Richter in den Eipeldauerbriefen abschätzig als „Hühnersteign“ bezeichnet.
Ein grünes Käppchen in die Stirne gedrückt, pflegt Lochner seine Gäste mit den legendären Worten zu begrüßen: „Na, ist denn nirgends a Bradl z’haben als da bei mir?“ Jedes „Frauenzimmer“, das in sein Wirtshaus kommt, wird – auch in Begleitung eines Mannes – von ihm „punziert“, das heißt: Er gibt ihm einen Kuss. Lochners Erfolgsrezept sind seine „göttlichen“ Grobheiten, die er den Gästen an den Kopf wirft und über die sich diese „fast bucklicht“ lachen (Emil Karl Blümml und Gustav Gugitz, Altwienerisches).Als Josef Richter 1807 in den Eipeldauerbriefen über den pfiffigen Grobian aus der Vorstadt berichtet, wird Lochner endgültig zu einer Wiener Berühmtheit, das Geschäft blüht. Wie Richter, der mit dem Narrendattel persönlich bekannt ist und von ihm so manche Grobheit einstecken muss, später erzählt, hat der Eipeldauer-Artikel diesem „einige tausend Gulden tragn“.

Altwiener Vorstadt Lichtental: die Badgasse im Jahre 1901. Foto von August Stauda.
Anno 1811 widerfährt dem Wirt in Lichtental die Ehre, zum Helden eines Theaterstücks aufzusteigen. Joachim Perinet widmet ihm ein Lustspiel mit dem Titel Die Zusammenkunft beim Narrendattel, das am 13. Juli 1811 am Leopoldstädter Theater Premiere feiert und beim Publikum großen Anklang findet. Kritiker wie Adolf Bäuerle sprechen zwar von einem „läppischen, elenden Geistesproduct“, doch das kümmert die Zeitgenossen wenig – sogar in Graz, wo das Stück 1812 aufgeführt wird, kommen die Zuschauer in Scharen. Die Titelrolle des Narrendattel verkörpert in Wien Karl Schikaneder, der in Vorbereitung seiner Rolle beim wirklichen Narrendattel „Lektion nimmt“; Johann Lochner selbst verfolgt die Premiere aus einer Loge des Theaters; das Publikum applaudiert ihm am Ende der Vorstellung.
Der Erfolg verlangt wie damals üblich nach einer Parodie und diese wird prompt von einem unbekannten Autor geliefert: Am 18. August 1811 erlebt am Josefstädter Theater das Stück Die Wiedervereinigung beim Narrendattel seine Uraufführung, wieder ist der Zuspruch des Publikums groß, die Figur des Narrendattel wird von Tobias Kornhäusel verkörpert, dem es angeblich gelingt, Johann Lochner „in seiner ganze Eleganz von Grobheit“ darzustellen.
Der Wirt ist populärer denn je, sein Lokal bestens besucht, wie Josef Richter bestätigt: „Seit d’Leut sein Kopie aufn Theater haben kennen glernt, lauft alles ins Lichtenthal hinaus, um’s Original z’kennen, und da hat er sein Gartl täglich voll, und da denkt er sich also, und sagts seinen Gästen so gar ins Gsicht: ich bin ein Narr in mein Sack; ihr seyd aber die wahren Narrn, weil ihr so weit zu mir herauslauft, um Grobheiten z’hohln.“
Der Narrendattel Johann Lochner wird zu einer stehenden Figur, auf ihn bezieht sich Ferdinand Raimund in seinem 1822 verfassten Zauberspiel Die gefesselte Phantasie, wenn der grobe Harfenist Nachtigall im 1.Aufzug, 14.Auftritt, ein „zweiter Narrendattel“ genannt wird.
ZU TODE GESTORBEN

„Zwölf Anekdoten zum Todlachen“: Die Geschichten rund um den Narrendattel fanden reißend Absatz.
Bei seinem frühen Tod durch „Schlagfluß“ am 27. Jänner 1819 hinterlässt der 63-jährige Johann Lochner immerhin 4.929 Gulden Wiener Währung, unter großer Teilnahme der Wiener Bevölkerung wird er am Währinger Allgemeinen Friedhof vor der Nußdorfer Linie beigesetzt. Es ist ein Leichenbegängnis, wie er es sich gewünscht hätte: Alle, die „auf den Gründen draußen“ Bier trinken, sind gekommen: Biermusikanten und „Bierharpfenisten“, Blinde und Sehende, Zuckerwerk-Hausiererinnen und Krapfenweiber. Drei Priester begleiten den Zug, drei Glocken läuten und zwei Posaunisten entlocken ihren Instrumenten klagende Töne, „alles had g’wannt und bet’t“, erzählt Franz Xaver Karl Gewey, der Nachfolger Richters, in seinem launigen Nachruf, verfasst in eigenwilliger Wienerischer Mundart, in den Eipeldauerbriefen: „Der 27te Jäner 1819 war an allgemein’r Tag der Trau’r für alli Narr’n in Wien, b’sunders für die Liechtenthaler, denn an den Tag seyn’s alli armi Wais’n wor’n, indem ihnen herzinniggeliebtester Vater, oder Datl, der Weltberühmte sogenannte Narr’ndat’l, Herr Johann Lachner (sic!), privilegirter Spaßvog’l, Bierwirth und Hausinhaber Nro. 130 in Liecht’nthal das Zeitliche mit den Ewig’n verwechselt, und si zun größt’n Leidwes’n sein’r Kinder wirkli z’tod gestorb’n had – nid umsunst had die Natur den Mann Gottes den Nahmen Lachner g’geb’n, indem er dö Narr’n, dö zu ihm häuffi hinauspofelt seyn, durch alli seini Schnack’n und Schwänk, Verklaidungen und Scenespielarei’n, Glampf ’ln und Poss’n so rasend had lach’n g’macht, daß se si oft a Hand, oder an’n Fueß häd’n auslach’n mög’n, dadurch had si der Herr Lachner (tröst’n God) sehr große Verdienst um den Staat erworb’n, da er n den Zeitpunkt, wo die Zeit’n g’rad so schlecht war’n, daß der g’mani Mensch völli allerweil verzweif ’lt’r um’rgang’n iß, durch sein’n gued’n Hamor den’n niderg’detscht’n Leud’n, dö zu ihm als ihner’r Tröst’r auf a Glas Bier eini gang’n seyn, alli Traurikeit weg narriert …“

Johann Lochner, der Grobian und „privilegierte Spaßvogel“ aus der Badgassse in der Vorstadt Lichtental, wurde zur literarischen Figur, man begegnete ihm auf den Bühnen und belustigte sich an den zahlreichen Anekdoten über ihn.
Das Gasthaus in der Badgasse 29, später „Zum Narrendattel“ genannt, existierte bis in unsere Tage. Ein „Kulturverein Narrendattel“ bemühte sich um einen regelmäßigen Kulturbetrieb im Lokal, das, so der Wunsch der Betreiberfamilie, in seiner Ursprünglichkeit erhalten bleiben sollte. Im Jahr 2000 musste der Betrieb jedoch eingestellt werden, das Haus stand in der Folge leer. Da das Bundesdenkmalamt einen Denkmalschutz für nicht gerechtfertigt hielt, wurden das Haus „Zur heiligen Anna“ und das Nachbargebäude „Zum Blumenstock“, beide aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammend, schließlich 2014 abgerissen – ein Altwiener Erinnerungsort verschwand unwiederbringlich.
Geblieben ist im Wienerischen der „viel liebenswürdiges Gemüt verratende Ausdruck“ (Blümml/Gugitz) „Narrendattel“ für einen „Spaßmacher“ und nicht allzu verrückten Menschen, vergessen ist jedoch der Mensch, für den der Begriff einst geprägt wurde und der die Traurigkeit der Zeitgenossen so erfolgreich weg narrierte …
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.