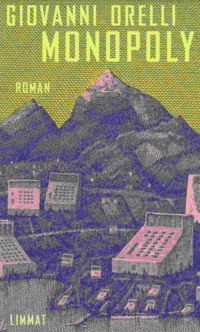Kitabı oku: «Monopoly», sayfa 2
II SCHAFFHAUSEN
Die Reihe war an mir, ich war ein wenig erregt und liess den Würfel über die Spielfläche rollen: er zeigte drei Augen. Ich ging nach Schaffhausen. Nun konnte ich mich endlich an Ort und Stelle davon überzeugen, ob der gewaltige Rheinstrom wirklich den Eindruck macht, als beklage er seinen Sturz in die Tiefe, wie Poggio2 im 15. Jahrhundert schrieb. Doch rief mich der Bankhalter in die Wirklichkeit zurück.
«Kaufen Sie?»
Ich begriff nur eines: bis jetzt hatte ich nichts begriffen. Ein Bankhalter ist aber geduldig: er steht im Dienste des Volkes. Er griff nach einem Blatt, das auf der linken Seite des Tisches lag und legte es ruhig nach rechts hinüber. Dann faltete er die Hände, legte sie vor sich auf die Tischplatte und erklärte:
«Passen Sie auf, Sie sind als erster auf dem Platz Schaffhausen angekommen. Wenn Sie wollen – und ich rate es Ihnen in Ihrem eigenen Interesse –, dann überweisen Sie mir 1200 Franken : das ist ein Pauschalbetrag. Die Summe wurde mit Rücksicht auf die Bedeutung der Stadt festgelegt. Für Zürich Paradeplatz würde eine andere Quote gelten: dort wären es 8000 Franken. Nun gut, Sie überweisen die 1200 Franken, und ich gebe Ihnen diese auf Schaffhausen Vordergasse ausgestellte Besitzurkunde. Sie können diese Besitzurkunde jetzt behalten. In diesem Fall muss Ihnen jeder Spieler, der nach Schaffhausen kommt, 80 Franken geben. Wenn Sie jedoch ausser in Schaffhausen auch in Chur Grundstücke erwerben, haben Sie die Möglichkeit, Häuser oder ein Hotel zu bauen. Je mehr Sie bauen, desto höher werden die Mieten, die die anderen Spieler Ihnen zahlen müssen. Es liegt auf der Hand, dass Fortuna nur dem Unternehmungslustigen hold ist, dem Furchtsamen aber den Rücken kehrt.» – «Die Schwachen sind gewöhnlich auch feige», fügte Professor Vilfredo Pareto seinerseits hinzu, «Sie begehen Diebstahl im Verborgenen, heimtückisch und geschickt – sie haben nicht das Herz, in aller Öffentlichkeit einen bewaffneten Überfall zu wagen.»
Vielleicht gehörte ich auch zu jener Sorte von Feiglingen?
In Schaffhausen erwartete mich eine Botschaft von Crunch, dem mächtigen Direktor der Zürcher Zentrale, dem Gegenspieler von Dash beim Sturm auf den Gipfel der Bankhierarchie des Landes. Und Dash war ja ausgeschaltet ... Da ich im Geschäftsleben von Crunch vor allem kulturelle Belange vertrete, bat mich der grosse Chef, bei der Eröffnung einer für Führungskräfte und hohe Bankfunktionäre einberufenen Tagung an seine Stelle zu treten. Der plötzliche Tod von Dash erlaubte ihm nicht, sich von der Walstatt zu entfernen. Die Früchte sind reif, so dachte ich. In der Botschaft hiess es weiter, der Humanist werde auf diese Weise Gelegenheit haben, eines der schönsten Schlösser des Landes zu bewundern, das einst ein Bollwerk gegen das Ausland gewesen war.
«Da gibt’s zu trinken», liess sich ein Kollege aus dem Clan von Krachnuss vernehmen und schaute dabei in den Spiegel, als wir in dem alten Hotel angekommen waren. «Schliesslich handelt es sich ja um ein Symposium.» Die Taxis warteten vor dem Palast der Gerechten. Ein Grüppchen Neugieriger hatte den Finanzminister erkannt und applaudierte. Um zehn Uhr kamen wir vor dem Schlosstor an. Unsere Lederschuhe knirschten vergnüglich auf dem Kies der Allee. Um zehn Uhr fünfzehn, wenn unendliche Vergangenheit und unendliche Zukunft zusammentreffen (das Thema des Symposiums hiess ja «Die Zukunft unserer Banken»), hält die flüchtige Gegenwart einen Augenblick an: Kaffee und Brötchen. Milch nach Belieben.
Gute, schweizerische Milch.
«Der wohlverdiente gute Ruf unseres Landes», begann der Finanzminister mit ernster, nachdenklicher Stimme, «hat infolge bedauerlicher vonälle in unseren Kreditinstituten einen schweren Schlag erhalten. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, dieses trojanische Pferd rechtzeitig zu entlarven, mit welchem der Gegner sogar bis ins Innere unseres Staatswesens vorstossen könnte.»
Dann entspannte sich der Minister. Er sprach über die Massnahmen, die von der Regierung gemeinsam mit den entsprechenden verantwortlichen Stellen zu ergreifen waren. Er sprach von der Philosophie des Regierens, von seiner, des Finanzministers Philosophie. Doch dürfe man ihn nicht missverstehen: und mit feinem Lächeln betonte er, dass ein Minister der Jakobiner nicht etwa dasselbe sei wie ein jakobinischer Minister.
Er scherzte, offensichtlich, um die Stimmung aufzulockern, denn es näherte sich die Stunde des Aperitifs, den die Stadt Schaffhausen für ihre illustren und hochwillkommenen Gäste bereithielt. Während er seinen Rheinwein kostete, unterhielt sich der Minister mit Professor von Sogno, dessen Rede nach dem Mittagessen folgen sollte und der sich gegenwärtig eifrig mit einem Tellerchen voller Pommes Chips beschäftigte – für sein zahnloses Fischmaul zweifellos das Beste.
Der Kopf des Professors von Sogno war wie mit Lineal und Zirkel gezeichnet: kahl und rund, auf gleichfalls rundem Körper mit zwei gänzlich unscheinbaren Beinchen. So rollte er vorwärts wie der kugelrunde Lionardo in jenem Zeichentrickfilm der italienischen Fernsehserie für Kinder.
Professor von Sogno bemerkte, dass ich ihn mit übergrosser Aufmerksamkeit beobachtete, und er fragte sich vielleicht, wer da für ihn ein so grosses Interesse zeigen mochte. Als der Finanzminister von einem Funktionär begrüsst und in ein Gespräch verwickelt wurde, kam Professor von Sogno zu mir.
«Agrippa – Tessin, ach Tessin ... Einmal habe ich dort gesprochen, im Tessin ... in Locarno ...»
Ja richtig, ich hatte ihn schon einmal gesehen! Im Frühling 1945 bei einer Zusammenkunft der Bürger- und Patriziervereinigung.
Lionardo von Sogno begann alsdann von Wien zu sprechen, von seiner Zeit als Attaché in Wien. Und, en passant, erinnerte er sich an den Einmarsch der Mongolen. Die Wienerinnen ... In Kellern mussten sie sich verstecken, um nicht «dans les griffes des mongoles» zu fallen, in die Krallen der Asiaten, der Mongolen, wie er den Einmarsch der Roten Armee umschrieb. Niemals waren die Soldaten ja besonders höflich zu den Frauen gewesen. Aber die Mongolen!
Der Krieg führte diese Wildkatzen nach Europa; die Städte, die Häuser, die Frauen spiegelten sich in ihren Schlitzaugen. Da hiess es: aufspüren, anspringen, zerfleischen. Und dann das Geheul! Herrliches, weisses Fleisch, so zart, dass man sogar die Knochen verschlingen könnte!
Das beste Fleisch ist das Brustfleisch: die glänzende Tafel der Wiener, die kristallenen Gläser, der Walzer ... Asiatischer Samenfluss über weissem Leib ...
Einen ganzen Monat lang, bei Tag und Nacht.
Dies ac noctes.
Der Versammlungsraum war hellerleuchtet. Patriziat und Bürgertum vereint. Wie viele willige Frauen suchten ihre Straussenfederköpfchen zu verbergen und wussten nicht wo, wohin sich verstecken; und andere suchten mit ausgestreckten, schwachen Armen einen letzten Damm zu bilden gegen die alles verschlingende Flut.
Auch der kleine Hans hatte den Zeigefinger in das Loch des Deiches gesteckt und verhinderte so, dass Holland unter den Fluten begraben wurde.
Ein ekelerregender Geruch war in den Saal gedrungen und verbreitete sich von hier aus in der ganzen kleinen Stadt.
Die Mönche des die Stadt beherrschenden und beschützenden Sanktuariums mussten sich die merkwürdigsten Beichten anhören und bemühten sich aus allen Kräften, die seltsamsten Anfechtungen im Keim zu ersticken: «Beten Sie, meine Tochter, beten Sie unermüdlich!»
Und Lionardo von Sogno wurde vom gesamten Magistrat der Stadt, von den Vertretern der Zünfte und denen des Klerus, im Rathaus empfangen.
Er sah sich gezwungen, die Schrecken der Mongolen und der Frauen von Wien erneut zu erzählen: O ja, ja, ganz gewiss, das Ende der Welt. Das waren die Zeichen! Es gab keinen Zweifel.
Sie machten keinerlei Unterschied, die Asiaten, sie schauten weder auf das Alter noch auf die Schönheit.
Dies flüsterte von Sogno dem alten Bürgermeister ins Ohr, genau wie der Lionardo im Fernsehen, und dieser riss die Augen auf wie noch nie in seinem Leben, nicht einmal bei der denkwürdigen Begegnung von Stresemann und Briand im Jahre 1925. Er bedeckte die Augen mit seiner Rechten, als ob sie aus ihren Höhlen treten und über die Tränensäcke herabrollen könnten.
«Wieso sind denn die Asiaten nicht auf den Gedanken gekommen, in die Keller hinunterzusteigen?», fragte in der Osteria der Meister des Weinkellers von Canetti.
«In den Kellern lagert man ja vor allem den Wein. Möglich, dass die Nazischweine ihn schon bis zum letzten Tropfen ausgetrunken hatten. In Wien hat man ja besonders guten Wein. Solchen Wein hätten die Asiaten nicht so bald wieder gefunden.» Frauen und Wein! Dieses Lied hätte sich, wie der Walzer, von selbst ergeben, sobald sich die Schleusen dem gelben Mongolenstrom geöffnet hatten: ein wilder oder ein schwermütiger Gesang, voller Befriedigung und voller Melancholie, denn auch das mongolische Wesen ist, wie das europäische, post coitum triste.
Oder es hatte den Teufel im Leib wie die krähenden Hähne im Kollegium, wenn sie durch einen Drahtzaun von den Hennen getrennt waren. Einmal hatten wir ihnen eine Henne hereingeschoben, hatten sie angefeuert: «Geht los, Mongolen, zeigt was ihr könnt!», da klingelte es schon zum zweiten Mal, und wir mussten ins Klassenzimmer zurück.
Während der ganzen folgenden Unterrichtsstunde (der Didaktiklehrer fuhr in seinem Thema fort und verbreitete sich über die Vor- und Nachteile der dreifach gelöcherten Schreibfeder und der in der Elementarschule benutzten Schreibfeder Mitchell-la-rosa) hatten die Hähne, nach kaum zwei Minuten Pause, in der Hitze des Nachmittags ganz ausserplanmässig von Neuem ihren Gesang von Wien angestimmt und krähten im Kanon: Halleluja. Selbst der Ex-Seminarist, der in der Schule niemals den Mund verzog, lachte Tränen.
Der Lehrer aber nahm mit heftiger Bewegung die Brille ab. «Darf ich Sie bitten! Was nehmen Sie sich heraus!»
Doch konnte der Lehrer ebenso wenig wie alle anderen ehrlichen und gesunden Staatsbürger Mitteleuropas etwas ausrichten gegen diese mühsam erzwungene Keuschheit, die von jenen himmlischen Hähnen – nicht etwa von übersättigten Tieren – verhöhnt wurde.
Am Ende der Unterrichtsstunde gab es niemanden, der für die arme Henne Partei ergriffen hätte, sei sie aus Wien oder aus Padua, Rodeländer oder Leghorn, niemand, der sie bemitleidet hätte, als wir sie zertreten, aufgeschwollen und leblos im Gehege liegen sahen.
Die Federn der Erinnerung kratzen und knirschen – wie die Krallen der Mongolen.
Einige Wochen lang waren sogar die Hausaufgaben und die Klassenarbeiten durch die Mongolen infiziert. Aber der eigentliche Skandal brach erst in der Religionsstunde aus, als ein Junge die Frage sehr entschlossen auf seine Weise anpackte:
In der Wiener Vorstadt gibt es einen Stall, in dem sich eine junge Mutter verbirgt, eine junge Frau allein mit ihrem Kind. Der Mann, der sich als Vater des Kindes bekannt hat, ist ein Jude namens Josef – und er ist eines Tages im Morgengrauen von Gestapobeamten in Helmen und Stiefeln verhaftet worden. Er wurde mit vielen anderen in verschlossenen Waggons auf die Reise geschickt. Mit unbekanntem Ziel. Die junge Frau – sie heisst Maria – besitzt eine Maschinenpistole, die einer der Hirten unter der Futterkrippe versteckt hat. Ein anderer hat ihr beigebracht, wie man sie gebraucht. Als sich das Tor zum Stall öffnet und ein Mongole sich mit offenem Munde nähert – was wird die Jungfrau tun?
Schiesst sie oder schiesst sie nicht?
Dem Religionslehrer stieg die Röte ins Gesicht, und er war der Ansicht, hier gehe es um eine Entweihung der Muttergottes, gleichzeitig also um eine Herausforderung des Christentums. Ging also ipso facto zur Direktion, um den Fall anzuzeigen.
Tags darauf berichtete die Zeitung darüber und forderte strenge Massregeln gegen diese gotteslästerliche Frechheit der Jugendlichen. In der Stadt bildeten sich zwei Parteien: die einen hätten geschossen, die anderen nicht.
Ein uralter Priester, seinerzeit Vorsteher des Domkapitels, warf seine Stimme in die Waagschale und gab öffentlich bekannt: Nein, die Madonna hätte nicht geschossen, die Madonna benutze keine Maschinenpistole. Aber die Mehrheit gab sich nicht geschlagen.
Und wenn sie nun schwanger geworden wäre? Von einem Mongolen? Der greise Priester sagte nichts mehr. Er war erschöpft.
Glücklicherweise kam der Sommer, und mit ihm die ersten Ferien in Friedenszeit; die düsteren Wolken zerstreuten sich im frischen Ferienwind.
Seit Jahren war ich also mit jenem Bild des Mongolen vertraut, das eine Spur, eine Narbe wie von einem scharfen Messer, auf meiner jungen Haut hinterlassen hatte.
Hier ist nun ein jovialer Mann, der Pommes frites und Chips in sich hineinstopft wie der Frosch die Fliegen.
Mir kam der Gedanke, er sei mehr Frosch als Wissenschaftler, und ich war im Begriff ihn zu fragen, ob er sich noch an die Mongolen erinnere: doch er sollte ja gegen Schluss des Essens sprechen. Lionardo von Sogno erhob sich also beim letzten Gang, tauchte aus den Tischtüchern auf, faltete die Serviette sorgfältig zusammen und begann zu sprechen. Er begrüsste den Finanzminister, die Führungskräfte aus dem Finanzwesen, während er seiner Jackentasche ein Bündel dünner, kleiner Blättchen entnahm, die in seiner Hand bebten wie die Stanniol-Lamellen in den Weinbergen.
Herr Bundesrat, Herr Präsident, meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, signore e signori! Seine Augen waren nicht zu sehen, lagen tief wie in zwei schrägen Schlitzwunden. Das waren Augen, die die Mongolen gesehen hatten und vieles andere, wenn auch nur aus dem Fenster unserer Botschaft. Vielleicht war sein ständiges Pommes-frites-Kauen nur ein Ausdruck verhaltener Verzweiflung über das alternde Herz Europas, so übervoll von Weisheit und Machtlosigkeit.
«Meine Damen und Herren. Heute werde ich Sie ein wenig mit meinem Stammbaum langweilen.»
Es war ein wundervoller Stammbaum. Er führte weit zurück ins alte Wien und stand dank einiger kühner Eheschliessungen bald in üppiger Blüte: ein Urahn aus dem Rätoromanischen, eine Urgrossmutter aus einem der Täler am Lago Maggiore, andere Familienmitglieder aus der deutschen oder der welschen Schweiz, woraus sich ergab, in welch natürlicher Weise helvetischer Geist in ihm verschmolzen war: wie die Wasser, die von den Alpengletschern herabfliessen, gleich wie das Licht vom Heiligen Geist, wie in Manzonis «Pentecoste» die Flüsse Europas, wo es heisst:
Wie aus dem dunklen Schosse
Der Alpen Helvetiens dringen
hervor der Tessin und die Rhône
und auch der stolze Rhein ...3
Im Stammbaum von Sognos fand sich ein Ahnherr, der Hauptmann im Sonderbundskrieg gewesen war, im Jahre 1847; er hatte also auf der Seite der Katholiken gekämpft. Ein anderer war enger Mitarbeiter von General Dufour gewesen, gehörte also zu den Protestanten. Mit ein wenig gutem Willen und im Laufe der Zeit (wahrlich, die Geduld könnte zu unserer zweiten Landesfahne werden!) lassen sich die Extreme zu friedlicher Gemeinsamkeit zusammenführen. Übrigens ist ja im Sonderbundskrieg, der im Jahre 1848 die Eidgenossenschaft um ein Haar in zwei Teile, einen protestantischen und einen katholischen, gespalten hätte, kein Tropfen Blut geflossen. Höchstens Sperma – die Geschichte jedoch, die sich nicht bis zu solchen Niedrigkeiten herablässt, hat davon nichts zu berichten. Und wenn ja, dann nur in sonntäglichen, gleichsam touristischen Schilderungen: also nicht zu verwechseln mit Mongolenzeiten – man muss hier wohl zu unterscheiden wissen.
Eine Abteilung des Sonderbundheeres kam aus dem Wallis und rückte bis in den nördlichsten Zipfel des Tessins vor. Dort stand man auf der Seite der Protestanten, der Bundestruppen also, die von General Dufour befehligt wurden.
Es gibt keine Aufzeichnungen darüber; man weiss nur, sie lagerten dort im Gras, zwischen den Stangen für das Heu, schlugen sich die Bäuche voll und machten sich noch am Nachmittag auf den Heimweg über die Passstrasse.
Das ist die einzige Kriegshandlung, von der unsere alten Leute zu berichten wussten, so wie sie es von ihren Vorfahren vernommen hatten. Es klang ganz nach einer Landpartie. Glückliche Heimat du!
Von Sogno wollte die Ursprünge dieses Glückes erhellen und kam zurück auf die Versöhnung zwischen den Ungleichen, die Harmonie zwischen verschiedenen Rassen, Religionen, Sprachen, zwischen verschiedenartigen Kulturen und Klassen: hier war das Modell, eine Mahnung an das geplagte Europa. Doch wolle er unser Land keineswegs als «sozialtherapeutische Klinik» hinstellen – wie er endlich mit grossem Ernst betonte, als stünde er plötzlich am Fenster der Wiener Botschaft und habe von hier zu den Menschen zu sprechen.
Mit dem Schlusskonsonanten von «Klinik», diesem explosiven k, sprühten einige Speicheltröpfchen auf die Serviette und auf das Hemd, gerade unterhalb der Fliege, nicht aufs fliehende Kinn jedoch, das in den gewaltigen Massen des Halses verschwand.
«Meine Damen und Herren. Mein Anliegen ist es aber nicht nur, Sie mit Geschichten zu ergötzen. Mein Anliegen sind vielmehr die Banken. Die Bank ist wie das Meer. Sie empfängt alles und sie verteilt alles; sie folgt dem unermüdlichen Rhythmus der Natur, den Wechselfällen des menschlichen Lebens. Mein Urgrossvater väterlicherseits brachte seine ersten Ersparnisse auf die Bank von Chur, und ein glühender Verehrer meiner Urgrossmutter mütterlicherseits erhielt von einer Briger Filiale ein für jene Zeiten recht ansehnliches Darlehen, das in dreissig Jahren rückzahlbar war und zum Ankauf eines Waldes benötigt wurde.
Er war Junggeselle, wie Ihnen schon klar geworden ist, und als er das Darlehen erhielt, war er siebzig Jahre alt. Sicher, er war ein robuster Mann, doch bei einer Flasche Wein gestand er seinen Freunden, dass er doch nicht so ganz sicher sei, noch dreissig Jahre zu leben.
Er liess den ganzen Wald abholzen, und die Stämme rutschten ins Tal hinab. Aber gerade zu diesem Zeitpunkt ereignete sich jene denkwürdige Überschwemmungskatastrophe: das ganze Holz verschwand im Genfersee.
Er starb mit neunundachtzig Jahren, ohne dass er die Schuldsumme hätte zurückzahlen müssen – und Nachkommen hatte er ja keine.
Das ist die Bank. Ich habe an diesen Fall erinnert, denn er kann uns lehren, menschliche Schicksale mit einer gewissen philosophischen Haltung zu betrachten. Aber dazu musste ich Sie ja nicht erst auffordern, denn Sie haben die Güte gehabt, einen bescheidenen Mann mit seiner ganzen Sammlung von Erinnerungen einzuladen, und Sie haben die Güte gehabt, ihm zuzuhören.»
Warmer, herzlicher Beifall folgte auf die Worte von Sognos, der sich jetzt niederliess und seine Gesichtsfalten ordnete. Der Finanzminister drückte ihm kräftig die Hand.
Meine Damen und Herren.
Diesmal war es der Hausmeister, der seit einer halben Stunde auf Zehenspitzen hin und her ging, behutsam die Türen öffnete und anlehnte.
Wir gingen ins Freie. Den meisten war jedoch die Lust vergangen, die Burg zu besichtigen, Schilder und Inschriften zu entziffern. Den grössten Andrang verzeichneten jene Schilder mit DAMEN und HERREN. Vor HERREN bildete sich sogar eine kleine Schlange, bis ein Basler von der Ciba sich sogar eine kleine Schlange, bis ein Basler von der Ciba sich endlich ein Herz fasste und – Grundsätze und Regeln sind wie Hosen, die man bei Bedarf fallenlassen muss – mit einer Geste komischen Bedauerns in der Abteilung DAMEN verschwand.
Fröhliches Gelächter überall, auch bei denen, die sich an die alte Kanone lehnten, deren Rohr gähnend auf den Feind gerichtet war.
Jemand hatte seinen Spaziergang bis zur Zugbrücke ausgedehnt und schaute in den Burggraben hinunter, oder er blickte durch die Schiessscharten über die Ebene, die in grosse, rechteckige Felder, in geschlossene Waldstücke aufgeteilt war, regelmässig und sauber. Der Fluss durchquerte das Land in weiten Kurven oder in geraden Kanälen.
Schönes, wunderschönes Land.
Im Auto sass der Basler, korpulent, mit dem Stumpen zwischen den Zähnen. Denk an Wien! Ich fühlte Mongolenblut in meinen Adern.
Diese Wienerinnen in den Kellern!
Sollte doch die «kulturelle Thematik» zum Teufel gehen, alle die knallenden ks des Professors von Sogno.