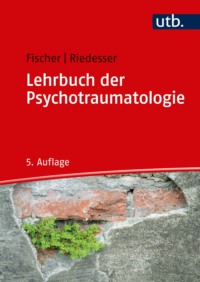Kitabı oku: «Lehrbuch der Psychotraumatologie», sayfa 11
Abbildung 5 gibt eine Übersicht über den Zyklus der Traumaverarbeitung im post-expositorischen Zeitraum. Die Quadranten I bis IV entsprechen den Phasen der traumatischen Reaktion bzw. den zeitlich überdauernden Erlebniszuständen, die bei einer Fixierung dieser Phasen zu erwarten sind. Wir beginnen von links mit Quadrant I. Dieser entspricht der peritraumatischen Erlebnissituation mit Aufschrei bzw. Reizüberflutung. Hier setzt ein erster Abwehrversuch ein mit dem Ziel, die überschießenden Affekte zu kontrollieren oder zu modulieren. Dieser leitet über zur Vermeidungs- bzw. Verleugnungsphase (Quadrant II). Wird diese Phase fixiert, so kommt es zu Gefühlsabstumpfung (→ numbing) oder einer allgemeinen Erstarrung der Persönlichkeit, bedingt durch übermäßige Abwehr im Sinne einer pathologischen Übermodulation der vorausgehenden oder drohenden Reizüberflutung.
Bei Lockerung der Abwehr oder einer dispositionellen Abwehrschwäche kommt es zum Übergang in die Intrusionsphase bzw. den Intrusionszustand mit sich aufdrängenden Vorstellungsbildern, Gedanken und Körperempfindungen, die assoziativ mit der traumatischen Situation vernetzt sind (Quadrant III). Ein funktionsfähiges Kontrollsystem aus → Coping- bzw. → Abwehrmechanismen kann verhindern, dass sich die Intrusionsphase in einen Zustand dauerhafter pathologischer Reizüberflutung verwandelt. Die Rückkopplungsschleife deutet in der Graphik den für die Traumareaktion und das PTBS charakteristischen biphasischen Wechsel von Verleugnung und Intrusion an. Das Durcharbeiten traumatischer Agenda wird möglich, wenn die Fähigkeit zur Selbstberuhigung so weit gestärkt ist, dass ein kontrolliertes Wiedererleben der traumatischen Situation möglich wird. Jetzt kann der in den kognitiv-emotionalen Schemata der Persönlichkeit organisierte Wissensbestand so weit umgearbeitet werden, dass die traumatische Erfahrung integriert wird. Die erschütterten Annahmen des Selbst- und Weltverständnisses werden in mühsamen Schritten qualitativ neu wieder aufgebaut.

Abbildung 5: Übersicht über die biphasische Reaktion und den Zyklus der Traumaverarbeitung
Gegenüber dem Modell der traumatischen Reaktion nach Horowitz wurde kritisch eingewandt, dass nach der peritraumatischen Erfahrung, dem „Aufschrei“, nicht immer eine Phase der Verleugnung, sondern bisweilen intrusive Reizüberflutung zu beobachten sei (so etwa Brewin et al. 1996). Unseres Erachtens liegt hier ein Missverständnis vor. Die Phasenfolge entspricht einer erwartbaren Sequenz, die sich aus dem Streben des Organismus ergibt, anhaltende Panikzustände zu vermeiden und sie mit den verfügbaren Abwehrkräften zu beenden. Dass dieses Bestreben im Einzelfall scheitern kann aus Gründen, die in der Persönlichkeit liegen (z. B. Abwehrschwäche) oder in spezifischen Situationsfaktoren (etwa untergründiges Fortbestehen der traumatischen Situation), stellt keinen prinzipiellen Einwand gegen die Phasenfolge dar. Das Modell ist im Gegenteil klinisch insofern nützlich, als es dazu anhält, bei Abweichungen vom erwartbaren Verlauf nach Gründen zu forschen, die dafür verantwortlich sind.
Das basale PTBS, wie es in DSM und ICD formuliert ist, erweist sich von der Dynamik der Traumareaktion her als Spezialfall des Verlaufsprozesses. Hier werden die Quadranten II und III gleichzeitig fixiert und weisen beide gleichzeitig pathologische Über- bzw. Untermodulationen auf. Symptombilder, die manifest nur durch eine der beiden Phasen bestimmt sind, fallen aus dem diagnostischen Algorithmus des PTSD bislang heraus, obwohl sie zweifellos zum Traumaspektrum gehören. Daher sollte sich auch die psychotraumatologische → Diagnostik an der dynamischen Gestalt der Traumareaktion sowie der übergreifenden Verlaufsgestalt von Situation, Reaktion und Prozess traumatischer Erlebnisverarbeitung orientieren.
Das biphasische Modell der traumatischen Reaktion mit seiner Schaukelbewegung von Intrusion und Verleugnung lässt Mechanismen erkennen, mit denen das überforderte bzw. verletzte biopsychische System die Beeinträchtigung zu überwinden versucht. In körperbezogener Analogie ausgedrückt, stellt es einen „Wundheilungsmechanismus“ der verletzten Psyche dar. Wie das Situationskreismodell in Bezug auf das peritraumatische Erleben eröffnet es einen ersten Zugang zum psychobiologischen Sinn verschiedener psychotraumatologischer Symptome und Syndrome. Diese lassen sich als „Entgleisung“ von Phasen eines natürlichen Selbstheilungsprozesses oder als Fixierung dieser Phasen verstehen.
Der Verarbeitungszyklus kann in jeder Phase entgleisen oder „einfrieren“. Unter welchen näheren Bedingungen dies geschieht, ist eine interessante, bislang unbeantwortete Forschungsfrage. Einer Fixierung z. B. in Phase II, die einer generellen Abstumpfung mit „frozen states“ und psychosomatischer Symptomatik entspricht, kann ein positiver Rückkopplungskreis zwischen verzerrter Erinnerung an die traumatische Situation und Abwehr zugrunde liegen. Je unzugänglicher die Erinnerung ist, desto bedrohlicher wird sie erlebt, desto wichtiger wird zugleich die Abwehrform der Erinnerungs- und Affektvermeidung. Das therapeutische Vorgehen sollte dann gezielt auf die Unterbrechung und Auflösung solcher Regelkreise gerichtet sein.
Eine andere Form der Stagnation im Verarbeitungszyklus kann sich daraus ergeben, dass die traumatische Situation unterschwellig fortbesteht. Dies ist bei vielen Betroffenen mit einer Victimisierungserfahrung der Fall. Unser → Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung geht von der Annahme aus, dass der Prozess der Traumaverarbeitung besonders in diesen Fällen auch sozialer Natur ist. Wird den Opfern nicht jene Anerkennung und Unterstützung zuteil, die von ihrem Gerechtigkeitsempfinden her angebracht erscheint, so kann sich das erschütterte Selbst- und Weltverständnis nicht regenerieren. Das Trauma bleibt „unfasslich“. Die Betroffenen fühlen sich fremd in einer sozialen Welt, die das Unrecht, das ihnen widerfuhr als solches nicht anerkennt. Auch durch – äußerlich betrachtet – geringe „Dosen“ von Retraumatisierung kann der Erholungsprozess unterbrochen werden. Die Betroffenen verlieren dann die Hoffnung auf einen relativen Abschluss des Verarbeitungszyklus und eine Restitution ihres erschütterten Weltverständnisses. In diesem Falle geht die traumatische Reaktion, entsprechend unserem Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung, in die dritte Phase über, den traumatischen Prozess (im Folgenden Kapitel).
Allgemein sind 3 unterschiedliche Ausgänge der postexpositorischen Reaktion denkbar: A) deren Abschluss im Sinne der „completion-tendency“, B) vorzeitige Unterbrechung des Verarbeitungsprozesses oder C) chronisches Fortbestehen der traumatischen Reaktion. Im ersten Fall ist es der Persönlichkeit gelungen, die traumatische Erfahrung mit ihrem Selbst- und Weltverständnis in Einklang zu bringen. Es besteht keine Neigung mehr, in unrealistischer Weise Schuld zuzuschreiben oder eine Wiederkehr des Traumas zu erwarten. Es bestehen keine Erinnerungsverzerrungen oder Abwehrprozesse. Reizkonstellationen, die an das Trauma erinnern oder traumabezogene Stimmungslagen können zugelassen und in ihrer Bedeutung erkannt werden. Personen, die ihre traumatische Erfahrung erfolgreich durchgearbeitet haben, sprechen mit adäquatem Affekt (z. B. Empörung) von den Erlebnissen und sind in der Lage, einen vollständigen Bericht zu geben.
Personen (B), die den Verarbeitungsprozess vorzeitig unterbrechen, zeigen zwar nach einiger Zeit keine Symptome mehr, bleiben aber untergründig mit der traumatischen Erfahrung beschäftigt. Sie zeigen Erinnerungsverzerrungen und reagieren auf traumabezogene Reizkonstellationen mit Schrecken und intensivem Vermeidungsverhalten. Eine erhöhte Somatisierungsneigung ist charakteristisch. Zu den disponierenden Faktoren gehören u. a. eine verstärkte Tendenz zu Verleugnung und Verdrängung, eine unrealistisch optimistische Weltsicht (Myers u. Brewin 1994; 1995) sowie ausgeprägte dissoziative Neigungen. In Abhängigkeit von sehr unterschiedlichen traumatischen Situationen und dem Lebensalter bei der traumatischen Erfahrung ergeben sich zahlreiche „vorzeitig beendete“ Verläufe und entsprechende Varianten des traumatischen Prozesses, den wir im Folgenden Abschnitt näher untersuchen werden.
Chronisches Fortbestehen der traumatischen Reaktion (C) ist vor allem nach Extremtraumatisierung zu beobachten und entspricht dem chronischen und dem → komplexen PTBS.
2.4 Anpassung an das Trauma: Strukturveränderungen im traumatischen Prozess
Konnte die traumatische Erfahrung in der post-expositorischen Phase nur ungenügend verarbeitet werden, so bleibt sie als undifferenzierter Erinnerungskomplex im → Traumaschema erhalten mit der ständigen Gefahr, einen unkontrollierbaren Erlebniszustand mit überwältigenden Gefühlen und erneuter Traumatisierung heraufzubeschwören. Sind die bewussten, vorbewussten und unbewussten Kontrollen der Persönlichkeitsorganisation zu schwach bzw. zu inflexibel, um die Überflutung durch die traumatische Erinnerung eindämmen zu können, so entsteht das Bild eines chronischen PTBS.
Bei zumindest zeitweiser kompensatorischer Kontrolle des intrusiven Erlebniszustands kann in Situationen, die an die traumatische Erfahrung erinnern, gleichwohl das PTBS mit offenem Symptombild wiederaufleben. Die dritte Möglichkeit, die wir im Folgenden näher betrachten wollen, besteht darin, mit der Zeit den traumatischen Erfahrungskomplex so unter Kontrolle zu bringen, dass kein florides Symptombild und insbesondere keine überfluteten Erlebniszustände mehr auftreten. Hier hat das psychische System eine Leistung vollbracht, die wir auch aus der somatischen Traumatologie kennen: die „Einkapselung“ oder → Sequestrierung des eingedrungenen Fremdkörpers. Um den gefährlichen Erlebniskomplex unter Kontrolle zu halten, können allerdings umfangreiche „Umbaumaßnahmen“ der seelischen Struktur notwendig werden mit weit reichender Reorganisation von Beziehungsschemata und kognitiv-affektiven Wissensbeständen. Im traumatischen Prozess dient diese Reorganisation primär dem Ziel, das Traumaschema, welches die unerträglichen und subjektiv oft verzerrten Erinnerungen speichert, einzukapseln und „Schadensbegrenzung“ zu betreiben.
Das Traumaschema und der zugeordnete traumatische Erlebniszustand sind durch den Teufelskreis überschießender Emotionen bei gleichzeitiger Schwäche der kognitiven Verarbeitungsmöglichkeiten bestimmt. Es ist in Phase II des Verlaufsmodells während der postexpositorischen traumatischen Reaktion weitgehend unzugänglich geblieben. Gleichwohl entwickelt die Persönlichkeit Hypothesen darüber, wie es zur Traumatisierung kam und was getan werden müsste, um eine Wiederholung oder anderweitige Traumatisierung zu vermeiden. Es werden also Konsequenzen aus der traumatischen Erfahrung gezogen und kompensatorische Gegenmaßnahmen entworfen, die der Kontrolle des Schreckens dienen und zukünftige Wiederholung vermeiden sollen. Diesen Gegenentwurf in seiner systematisch ausgearbeiteten Form bezeichnen wir terminologisch als → traumakompensatorisches Schema. Es beruht auf einer „naiven Traumatheorie“, die bei Kindern z. B. durch die jeweilige kognitive Entwicklungsstufe mitbestimmt ist, aber auch durch Zufälligkeiten der traumatischen Situation. Oft führt die Erinnerungsverzerrung dazu, dass situative Umstände, die nur zufällig zur traumatischen Situation gehörten als deren genuiner Bestandteil oder auch als kausale Faktoren fehlinterpretiert werden. Je ungenauer die situative Konstellation erinnert und begriffen werden konnte, desto umfassender erscheint die Bedrohung und desto allgemeiner, abstrakter und ungenauer arbeitet dementsprechend auch das traumakompensatorische Schema.
Bestimmten Entwicklungsphasen entsprechende „naive Traumatheorien“ können im traumatischen Prozess eine ähnliche Bedeutung erlangen wie die von Freud untersuchten Theorien der kindlichen Sexualforschung (Freud 1905). Freud stellte bekanntlich fest, dass manche Kinder sehr eigenwillige Theorien über die Herkunft der Babies und das menschliche Geschlechtsleben entwickeln. Diese privaten Konstrukte sind in der Pathogenese neurotischer Störungen wirksam. In vergleichbarer Weise liegen dem traumatischen Verarbeitungsprozess → unbewusst mehr oder weniger illusionäre traumakompensatorische Konstrukte und Theorien zugrunde.
2.4.1 Struktur und Dynamik des traumatischen Prozesses
Das kompensatorische Schema entwirft ein Gegenbild oder Gegenmodell, wie der oder die Betroffene hätte sein bzw. sich verhalten müssen, um das ursprüngliche Trauma zu vermeiden bzw. vergleichbare traumatische Erfahrungen für die Zukunft auszuschließen. In diesen Gegenentwurf gehen Annahmen darüber ein, wie sich das Trauma in der Vergangenheit hätte vermeiden lassen, eine Art von retrospektiver Präventionstheorie. Wir bezeichnen diesen Teil des Traumaschemas als seinen ätiologischen Aspekt. Bei misshandelten Kindern z. B., die sich selbst die Schuld an der Misshandlung zuschreiben, kann die „naiv-traumatheoretische“ Erklärung lauten: „Wäre ich braver gewesen, hätte mehr auf die Eltern gehört, so hätten sie mich nicht geschlagen.“
Das kompensatorische Schema entwirft also ein liebes, braves, gehorsames Kind, das stets den Eltern folgt oder später den Geboten der Obrigkeit. So bietet das kompensatorisch entworfene Beziehungsschema (gehorsames Kind, das den Schutz gerechter und fürsorglicher Eltern genießt) eine scheinbare Sicherheit gegen die Wiederholung der traumatischen Erfahrung, eine Funktion des Schemas, die wir als seinen präventiven Aspekt bezeichnen. Dieser wird oft gleichzeitig zur Abwehr gegen die traumatische Erinnerung verwandt.
Das kompensatorische Schema überarbeitet vor allem die unterschiedlichen Momente und Komponenten des „zentralen traumatischen Situationsthemas“, oft im Sinne einer kompensatorischen Verkehrung von Subjekt- oder Objektqualitäten. Das Subjekt identifiziert sich illusionär mit dem Objekt und hat so teil an dessen Macht und Stärke, während Qualitäten des unterlegenen, des schwachen und verachteten eigenen Selbst vom zentralen → Ich-Selbst-System abgespalten werden. Die von Anna Freud (1963) beschriebene Umkehr von Passivität in Aktivität ist ein häufiger Bestandteil kompensatorischer Schematisierung des Traumaerlebnisses. Das kompensatorische (Beziehungs-) Schema entwirft einen Erlebniszustand, der auf einer Wunschvorstellung beruht. Manchmal dient diese Wunschvorstellung der Verleugnung von Traumata im Allgemeinen. Vor allem jene → Erlebniszustände oder Stimmungslagen, die mit dem Traumaschema korrespondieren und dem traumatischen Erfahrungskomplex nahestehen, werden im kompensatorischen Schema so überarbeitet und verändert, dass sie zumindest einige Komponenten des Wunschzustandes realisieren. Daher besteht eine dynamische Spannung und ein zentraler Konflikt im traumatischen Prozess zwischen den Operationen von Traumaschema und traumakompensatorischem Schema bzw. kompensatorischen Teilschemata.
Das kompensatorische Schema richtet sich gegen psychische Strukturen, die traumatische Erfahrungskonstellationen im Gedächtnis festhalten. Dabei ist neben dem Traumaschema noch eine andere Konfiguration von Bedeutung, welche an die resignative Stimmung von Hilf- und Hoffnungslosigkeit anknüpft, die ein Moment der traumatischen Erfahrung ist. Trauma besteht u. a. in der Erfahrung einer radikalen, unerträglichen Desillusionierung. An diese resignative Stimmung knüpft eine psychische Organisation an, die wir als → Desillusionierungsschema bezeichnen. Dieses repräsentiert den Aspekt der traumatischen Desillusionierung in der überdauernden Persönlichkeitsorganisation. Das → Desillusionierungsschema hält die erschütterten Annahmen des Selbst- und Weltverständnisses in negativer Weise fest und führt zu einer Art „negativer Ontologie“: „die Welt ist unzuverlässig und betrügerisch; du selbst bist unfähig, dich zu wehren; du bist schuld an allem Unglück, das dich trifft usf.“ – dies selbstverständlich auf das konkrete Erleben der traumatischen Situation abgestimmt.
Das Desillusionierungsschema mit seiner Ontologie der traumatischen Erfahrung erzeugt zahlreiche der irrationalen Überzeugungen („irrational beliefs“), die kognitive Verhaltenstherapeuten wie Beck oder Ellis erfassen und kognitiv „restrukturieren“. Im Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung ist entscheidend, die Genese des Desillusionierungsschemas aus der individuellen traumatischen Erfahrung und dem Traumaschema abzuleiten und sein Zusammenspiel mit dem traumakompensatorischen Schema und seinen mentalen Produkten zu verstehen.
Wie das kompensatorische Schema, der Gegenentwurf zur traumatischen Erfahrung, beruht auch das Desillusionierungsschema auf unvollständiger oder verzerrter Information über die traumatischen Ereignisse. Dieses Moment an „Irrationalität“ hat zum Konzept der „irrational beliefs“, der irrationalen Überzeugungen beigetragen. Die Erschütterung unseres Selbst- und Weltverständnisses, die das Trauma bewirkt, ist aber als solche keineswegs „irrational“, auch wenn dies für einen außenstehenden Beobachter manchmal so erscheinen mag. „Irrational“, wirklich unfassbar ist dagegen primär die traumatische Situation und die traumatische Erfahrung selbst. In ihren psychischen Bewältigungsversuchen verhält sich die traumatisierte Persönlichkeit hingegen so rational und zweckdienlich wie unter den gegebenen Umständen möglich. Sowohl für die psychotraumatologische Forschung wie die therapeutische Praxis ist es daher sehr wichtig, das rationale Moment in den „irrational beliefs“ zu erkennen und dieses der Klientin oder Patientin auch verständlich zu machen. Nur unter dieser Voraussetzung kann sie sich die traumatische Erfahrung wirklich aneignen und in ihr Selbst- und Weltverständnis integrieren.
Zwischen der Operation von Traumaschema und traumakompensatorischen Maßnahmen besteht im traumatischen Prozess ein labiles, dynamisches Gleichgewicht nach Art jener Balance, die im dynamischen Modell der Psychoanalyse zwischen Impuls und Abwehr besteht. Freud hat bekanntlich das neurotische Symptom als eine Kompromissbildung zwischen (→ Trieb) Wunsch und Abwehr beschrieben. In vergleichbarer Weise kann ein Gleichgewicht im traumatischen Prozess dadurch hergestellt werden, dass ein Darstellungs- oder Handlungsfeld eröffnet wird, worin Aspekte des Traumaschemas und der kompensatorischen Maßnahmen gleichermaßen zum Ausdruck kommen. Da das Ziel der Symptombildung auch hier in der Kontrolle der traumatischen Erfahrung besteht, bezeichnen wir diese Konstellation als → minimales kontrolliertes Darstellungs- oder Handlungsfeld. Es entsteht aus dem dynamischen Kompromiss zwischen dem Traumaschema und den traumakompensatorischen Maßnahmen der Persönlichkeit.
Das Konzept kann als Heuristik zum Studium von Symptombildung und Krankheitserscheinungen dienen. Im Symptom manifestiert sich einerseits die traumatische Erfahrung mit ihrem überwältigenden Affekt und den unterbrochenen Handlungsansätzen, die dem Traumaschema entsprechen. Andererseits wird ein Darstellungs- und Handlungsfeld für die unbewältigte Erfahrung gewählt, auf dem die betroffene Persönlichkeit die verlorene Kontrolle über ihr Erleben und Verhalten relativ gut wiederherstellen kann.
Wird z. B. bei der Magersucht das Essverhalten als Darstellungsfeld eines Beziehungstraumas gewählt, so kann über die Kontrolle der Nahrungsaufnahme eine minimale, zumindest symbolische Kontrolle auch über die traumatische Erfahrung erreicht werden.
Ist das Desillusionierungsschema stark ausgeprägt, so kann es, wie bei Psychosen, zu einer mehr oder weniger umfassenden Abwendung von der Realität und/oder zu deren Entstellung kommen. Bei Zwangsstörungen wird die Kontrolle des Traumaschemas auf der Verhaltensebene gesucht.
Die „Wahl“ des Symptoms ist, ähnlich wie Freud es für das neurotische Symptom beschrieben hat, mehrfach determiniert. Sie ist einerseits durch das Traumaschema und damit auch durch die konkreten historischen Gegebenheiten der traumatischen Situation bestimmt, andererseits durch die Ressourcen der Persönlichkeit, ihr Kontrollpotential und das individuelle Sicherheitsgefühl. Ähnlich wie beim repetitiven Spiel traumatisierter Kinder wird die traumatische Erfahrung in überschaubarer Form wiederholt und so unter Kontrolle gehalten. Voraussetzung dafür ist, dass ein „Feld“ gefunden wird, das beiden Tendenzen gleichermaßen Raum verschafft: der im Traumaschema gespeicherten traumatischen Erfahrung auf der einen und den Sicherheit versprechenden kompensatorischen Maßnahmen auf der anderen Seite.
Terminologisch können wir unterscheiden zwischen dem minimalen kontrollierten „Handlungsfeld“, das eher bei einer traumatischen Erschütterung des → pragmatischen Realitätsprinzips gesucht wird und einem „Ausdrucksfeld“, das eher zur Restitution des kommunikativen Realitätsprinzips benötigt wird. Psychosomatische Störungen vom Typ der „Ausdruckskrankheit“ (im Sinne von Uexkülls) können, so weit in der Ätiologie und Pathogenese traumatische Erfahrungen beteiligt sind, nach dieser Heuristik erforscht werden.
Eine graphische Darstellung der Traumadynamik als vektorielles System gegenläufiger Kräfte mit dem Symptom als Schwerpunkt des Systems (Diagonale im Kräfteparallelogramm) wird in Abschnitt 4.5.1 an einem Fallbeispiel erläutert.
2.4.2 Idiographische Untersuchung traumatischer Prozessverläufe
Traumatische Situation, Reaktion und Prozess mit ihrem Zusammenspiel von Traumaschema und kompensatorischen Maßnahmen können einmal interindividuell vergleichend untersucht werden in der Absicht, allgemeine Gesetzmäßigkeiten der Traumaverarbeitung festzustellen (sog. nomothetischer Ansatz). Das genaue Zusammenwirken dieser Komponenten aber muss zunächst → idiographisch erforscht werden, im minutiösen Studium von Einzelfällen und Einzelschicksalen. Für das Studium von Behandlungsverläufen traumatisierter Patientinnen und Patienten eignet sich ein idiographisches Untersuchungsverfahren, das sog. „Dialektische Veränderungsmodell“ für Psychoanalyse und Psychotherapie (Fischer 1989; 1996). Auch ein Manual zu diesem Verfahren ist publiziert (Fischer 1998), welches auch Anweisungen zur Analyse traumatischer Prozesse und ihrer therapeutischen Beeinflussung enthält.
Im Folgenden sollen die bisherigen Überlegungen zur Dynamik des traumatischen Prozesses an der psychoanalytischen Behandlung eines 30-jährigen Pädagogikstudenten, Herrn P. verdeutlicht werden. Unsere Ausführungen zu „Kontrolloperatio-nen und Strukturveränderung im traumatischen Prozess“ in Abschnitt 2.4.3 schließen sich ebenfalls an dieses Fallbeispiel an. Eine ausführliche Darstellung des Falls und des Behandlungsverlaufes findet sich in Fischer (1996b, 145 ff.) Hier werden nur die wichtigsten Informationen wiedergegeben.
Zwischen dem 17. und 24. Lebensjahr war Herr P. schwer alkoholabhängig gewesen, hatte dann eine Entziehungskur gemacht, war seither trocken, ohne dass sich allerdings die Persönlichkeitsstörung, die ihn zum Alkohol geführt hatte, verändert hätte. Mit 24 Jahren hatte er einen schweren Suizidversuch unternommen. Er hatte sich mit Medikamenten vergiftet und war von seiner Mutter in „letzter Minute“ gefunden worden. Die lebensgeschichtliche Rekonstruktion, die im Laufe der Analyse möglich wurde, ergab u. a. ein mehrgenerationales Trennungs- und Verlusttrauma. Die Mutter von Herrn P. hatte ihre Mutter im Alter von 3 Jahren durch Tod verloren, dies also zu einer Zeit, als sich das kleine Mädchen in einer ersten Ablösungs- und Trennungsphase von der Mutter befand. Der ihr verbleibende Elternteil, der Vater, hatte den Verlust der Mutter nur ungenügend kompensieren können. „Ersatzmütter“ waren nicht verfügbar gewesen.
Offensichtlich hatte die Mutter Schwierigkeiten, mit den Trennungsbestrebungen ihrer Kinder angemessen umzugehen. Das traumakompensatorische Schema, das sie in Reaktion auf den Elternverlust entwickelt hatte, war anscheinend, Trennungen und Trennungsbestrebungen nach Möglichkeit überhaupt zu vermeiden oder zu unterbinden. „Trennung von der Mutter und Selbständigwerden bedeutet ,den Tod‘“ – diese „traumapräventive Botschaft“ schien sie den Kindern unbewusst übermittelt zu haben. Nicht nur der Sohn hatte Selbständigkeitsbestrebungen mit Suizid und jenem „Suizid auf Raten“ beantwortet, den der Alkoholismus bedeutet. Auch eine Schwester des Patienten hatte einen Selbsttötungsversuch unternommen, nachdem sie bei ihrer Hochzeit in eine nahegelegene Stadt umgezogen war.
Die enge, autonomieverneinende Mutterbindung hatte für Herrn P. im Laufe der Zeit das Ausmaß eines Beziehungstraumas angenommen. Das „zentrale traumatische Situationsthema“ war das Erlebnis, in einer Abhängigkeitsbeziehung gewissermaßen gefangen zu sein, die gleichwohl intern unbefriedigend, frustrierend und bevormundend verläuft. Die Wut, die hier mit der Zeit entsteht, kann sich nicht in den normalen altersgemäßen Trennungsbestrebungen äußern, die einer entwicklungsfördernden Form der Aggressivität bedürfen. Sie richtete sich entweder explosionsartig gegen das eigene Selbst, wenn es Trennungsbestrebungen spürte („Trennung bedeutet Tod“) oder gegen das Bindungsobjekt, die Repräsentanz der Mutter, wenn die Wut über die negative Bindung, die Herr P. als ständige Bevormundung empfunden hatte, überwog. Ein symbiotisch verengtes negatives Beziehungsschema zwischen Partnern, die sich nicht wirklich trennen, aber auch nicht wirklich zusammen sein können, stand so im Zentrum der traumatischen Erfahrung.
Das kompensatorische Gegenschema, der Gegenentwurf, den Herr P. im Laufe seines Lebens ausgearbeitet hatte, war ganz im Gegenteil auf Bindungslosigkeit und „freie Wanderschaft“ hin ausgerichtet. Aus diesem Gegeneinander von traumatischem Beziehungsschema und kompensatorischem Gegenentwurf resultierte nun ein in sich gebrochenes und widersprüchliches Beziehungsscript, das Herr P. u.a. mit häufig wechselnden Partnerinnen inszenierte. Nach den anfänglichen „Flitterwochen“ der Beziehung stellte sich sehr rasch der unerträgliche „Beziehungsclinch“ (so Herr P.) des symbiotisch verengten Traumaschemas ein. Herr P. protestierte jetzt so heftig und ausgiebig gegen die angebliche Bevormundung durch seine jeweilige Partnerin, bis diese von sich aus die Beziehung beendete und ihn „wegschickte“. Den Schritt, von sich aus eine Beziehung aufzugeben, hatte er hingegen noch niemals gewagt, da das jene Ängste des Traumaschemas mobilisiert hätte, die durch seine äußeren Beziehungsarrangements unter Kontrolle gehalten wurden. Das dynamische Gegeneinander von Traumaschema und kompensatorischem Schema hatte also zu einem aufgespaltenen Beziehungsmuster geführt: Entweder unter der erstickenden Nähe einer entmündigenden Beziehung leiden oder durch passiven Trotz eine Trennung herbeiführen zu müssen.
Die wichtigsten Erlebniszustände oder Stimmungslagen einer Persönlichkeit bilden sich im traumatischen Prozess durch das Gegenspiel von Traumaschema (und seiner Verallgemeinerung im Desillusionierungsschema) einerseits und dem kompensatorischen Schema andererseits heraus. Auf Grundlage dieser dynamischen Balance entwickeln sich mit der Zeit verschiedene persönlichkeitstypische Erlebniszustände oder Stimmungslagen, die stichwortartig benannt und mit Ziffern versehen werden können, hier mit den Zahlen 1 bis 7. Diese Erlebniszustände lassen sich ihrem inneren Zusammenhang nach zu einem Systemdiagramm anordnen, wie in Abbildung 6.

Erklärung: Erlebniszustände von Herrn P., wie sie sich im Laufe des traumatischen Prozesses herausgebildet haben (Zustand vor Analysebeginn). Das Diagramm stellt die Übergänge zwischen den verschiedenen Erlebniszuständen, ihr gegenseitiges Zusammenspiel dar.
Abbildung 6: Stimmungs- und Erlebniszustände bei Herrn P.
Im traumatischen Prozess entsteht ein engmaschiger Zusammenhang der Erlebniszustände untereinander, der kaum noch Freiheitsgrade zulässt, so dass die Betroffenen sich in einem relativ geschlossenen System ihrer Erlebens- und Verhaltensmöglichkeiten bewegen. Die Spannung im System, gewissermaßen das dynamische Gefälle, kommt zwischen den Erlebniszuständen 6 und 7 zustande. Zustand 6 ist in diesem Diagramm der Ideal- oder Wunschzustand, der dem traumakompensatorischen Schema entspricht. Hier entwirft sich Herr P. als „männlich, selbstsicher und beziehungsfähig“. Dem Idealzustand am schärfsten entgegengesetzt ist der „Horrorzustand“ 7 „verzweifelt, selbstverachtend, grau in grau“, der dem Traumaschema in seiner intrusiven Modalität entspringt. Hier besteht die Gefahr, dass Herr P. von den negativen Affekten überschwemmt wird und Aggression und Hass, die im symbiotisch beengten Beziehungsschema gebunden und aufgestaut sind, sich gegen die eigene Person kehren, wie lebensgeschichtlich in seinem Suizidversuch.
Die Kontrolloperationen, die dem System der Erlebniszustände insgesamt zugrunde liegen und dessen dynamische Balance sichern, wie auch die Kontrolloperationen innerhalb der einzelnen Erlebniszustände, sind darauf gerichtet, den gefürchteten Zustand 7 zu vermeiden und sich dem Idealzustand 6 anzunähern.
Die „traumaätiologische Theorie“ im kompensatorischen Schema könnte in Form eines inneren Dialogs etwa so lauten: „Die überstarke Abhängigkeit von deiner Mutter und der ständige Clinch mit ihr hat dich in Verzweiflung und Selbstverachtung immer weiter hineingetrieben.“ Aus der Ätiologie folgt die präventive Komponente des Schemas, etwa so: „Bemühe dich also, unter allen Umständen Beziehungen zu vermeiden, die auch nur im Geringsten an dieses traumatische Beziehungsmuster erinnern. Nur so kannst du dein Ziel erreichen, männlich und selbstsicher zu sein.“
Dieser zur traumatischen Erfahrung kompensatorisch ausgleichende Gegenentwurf wird nun in den einzelnen Erlebniszuständen in spezifischer Weise umgesetzt. Zum besseren Verständnis dieser subtilen regulativen Kognitionen geben wir im Folgenden eine ausführlichere Beschreibung der Erlebniszustände, wie sie sich aus einer „Konfigurationsanalyse“ nach Horowitz (1979) bei Herrn P. ergeben (zum Verfahren vgl. Fischer 1996, 183-184).