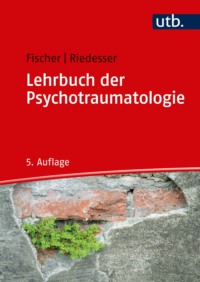Kitabı oku: «Lehrbuch der Psychotraumatologie», sayfa 2
Mit Donovan sind auch wir der Meinung, dass das „Stress“-Konzept, so große Verdienste es in Psychologie, Psychosomatik und innerer Medizin hat, nicht ausreicht, um das zu bezeichnen, was speziell den Gegenstand einer psychosozialen und psychosomatischen Traumatologie bildet: die Störung bzw. Zerstörung psychischer Strukturen und Funktionen, die in gewissem Sinne analog zu jenen Zerstörungen gesehen werden kann, mit denen sich die chirurgische Traumatologie befasst. Handelt es sich beim Vergleich von körperlichen und seelischen Verletzungen nur um ein Wortspiel, allenfalls eine Metapher? Oder können wir von strukturellen Entsprechungen beider Bereiche ausgehen? Und wenn, wo beginnt und wo endet eine solche Analogie? Mit diesen Fragen werden wir uns im Folgenden Abschnitt befassen.
1.1.1 Psychisches Trauma in einem polyätiologischen Modell
Wir wissen heute, dass psychotraumatische Erfahrungen zu seelischen Folgeschäden führen können, ohne dass zusätzliche Bedingungsfaktoren erforderlich sind. Psychische Traumatisierung ist demnach als eine eigenständige ätiologische (von altgr. = ursächliche) Kategorie der psychologischen Medizin zu betrachten. Darüber hinaus sollten bei Verursachung psychischer Störungen mindestens noch drei weitere typische Einflussgrößen berücksichtigt werden: Übersozialisation (z. B. zu strenge, rigide Erziehung), Untersozialisation (z. B. Verwöhnung oder Vernachlässigung) sowie biologische Faktoren genetisch angeborener, aber auch früh erworbener Art. Abbildung 1 gibt eine Übersicht über ein polyätiologisches Modell, das vier ätiologische Einflusssphären und ihre wechselseitigen Verflechtungen umfasst. Im Folgenden werden die einzelnen Größen und ihr Zusammenspiel diskutiert.
Psychotraumatische Einflüsse. Traumastörungen bilden eine der wenigen nosologischen (von altrg. nosos = Krankheit und logos = Lehre: Lehre von den Krankheitsbildern) Einheiten, deren Verursachung bekannt ist. Aus Forschungen zur Kriegstraumatisierung beispielsweise geht hervor, das PTBS umso eher auftritt, je enger ein Soldat am Zentrum des Kampfgeschehens eingesetzt wird. Allgemein üben Erbfaktoren zwar einen modifizierenden Einfluss aus, es ist bisher aber nicht gelungen, einzelne Gene zu identifizieren (Cornelis 2010). Dem psychotraumatischen Einflussfaktor entspricht nosologisch das Traumaspektrum psychischer Störungen, das über das basale PTBS hinaus die Syndrome der speziellen Psychotraumatologie umfasst sowie dissoziative Störungen, einen Teil der Borderline-Störungen und somatoforme Störungsbilder. Neben einer spezifischen Ätiologie weisen Traumastörungen eine spezifische Pathogenese auf (von altgr. pathos = Krankheit und genesis = Entstehung: Entstehungsverlauf eines Störungsbildes), die sich u. a. aus der Dynamik von Traumaschema und traumakompensatorischem System ergibt.
Übersozialisation. Dieser Einflussfaktor entspricht einem übermäßig strengen, rigiden und einengenden Erziehungsstil. Die Vitalität der Persönlichkeit wird unterdrückt. Triebimpulse und Phantasiesysteme werden durch die rigide Prägeform gewissermaßen „ausgestanzt“. Traditionell konservative Sozialisationsmuster üben hier ihren Einfluss aus, ebenso gibt es modernere, streng leistungsbezogene, aber nicht minder asketische Varianten dieses Sozialisationstyps. Die Pathogenese lässt sich oft nach dem psychodynamischen (Trieb-) Wunsch/Abwehr-Modell beschreiben. Es ließe sich zwar diskutieren, ob und wieweit ein übertrieben strenger und rigider Erziehungsstil im Ganzen als „traumatisch“ bezeichnet werden kann. Jedoch ist von einer Überdehnung des Traumabegriffs abzuraten, da traumatische Ereignisse und Lebensumstände im engeren Sinne unter dieser Voraussetzung ihre Besonderheit verlören und Trauma, ähnlich wie Stress, zu einem „Passepartout“ geriete. Allerdings besteht eine „Schnittmenge“ (A–B) zwischen beiden Bereichen, in die z. B. ein übersozialisativer Erziehungsstil sicher dann hineinreicht, wenn rigide Erziehungsnormen mit brutalen körperlichen Strafen durchgesetzt werden.

Abbildung 1: Polyätiologisches Modell psychischer Störungen (Fischer 2000b, 168). Die ätiologischen Einflussgrößen sind durch vier Kreise veranschaulicht, die bilaterale Schnittmengen aufweisen sowie eine Gesamtschnittmenge im Mittelbereich.
Vom Störungsbild her entsteht unter den genannten Bedingungen die klassische neurotische Persönlichkeit mit ausgeprägter Identität, vertikaler Abwehrorganisation, relativ kohärentem Ich-Selbst-System, die an der übermäßigen Verdrängung vitaler Impulse neurotisch erkranken kann. Es wäre zu untersuchen, wieweit die traditionellen Geschlechtsrollenstereotypen neurotogene Faktoren enthalten, möglicherweise unterschiedlich für beide Geschlechter. Die traditionell von Mädchen erwartete Bravheit, Sittsamkeit, altruistische Hilfsbereitschaft und Unterordnung enthält zweifellos pathogene Elemente aus dieser ätiologischen Einflusssphäre.
Biologisch angeboren und biologisch erworben. Erbgenetische Faktoren verbinden sich mit den übrigen ätiologischen Strömungen in unterschiedlicher Weise, beispielsweise im Sinne der von Freud formulierten „Ergänzungsreihe“ zwischen somatischen und psychischen Einflussgrößen. Die geringste Rolle scheint die genetische Disposition bei psychotraumatischen Situationsfaktoren von mittlerem und hohem Schweregrad zu spielen. Neben den genetisch angeborenen Dispositionen rücken erworbene, gleichwohl physiologisch verankerte Dispositionen neuerdings immer deutlicher ins Blickfeld. Dazu gehören einmal die verschiedenen zentralnervösen, neuromuskulären und neurovegetativen Folgen des Traumas, zum anderen in der Kindheit früh erworbene Veränderungen hormoneller und neuroendokriner Regulationssysteme, z. B. eine Dysregulation des Serotoninhaushalts infolge frühkindlicher Deprivation, die für depressive Erkrankungen im Erwachsenenalter disponiert (vgl. Abschnitt 3.4.1). Bei den erworbenen, traumabedingten physiologischen Dispositionen steht die Forschung erst in den Anfängen.
Untersozialisation. Prototyp sind sog. „verwöhnte“ Kinder, die eine „Laisser-faire“-Erziehung und zu geringe oder auch einseitige normative Strukturierung erfahren. Ein Beispiel sind Eltern, die ihren Kindern immer „Recht geben“, wenn es zu Konflikten mit anderen Kindern oder außerfamiliären Personen oder Instanzen kommt, unabhängig vom realen Konfliktanteil der Kinder. So entsteht ein Mangel an Empathie, Normenverständnis und Verständnis für die fundamentale „Wechselseitigkeit“ (vgl. Fischer 1981) sozialer Beziehungen, die den Kern des kommunikativen Realitätsprinzips (Uexküll u. Wesiack 1988) bildet. Parallel entsteht ein Lerndefizit in Bezug auf soziale Fertigkeiten, die einen wechselseitig befriedigenden Umgang mit anderen Kindern oder außerfamiliären Erwachsenen gewährleisten. Kommen weitere negative Bedingungen hinzu, so kann dieses Sozialisationsmuster in eine dissoziale oder antisoziale Karriere münden. Auch bei diesem Sozialisationstyp können psychotraumatische Faktoren hinzutreten. Sie tragen dann zu einer Verschärfung der Verhaltensdefizite und antisozialen Tendenzen bei. Auch eine erbgenetische Disposition wird diskutiert, welche zu Veränderungen in der Verarbeitung von Angst und Bedrohung und einer veränderten „startle-response“ (= angeborene Schreckreaktion auf ungewöhnliche Umgebungsreize) führt (Patrick 1993, Vaidyanathan 2011, Newman 2010). Daraus resultierende Impulsivität und Schwererreichbarkeit durch Erziehungsmaßnahmen, ist beim „harten Kern“ der antisozialen, soziopathischen Persönlichkeit zu berücksichtigen und kann sich im Sinne einer Interaktion zwischen Erbfaktoren und Umwelteinflüssen aufschaukeln.
Es ist nun aufschlussreich, diese 4 ätiopathogenetischen Muster zu therapeutischen Vorgehensweisen in Beziehung zu setzen, die sich in der Geschichte der Psychotherapie „spontan“ herausgebildet haben. Vereinfachend gesagt, hat die Freudsche Psychoanalyse eine besondere Nähe zu Feld B, die Verhaltenstherapie, schon ihrer historischen Entwicklung aus der Pädagogik nach, zu Feld D, Psychopharmakotherapie und körperbezogene Psychotherapie zu Feld C und Traumatherapie zu Feld A. Insofern bietet die Übersicht zugleich Anhaltspunkte für ein an einer differenziellen Ätiopathogenese orientiertes Vorgehen in der Psychotherapie. Wir kommen in Kapitel 4 darauf zurück. An dieser Stelle kann festgehalten werden:
Psychotraumatologie erforscht und behandelt eine ätiologisch relevante und pathogenetisch spezifische Gruppe von Störungsbildern der psychologischen Medizin. Als weitere ätiologische Einflussgrößen für die Entstehung psychischer Störungen sind Über- und Untersozialisation sowie angeborene oder erworbene biologische Dispositionen zu berücksichtigen.
1.2 Seelische und körperliche Verletzungen: Gemeinsamkeiten und Unterschiede
In einer ersten Arbeitsdefinition können wir psychisches Trauma als seelische Verletzung verstehen (von dem griechischen Wort traûma = Wunde, Verletzung). Wie die verschiedenen somatischen Systeme des Menschen in ihrer Widerstandskraft überfordert werden können, so kann auch das seelische System durch punktuelle oder dauerhafte Belastungen in seinen Bewältigungsmöglichkeiten überfordert und schließlich traumatisiert/verletzt werden. Von dem, was geschieht, wenn eine solche Verletzung eingetreten ist, oder was zur Heilung geschehen sollte, davon handelt eine psychologische und psychosomatische Traumatologie als Lehre von Struktur, Verlauf und Behandlungsmöglichkeiten seelischer Verletzungen und ihrer Folgen. Die Analogie zwischen seelischen und körperlichen Verletzungen ist in einigen umgangssprachlichen Wendungen ausgedrückt, wenn wir etwa sagen: „das hat mich sehr verletzt“ oder „getroffen“ usf. Hier werden bildlich/metaphorisch seelische und körperliche Verletzungen miteinander gleichgesetzt. „Etwas macht mich kaputt, zerreißt mich in Stücke“, oder jemand fühlt sich „gekränkt“ sind weitere Beispiele. Die Metaphern verdeutlichen, dass wir seelische Verletzungen sehr stark vom körperlichen Erleben her interpretieren, dass – wie Freud formuliert hat – das Körper-Ich der Kern auch des psychischen Ich, des seelischen Erlebenszentrums ist.
Es gibt eine zweite Gruppe von umgangssprachlichen Wendungen zur Analogie zwischen körperlichen und seelischen Verletzungen, so etwa: „Zeit heilt alle Wunden“. Hier sind die körperlichen und die seelischen Wunden gleichgesetzt. Wir wissen aus dem Umgang mit körperlichen Erkrankungen/Wunden, dass Heilvorgänge Zeit brauchen. Diese Erfahrung wird auf seelische Verletzungen übertragen. Das Gegenteil stimmt aber auch: Zeit allein heilt nicht alle Wunden, weder die körperlichen noch die seelischen. Vielleicht hat der Organismus eigene, übergreifende Selbstheilungsstrategien entwickelt, die für den körperlichen Bereich ebenso gelten wie für den seelischen. Wahrscheinlich müssen wir die seelischen Verletzungen und deren natürliche Wundheilungsmechanismen mit gleicher Aufmerksamkeit studieren wie die körperlichen. Wir lernen dann unterscheiden nach der Art des verletzten seelischen „Gewebes“, verstehen seelische Vorgänge wie Trauerarbeit oder die verschiedenen Abwehr- und Bewältigungsmechanismen als Selbstheilungsversuche des psychischen Systems und können diese Prozesse gezielt unterstützen bzw. Fehlentwicklungen rechtzeitig erkennen und verhindern. Auf die psychische Traumatologie warten Aufgaben, die nicht geringer sind als in der somatischen Traumatologie und Krankheitslehre.
Gibt es psychische Analogien zur Selbstheilungstendenz des Organismus? Wie versucht der Organismus, schädliche psychische Reize, die seine Abwehr durchbrochen haben, zu eliminieren? Grundsätzlich wäre es nicht verwunderlich, wenn sich bestimmte Selbstheilungsstrategien wie etwa die „Sequestrierung“ als Versuch, einen eingedrungenen Fremdkörper einzukapseln und zu eliminieren, auch auf der psycho-physiologischen Ebene wiederfinden ließen. Ist vielleicht der Trauervorgang einem Eliminierungsprozess analog zu verstehen, wie ihn das Eitern einer Wunde darstellt? Wird – wie in einer psychoanalytischen Metapher – ein Introjekt durch Trauerarbeit aus dem psychischen Organismus gleichsam „ausgeschieden“?
Die Beispiele verdeutlichen vielleicht, dass die Analogie zwischen körperlicher und psychischer Traumatologie durchaus fruchtbar sein kann. Wir müssen allerdings auch auf ihre Grenzen aufmerksam werden. Darauf stoßen wir beispielsweise, wenn wir fragen, weshalb die chirurgische Traumatologie ein wissenschaftliches Fach ist, das auf eine mehrtausendjährige Geschichte zurückblickt, während Psychotraumatologie sich immer noch konstituiert. Wir möchten hierfür eine Erklärungshypothese vorschlagen, die an die sinnliche Gegebenheitsweise körperlicher versus seelischer Verletzungen anknüpft: körperliche Verletzungen kann man sehen und anfassen (behandeln), seelische dagegen nicht. Körperliche haben eine physische Repräsentanz, seelische Verletzungen sind unsichtbar – wenn darum auch nicht weniger real und wirksam als die körperlichen Verletzungen und in letzter Zeit durch Bildgebungsverfahren auch physiologisch nachweisbar.
Nun fällt es den Menschen wohl immer schon leichter, sichtbare Phänomene als wirksam einzuschätzen im Vergleich mit unsichtbaren. Möglicherweise ist die Menschheit in ihrer geistesgeschichtlichen Entwicklung noch nicht sehr lange dazu im Stande, auch unsichtbare Größen wissenschaftlich zu erforschen. Piaget (1947) hat in seiner „genetischen Erkenntnistheorie“ gezeigt, dass vor allem der menschliche Egozentrismus verhindert, die eigene psychische Aktivität als solche zu erfassen. Das Kind in den so genannten voroperationalen und frühen operationalen Stadien (bis 7. Lebensjahr etwa) ist auf die Welt der sichtbaren und manipulierbaren Dinge ausgerichtet. Seine Ontologie beschränkt sich auf eine naive Physik. Seelische Phänomene können in dieser Welt nicht erfasst werden. Sichtbar sind die Gegenstände und Handlungen, nicht aber das Sehen selbst. Die Wahrnehmung als solche ist unsichtbar und daher weniger „real“ – für Kinder oder auch für Erwachsene, die auf das konkret-operationale Stadium der kognitiven Entwicklung fixiert sind. Watson, der Begründer des amerikanischen Behaviorismus, hat die Forschungsstrategie propagiert, alle „mentalen“ Begriffe in Verhaltensbegriffe zu überführen. Mit dieser kognitiven Regression hatte der Behaviorismus als herrschende Richtung in der westlichen Psychologie (analog zu der Pawlowschen Variante von „Psychologie“ im Stalinismus) lange Zeit den psychologischen Gegenstand, nämlich das „unsichtbare“ psychische Erlebniszentrum aus der Wissenschaft verbannt. Die seelischen Verletzungen blieben damit ebenfalls unsichtbar. Auch im täglichen Leben begegnen uns viele Menschen, die sich in einem „vorpsychologischen“ Stadium ihrer seelischen Entwicklung befinden. Sie pflegen manchmal heftige Vorurteile gegen die „Psychologie“. Diese sei keine Wissenschaft und könne auch keine werden, da ihr Gegenstand „nicht greifbar“ sei.
Das naive „Alltagsbewusstsein“ ist zumeist auf die Gegenstände der äußeren Wahrnehmung gerichtet und nicht auf seine eigene Tätigkeit des Wahrnehmens, Beurteilens und Denkens selbst. Die Einsicht in die Realität seelischer Verletzungen setzt jedoch die Einsicht in die Realität seelischer Vorgänge, Prozesse und Strukturen voraus. Zu dieser Erkenntnis gelangen wir, wenn wir uns fragen, was ist eigentlich „realer“, der Gegenstand des Denkens oder das Denken selbst? Oder, um ein anderes Thema der allgemeinen Psychologie anzusprechen: was ist „realer“, die Wahrnehmung oder der Wahrnehmungsgegenstand? Hier wird deutlich, dass beides gar nicht voneinander getrennt werden kann. Die Wahrnehmung ist ohne den Wahrnehmungsgegenstand nicht denkbar, aber auch umgekehrt setzt jeder Wahrnehmungsgegenstand als solcher ein Subjekt voraus, das den Wahrnehmungsakt ausführt. Der subjektive Faktor, die Konstitution des Wahrnehmungsgegenstandes im Akt der Wahrnehmung ist aber häufig demjenigen unzugänglich, der in einer „naiv“ empirischen, alltäglichen Einstellung auf die Gegenstände seiner Wahrnehmung und Handlungen ausgerichtet ist und dabei sich als den Handelnden und Wahrnehmenden vergisst.
Diese reibungslose Ausrichtung auf Gegenstände und alltägliche Geschäfte wird nun durch seelische Verletzungen gefährdet. Eine Abwehrstrategie psychischer Traumatisierung besteht im Ignorieren und einer besonders intensiven Zuwendung zu den äußeren Geschäften des Alltagslebens. Das verletzte psychische System/die psychisch verletzte Persönlichkeit sucht die Verletzung nach Möglichkeit auszublenden und betreibt „business as usual“. Dieser Umgang mit psychischen Verletzungen und Kränkungen findet sich bei vielen traumatisierten Persönlichkeiten. Er scheint aber auch charakteristisch zu sein für den Umgang in der täglichen Lebenswelt mit dem Problem seelischer Verletzungen und spiegelt sich in einem „vulgärmaterialistischen“ Wissenschaftsverständnis ebenso wider wie im methodologischen Behaviorismus, einer Forschungsstrategie, die von Erlebnisphänomenen grundsätzlich absehen zu können glaubt. Das psychische Erlebniszentrum als Zentrum zugleich der seelischen Schmerzempfindung wird für unerkennbar, zur „black box“, erklärt. So beruhen auch manche Konzepte der in sich ja sehr heterogenen „wissenschaftlichen Gemeinschaft“ auf Abwehrvorgängen gegen seelische Verletzungen und bedienen sich dabei ähnlicher Abwehrstrategien, wie verletzte Individuen, die sich reflexhaft vor der Wahrnehmung seelischer Schmerzen schützen.
„Unsichtbarkeit“ des Gegenstandes und reflektorische Abwehr erschweren manchen Menschen den Zugang zur Psychotraumatologie als einer Wissenschaft, die speziell die Verletzlichkeit psychologischer und psychosozialer Systeme untersucht. Psychotraumatologie muss aber vor allem gewisse Eigenheiten des seelischen Systems berücksichtigen, die sich auf der Ebene der physikalischen und biologischen Systeme im engeren Sinne noch nicht antreffen lassen. Solche Eigenheiten lassen sich beschreiben mit dem Begriff einer Regel bzw. Norm, die über verschiedene ontologische Ebenen hinweg, von der physiko-chemischen über die biologische bis hin zur psychosozialen, bestimmte Besonderheiten annimmt. Dies wird deutlich, wenn wir als das Gegenstück zu Norm den Begriff des Abnormalen oder Krankhaften verwenden. Krankheit lässt sich als Abweichung definieren von einer Regel oder Norm, die ihrerseits wiederum das gesunde oder normale Funktionieren des Organismus bzw. des Individuums festlegt. Nun deckt dieser Begriff der Regel oder Norm sehr unterschiedliche Phänomene ab, je nachdem wie wir ihn definieren und auf welchen ontologischen Bereich wir ihn anwenden. Tabelle 1 gibt eine Übersicht über Typen von Normen und ordnet sie verschiedenen ontologischen Ebenen zu.
Tabelle 1: Normen und Ebenen der Wirklichkeit

Die einzelnen Elemente von Tabelle 1 wollen wir schrittweise erörtern. Zunächst zur Norm. Dabei unterscheiden wir drei unterschiedliche Normbegriffe: 1. die funktionelle Norm; 2. die statistische Norm; 3. die Idealnorm. Diese Unterscheidung ist in psychosozialen Fächern, wie der medizinischen oder klinischen Psychologie, weitgehend geläufig. Funktionelle oder strukturelle Normen vergleichen einen Ist-Zustand mit einem vorgegebenen Sollwert. Hierzu gehören z. B. die Blutdruckregulierung und viele andere Normwerte der körperlich-biologischen Selbstregulierung. Bei Abweichung von diesen Normwerten, bei einem Blutdruck über 140 zu 90 (systolisch vs. diastolisch), liegt ein Verdacht auf Hypertonie nahe, auf passager oder chronisch erhöhten Blutdruck. Dieser Wert kann ein Alarmsignal sein, das ein Eingreifen verlangt.
Die meisten funktionalen Normen der biologischen Regulationsebene weisen größere interindividuelle Schwankungen auf innerhalb einer noch als „physiologisch“ zu bezeichnenden Schwankungsbreite. Funktionelle Normen beruhen im subatomaren Bereich auf statistischen Normen (2). Die funktionelle Norm setzt aber der statistischen Schwankungsbreite klare Grenzen. Eine Abweichung von diesen Grenzwerten ist dann potenziell pathologisch.
Die Idealnorm (3) dagegen entspricht einer idealen Setzung, die weniger im biologischen und physikalischen, als vielmehr im psychosozialen Phänomenbereich anzutreffen ist. Ein Beispiel dafür sind Normen, Ziele und Verhaltensregeln, die eine Gesellschaft oder soziale Gruppe für ihre Mitglieder definiert bzw. die – handlungstheoretisch betrachtet – sich die Gesellschaftsmitglieder selbst auferlegen. Solche Normen können mehr oder weniger variabel sein. Es gibt ethische Normen, die man gleichsam zur „hardware“ gesellschaftlicher Systeme zählen muss. Man könnte sie als die „funktionale“ Norm einer Gesellschaft bezeichnen. So etwa die „goldene“ ethische Regel: „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu“. Auch Kants kategorischer Imperativ stellt eine Variation dieser Regel dar. Die „funktionalen“ Normen der Gesellschaft sind aber – im Gegensatz zu den biologischen – nicht im genetischen Code verankert, sondern existieren in der Idee einer gerechten Gesellschaftsordnung als ideale Setzung und müssen auf dieser Ebene verwirklicht werden. Andere Vorschriften einer „idealen Norm“ erscheinen als mehr oder weniger willkürliche Setzungen und sind historisch und interkulturell variabel. Ein Beispiel ist der Umgang mit Homosexualität in der abendländischen Geschichte und in unterschiedlichen Kulturen. Während homosexuelle Beziehungen im griechischen Altertum unter gewissen Bedingungen als sozial wertvoll geschätzt wurden, wurde diese Form der Erotik später immer stärker diskriminiert bis hin zur Ermordung zahlreicher Homosexueller durch die Nazis.
Da Idealnormen kulturgebunden sind, kann eine interessante Wechselwirkung mit statistischen Normen entstehen, die sich am Beispiel des Kinsey-Reports zum Sexualverhalten der Nordamerikaner zeigen lässt. Als Kinsey (der übrigens von Haus aus Bienenforscher war) seine Befragung in den USA durchführte, waren in vielen nordamerikanischen Staaten sexuelle Verhaltensweisen, nach denen Kinsey fragte, im Sinne einer „idealen“ normativen Setzung mit strafrechtlichen Sanktionen belegt. Oral-genitale Kontakte (Cunnilingus und Fellatio) wurden in einigen Staaten mit Zuchthaus geahndet. Kinsey fand heraus, dass die überwiegende Mehrheit der Erwachsenen solche Liebestechniken pflegte. Als in der Öffentlichkeit deutlich wurde, dass eine Bevölkerungsmehrheit demnach Zuchthausstrafen verdient hatte, wurden nun umgekehrt rechtliche Bestimmungen, die aus der unreflektierten Übernahme sexualfeindlicher religiöser Normen in das politische System eingegangen waren, mehr und mehr in Frage gestellt. Ideologen des jeweils herrschenden Gesellschaftssystems sind bemüht, ihre Interessen oder magischen Vorstellungen ihre „Idealnormen“ als unveränderliches „Naturgesetz“ hinzustellen und deren Anpassung an reale gesellschaftliche Lebensbedürfnisse zu verhindern.
Bezüglich der verschiedenen Normtypen können wir festhalten: In den funktionellen oder strukturellen Normen wird ein Ist-Zustand verglichen mit einem vorgegebenen Soll-Wert. In der statistischen Norm wird der Ist-Zustand relativ zu einem Messwert bestimmt, zumeist in Abweichungseinheiten vom Mittelwert einer statistischen Verteilung. In dieser Verteilung von Messwerten müssen aber keineswegs Naturgesetze oder funktionale Normwerte zum Ausdruck kommen, ebenso gut können Zufallsphänomene oder gesellschaftliche Setzungen der beobachteten Verteilung zugrunde liegen. Bei der Idealnorm wird der Ist-Zustand verglichen mit einem gewählten Soll-Wert. Hierbei können Vorurteile oder auch rational begründete Idealvorstellungen wirksam sein. Ordnen wir die Normtypen unterschiedlichen Wirklichkeitsebenen zu, wie dies in Tabelle 1, Abschnitt B geschieht, so gelten auf der physiko-chemischen Ebene die so genannten „Naturgesetze“ und entsprechend vor allem die Normen 1 und 2, die funktionelle und statistische Norm jeweils mit vorgegebenem Sollwert. Auf der biologischen Ebene gelten ebenfalls die Normen vom Typ 1 und 2; es kommen jedoch selbstregulative Systemeigenschaften bei vorgegebenem Sollwert hinzu, die sich auf der physiko-chemischen Ebene 1 noch nicht finden. Und schließlich tritt auf der psychosozialen Ebene zu den übrigen noch Regeltyp 3 hinzu, die Fähigkeit zur individuellen oder gesellschaftlichen Setzung von Sollwerten.
Das Verhältnis der Wirklichkeitsebenen zueinander kann nun aufgefasst werden im Sinne der Emergenz (= Auftauchen) neuer Systemqualitäten oder der Supervenienz (= Überlagerung) der nächstniederen durch Systemeigenschaften der nächsthöheren Wirklichkeitsebene. Emergenz betont stärker die Diskontinuität im Übergang zwischen den Ebenen, das Supervenienzkonzept eher die Kontinuität im Wandel. Sucht man z. B. im Sozialverhalten von Tieren nach Vorläufern menschlicher Verhaltensnormen, so trifft man auf eine breite Palette strukturell paralleler angeborener und auch erlernter Verhaltensweisen. Durch die Fähigkeit des Menschen, in Gruppenentscheidungen oder Gesetzgebungsverfahren bewusst überlegte Regeln zu setzen, gewinnen jedoch auch die angeborenen sozialen Verhaltensweisen beim Menschen eine neue Systemqualität. Sie können zu deren gestaltbildenden Prinzipien beispielsweise in Widerspruch treten und dadurch konflikthafte Verhältnisse schaffen, die auf der biologischen Ebene noch nicht möglich waren. Ein Bewertungskriterium stellt die mehr oder weniger gelungene Integration der Ebenen dar. Es gelten auf den höheren immer auch die Regeln und Gesetzmäßigkeiten aller niedrigeren Ebenen. Diese werden jedoch in die neue Systemqualität einbezogen, in ihrer bisherigen Geltung relativiert und können mit dem neuen system- oder „gestaltbildenden“ Prinzip (im Sinne der Gestalttheorie) in ein integratives bzw. mehr oder weniger widersprüchliches Verhältnis treten.
Da der Mensch die Fähigkeit zu einer Wahl von „Sollwerten“ besitzt, entstehen auf der psychosozialen Ebene zwei Varianten von funktionellem Fehlverhalten: die Dysfunktionalität von Mitteln gegenüber gesetzten Zielen und die Dysfunktionalität oder Irrationalität von Zielsetzungen selbst. Im neurotischen → Wiederholungszwang beispielsweise werden oft wohlbegründete und wertvolle Ziele verfolgt, jedoch mit Mitteln und Verhaltensweisen, die systematisch das Gegenteil des bewusst Intendierten bewirken. Auf der anderen Seite gibt es die zweckrationale Verwirklichung noch der irrationalsten Zielsetzungen wie beispielsweise die perfekte Organisation des Holocaust und anderer Genozide. Irrationale Zielsetzungen können in Motiven begründet sein wie bei antisozialem Verhalten und manchen Perversionen, die sich der bewussten Selbstwahrnehmung der Persönlichkeit entziehen. Mit der Zunahme von Möglichkeiten der Handlungsplanung und Entscheidungsfreiheit beim Menschen entsteht zugleich ein neuartiges Spektrum seelischer Störungen und Verletzbarkeiten.
Tabelle 1 beruht auf einer Zuordnungsregel zwischen Normen und Wirklichkeitsebenen, die gewissermaßen von „oben“ nach „unten“ gelesen werden muss. Naturwissenschaftlicher → Reduktionismus (Annahme C) verstößt gegen diese Zuordnungsregel und besteht in der Annahme, dass sich die Systemebenen 3 bzw. 2 ohne Informationsverlust auf die Ebenen 2 bzw. 1 zurückführen oder reduzieren lassen. Ein solcher epistemiologischer Reduktionismus folgt der verbreiteten Tendenz zur Reduktion komplexer Fragestellungen. Eine Form davon ist der sog. „Vulgärmaterialismus“, die Annahme, dass unsere psychische Informationsverarbeitung identisch sei mit den physiko-chemischen Prozessen der Gehirnfunktion (Reduktion von Psychologie auf Physiologie, Biochemie und Biophysik).
Wir wollen jetzt diese Überlegungen zum Aufbau der Wirklichkeit und zur Eigenart jener Regeln, welche die unterschiedlichen Wirklichkeitsebenen beherrschen, kritisch auf die früher erwähnte Analogie von körperlichen und seelischen Verletzungen anwenden. Betrachten wir seelische Verletzungen ausschließlich oder vorwiegend analog zu körperlichen, so entspricht dies einer Kurzführung oder – bild-lich gesprochen – einem „Kurzschluss“ zwischen den Ebenen 3 und 2. Damit würden wir die Eigengesetzlichkeit der Ebene 3 verfehlen. Der Gesichtspunkt andererseits, der Emergenz oder Supervenienz bzw. der einer dialektischen „Integration“ der niedrigen in die höhere Systemebene, berechtigt uns dazu, der Analogie zwischen somatischen und psychischen Verletzungen eine relative Berechtigung zuzuschreiben. Wollen wir allerdings der spezifisch menschlichen Qualität von Verletzbarkeit, der → Psychotraumatologie im engeren Sinne, Rechnung tragen, so müssen wir das spezifisch menschliche Welt- und Selbstverhältnis zentral in unsere Überlegungen einbeziehen. Definitionen und Konzepte, die dieses leisten, sind in der Psychotraumatologie den „organologischen“, körperbezogenen Analogien und Metaphern, so wertvoll diese als Verständnisbrücken auch sein mögen, vorzuziehen. Wir müssen beispielsweise berücksichtigen, dass die Verletzung der menschlichen Fähigkeit zur Selbstbestimmung – ein Konzept der „psychosozialen Ebene“ (3) – eine spezifische traumatische Erlebnisqualität besitzt, die wir auf Ebene 2 möglicherweise noch nicht in gleicher Form antreffen. Eine Frau, die Opfer einer Vergewaltigung wurde, wird nicht nur in den Bereichen der biologischen Selbstregulierung gestört und verletzt, sondern auch und vor allem in ihrem Recht auf und ihrer Fähigkeit zu sexueller Selbstbestimmung. Eine nicht-reduktionistische Definition von Trauma muss daher dem Entfaltungsspielraum der menschlichen Individualität und der menschlichen Fähigkeit zur sozialen Setzung, Einhaltung, aber auch Überschreitung normativer Regelungen Rechnung tragen. Traumatische Ereignisse und Erfahrungen führen beim Menschen zu einer nachhaltigen Erschütterung seines Welt- und Selbstverständnisses (→ Trauma). Die Reorganisation und Restitution von Selbst- und Weltverständnis ist wesentlicher Bestandteil der spezifisch menschlichen Traumaverarbeitung. Dieser Prozess folgt Gesetzmäßigkeiten, die sich bei Tieren nicht identisch beobachten lassen, obgleich traumatogene Situationen im Tiermodell in erstaunlicher Weise den menschlichen gleichen (s. Kap.3.1.2, Situationstypologie im Tierversuch). Organische Metaphern, die nicht in einem Mehr-Ebenen-Modell zugleich auch relativiert werden, besitzen oft eine Pseudoplausibilität und können nähere Verständnisbemühungen vorzeitig abblocken. Fortschritte der Psychotraumatologie sind insbesondere vom Bemühen zu erwarten, die menschliche Perzeption, Beantwortung und Verarbeitung traumatischer Situationen in ihren kognitiven, emotionalen und motivationalen Aspekten immer genauer zu verstehen.