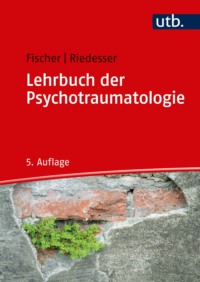Kitabı oku: «Lehrbuch der Psychotraumatologie», sayfa 8
Wir wollen dieses Prinzip der Resituierung unserer Begrifflichkeit am Beispiel des Syndroms der allgemeinen Psychotraumatologie, des bPTBS darstellen. Es stellt eine Abstraktion dar, die für die Beschreibung häufig zu erwartender kurz- und langfristiger Reaktionen auf traumatische Situationen von begrenztem Nutzen ist. Wir dürfen diese Abstraktion jedoch nicht mit der Wirklichkeit erlebender und handelnder Subjekte verwechseln. Diese erleben stets eine bestimmte traumatische Situation in ihrer historischen und individuellen Besonderheit. Die Reaktion auf diese traumatische Erfahrung, der Versuch, die traumatische Situation zu überschreiten, ist immer geprägt durch diese individuelle und historisch spezifische Situationserfahrung. Und nur wenn wir in einer Untersuchung dieser situativen Besonderheit auch gerecht werden, können wir erwarten, die erforderlichen psychotraumatologischen Verständnisrahmen erreicht zu haben. Abstraktionen wie das PTBS können hierbei behilflich sein, sie können aber auch, de-situiert verstanden, die Verständnisbemühungen abschneiden und irreleiten.
Wir kommen hier auf das Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung zurück. Nur in solch einer integrativen Verlaufskonzeption lässt sich verhindern, was traditionell bisher häufig geschehen ist, dass traumatische Reaktionen, die im Situationserleben fundiert sind, von diesem Situationsbezug abgelöst und in eine Eigenschaft der traumatisierten Subjekte umgebogen werden. Weite Bereiche der traditionellen Psychopathologie müssen in der beschriebenen Weise „resituiert“ werden. Nur so lässt sich langfristig entscheiden, welche psychopathologischen Symptome auf traumatische Situationserfahrungen zurückgeführt werden müssen. In diesem Sinne kann die Rückverwandlung von Psychopathologie in Psychotraumatologie als ein programmatisches Ziel verstanden werden.
Wir werden im Folgenden einige Konzepte entwickeln, die bei der Analyse traumatischer Situationen von Nutzen sind. Beide Untersuchungsrichtungen, die objektive und die subjektive, sind zwar aufeinander bezogen, sie sind aber nicht durch einander ersetzbar. Methodisch sollte die objektive Situationsanalyse zeitlich vor der subjektiven erfolgen. Hier fragen wir nach objektiven, potenziell traumatischen Situationsfaktoren. Bei Desastern menschlichen Ursprungs und den oft über lange Zeit sich hinziehenden Beziehungstraumen muss die objektive Situationsanalyse vor allem nach solchen Strukturen und Beziehungsformen suchen, die den offenen Horizont der Situation eliminieren und geschlossene Situationen schaffen. Bei Gewaltverbrechen ist die Ausweglosigkeit offensichtlich gegeben. Bei Beziehungstraumen, etwa vom Typus des → Double-Bind ist dieses Kriterium weniger offensichtlich. Dennoch lassen sich bei eingehender Untersuchung die kommunikativen Mittel rekonstruieren, die eine analoge Auswegslosigkeit erzielen, indem z. B. → Metakommunikation verhindert, Einflussnahme verschleiert wird usf.
Ein häufig eingesetztes Mittel, um eine künstliche Schließung der Situation zu erreichen, ist die Verwirrung kognitiver Kategorien. Wir wollen diesen Mechanismus als → Orientierungstrauma bezeichnen (vgl. Abschnitt 3.1.1). Klassisches Beispiel ist das Double-Bind. Die Verwirrung kognitiver Kategorien im Double-Bind ist bei Fischer (1986a) genauer analysiert im Hinblick auf die Entstehung von Charakterstörungen und selbstschädigendem, parasuizidalem Verhalten. Die → Double-Bind-Situation bildet einen Prototyp des Orientierungstraumas, nicht aber seine einzige Form. In manchen Familien sind Beziehungsmuster mit ihren über Generationen hinweg tradierten Scripts und deren situativer Reinszenierung so verwirrend, dass den Opfern solcher Beziehungsfallen kaum noch wirksame Handlungsmöglichkeiten bleiben. Ziel der objektiven Situationsanalyse ist es hier, die Situationsstrukturen herauszuarbeiten, das zentrale Thema der Situation, die situativen Gegebenheiten, situations- und kulturgesteuerte Scripts, die Kontextbedingungen usf.
Dieser objektiven Untersuchungsrichtung steht die subjektive Situationsanalyse gegenüber. Hier ist zunächst darauf zu achten, welche der objektiv vorhandenen Reaktionsmöglichkeiten ein Individuum tatsächlich wahrnimmt. Von dem Hintergrund der objektiven Situationsstrukturen heben sich jene subjektiven Wahrnehmungs- und Reaktionsweisen ab, mit denen das Subjekt versucht, die potenziell traumatische Situation zu überschreiten. Ergänzen wir hier die objektive Situations- und Script-Analyse durch die subjektive Untersuchungsrichtung, so nähern wir uns dem zentralen Untersuchungsgegenstand, dem Verständnis nämlich für das Zusammenspiel von subjektiven und objektiven Komponenten der traumatischen Situation.
Als Hilfsmittel bieten sich Konzepte an, die wir als Vermittlungsgrößen zwischen dem objektiven und dem subjektiven Moment kennen gelernt haben, wie beispielsweise das „Thema“. Es kann jetzt in seiner objektiven und subjektiven Bedeutung genauer untersucht werden. Nehmen wir das Fallbeispiel des Autofahrers aus Abschnitt 1.4, der durch ein besonders geschicktes Ausweichmanöver einen tödlichen Unfall vermeiden kann, jedoch noch lange nach dem Unfall unter den psychischen Folgen der Traumatisierung leidet. Die traumatogene Situation ist thematisch zunächst dadurch bestimmt, dass Herr R. sich auf einer ganz alltäglichen Autofahrt befindet, um einen seiner Kunden zu besuchen und ihn zu beraten. Mit einer Behinderung in diesem gewohnten Tagesablauf rechnet er nicht. Wie aus dem Nichts kommt durch das Fehlverhalten eines Verkehrsteilnehmers die Todesdrohung auf ihn zu. Wir haben den konkreten Ablauf der Ereignisse ausführlich geschildert. Welches nun sind die für die Traumaverarbeitung entscheidenden Situationselemente? Von der objektiven Seite her mag eine Rolle spielen, dass der Unfallverursacher sich in Panik befand und unfähig war, einem Zusammenstoß auszuweichen, sich hinterher jedoch seinem Retter gegenüber anscheinend in keiner Weise dankbar oder auch nur konziliant verhielt. Beim zeitlichen Verlauf der traumatischen Situation berücksichtigt werden muss auch die mangelnde soziale Anerkennung durch die mit dem Unfall befassten Instanzen, wie beispielsweise die Versicherung des Unfallverursachers.
Wir werden in einem späteren Kapitel das Trauma als eine systematische Diskrepanz zwischen subjektiven und objektiven Situationskomponenten definieren. Hier können wir vorwegnehmen, dass diese Diskrepanz sich in der Interferenz von objektivem und subjektivem Situationsthema am deutlichsten zeigt. Das subjektive Situationsthema ist u. a. dadurch bestimmt, dass Herr R. sich ohne eigenes Zutun und außerhalb seiner Kontrollmöglichkeiten einer Lebensbedrohung ausgesetzt sieht. Er sieht in den kritischen Sekundenbruchteilen seinen Lebensfilm vor Augen, was die Vermutung nahe legt, dass er sich innerlich bereits auf das Lebensende vorbereitete. Vielleicht lag die Möglichkeit des Sterbens seinem bisherigen, sehr aktiven Lebenskonzept besonders fern, was das Diskrepanzerlebnis in der tödlichen Bedrohung noch weiter verschärft haben mag.
Das objektive „Script“, das Drehbuch sozialtypischer Abläufe nach einem lebensbedrohlichen Verkehrsunfall, das die gegenseitige Erwartung der Beteiligten regelt, erfordert den Ausgleich mit dem Unfallgegner, vielleicht die Anerkenntnis von Schuld, primär wohl persönlich-zwischenmenschlich, nicht in erster Linie bestimmt von Versicherungen und deren besonderer Interessenlage. Herr R. erwartet sicherlich mit einiger Berechtigung eine solche Regelung. Sie findet weder persönlich statt noch institutionell. So erlebt er ein scharfes Missverhältnis zwischen den objektiven Situationsfaktoren und seinen persönlichen Erwartungen. Dieses Ergebnis einer Interferenz von objektiven Situationsfaktoren und subjektiven Erwartungen be-zeichnen wir als das „zentrale traumatische Situationsthema“ (ZTST). In diesem Themenkomplex greifen beide Faktorengruppen so ineinander, dass es zu einer → maximalen Interferenz zwischen subjektiven (schematisierten) Erwartungen und objektiven Gegebenheiten kommt, bildlich gesprochen zu einer Blockierung der psychischen Informationsverarbeitung oder auch zu einem Bruch von Strukturen des psychischen Netzwerks.
Das ZTST muss nun zum einen aktualgenetisch, aus dem momentanen Situationsverlauf heraus, erfasst werden, zum anderen in seiner lebensgeschichtlichen Bedeutung und Genese. Aktualgenetisch könnte es bei dem Unfallpatienten etwa so umschrieben werden: „Ich wurde unvorbereitet, durch fremdes Verschulden und ohne eigenes Zutun, aus einem sehr aktiven Leben heraus mit dem Tod konfrontiert. Es gab keine (genügende) Hilfestellung bei meiner inneren Auseinandersetzung mit dem Geschehen. Alle Bemühungen, mein bisher aktives und selbstbestimmtes Leben fortzuführen, scheitern an meiner Krankheit und der Verweigerung von Hilfe“.
Verfolgen wir das ZTST in der lebensgeschichtlichen Richtung weiter, so stoßen wir auf die Kindheitserinnerung an eine Bombennacht während des zweiten Weltkriegs, als Herr M. mit seiner Mutter vor dem Angriff zu fliehen versuchte und dabei auf brennende Häuser, Verwundete und Tote stieß. Auch im „Lebensfilm“ waren die Kriegsszenen an erster Stelle aufgetaucht. Vieles spricht dafür, dass Herr M. mit seinem besonders aktiven Lebensstil bemüht war, dieser früh erfahrenen Unsicherheit und Bedrohung des Lebens seine energische Fürsorge für das materielle Wohl und die Sicherheit der Familie entgegenzusetzen. Genau dieser kompensatorische Lebensentwurf wird durch den Unfall außer Kraft gesetzt. Seine berufliche Tätigkeit, die Sicherheit und Schutz garantieren soll, wird zum Instrument eines grausamen „Schicksals“, das ihn mit einem Schlag in die frühe → Hilflosigkeit und Todesgefahr zurückwirft. Die beruflich bedingte Autofahrt, welche Wohlstand und Sicherheit weiter festigen und so vor der früh erlebten Not des Krieges schützen soll, wird ihrerseits zum Vehikel einer existenziellen Bedrohung. Hier „verhakt“ sich also das auf kompensatorische Sicherheit ausgerichtete „Lebensthema“ in fataler Weise mit dem gegenwärtigen Situationserleben. Das ZTST entspricht diesem Punkt einer maximalen Interferenz von subjektiven und objektiven Situationsfaktoren. Besonders zerstörerisch wirkt es sich aus, wenn durch die oft zufällige situative Konstellation das Subjekt in seinen zentralen kompensatorischen Bemühungen und/oder seinem Weltentwurf getroffen wird. Da diese kompensatorischen Mechanismen oft schon aufgebaut wurden, um früheren (potenziell) traumatischen Situationen zu begegnen, lebt mit dem Bruch des → traumakompensatorischen Schemas und der neuen Bedrohung zugleich die alte Bedrohung wieder auf. In lebensgeschichtlicher Betrachtung bildet das ZTST einen dynamischen Kristallisationspunkt, in dem sich vergangene und gegenwärtige traumatische Erfahrungen verbinden und bisweilen unheilvoll potenzieren können. Die lebensgeschichtliche Kontinuität lässt sich oft auch in der subjektiven Traumaerfahrung feststellen, im Informationsvorrat des → Traumaschemas. So wird im „Lebensfilm“ sogleich die Verbindung zwischen der frühen und der jetzigen Traumaerfahrung hergestellt mit der Erinnerung an die Bombennacht. Das frühe → Schema „assimiliert“ die gegenwärtige Erfahrung, was dem aktuellen Geschehen eine besondere Brisanz verleiht.
Lindy (1993) berichtet von einem Vietnamveteranen, der jahrelang unter einem schweren psychotraumatischen Belastungssyndrom litt. Er war ursprünglich vom positiven Zweck des Krieges überzeugt gewesen und sah seinen Einsatz als Verteidigung von unterdrückten und hilflosen Minoritäten. Der Schutz für Schwache und Hilflose zählt zu der persönlichen Werthaltung, die er sich schon früh in der Lebensgeschichte zu eigen gemacht hatte. Mehrfach wurde er Zeuge von Strafexekutionen in Dörfern von Partisanen.
Eines Tages entdeckte er unter den Exekutierten die Leiche eines vietnamesischen Jungen, mit dem er sich vor einiger Zeit angefreundet hatte. Er wusste, dass der Junge und seine Familie keineswegs „Partisanen“ waren, sondern Sympathisanten der Amerikaner. Dennoch musste er feststellen, dass die Exekution von der amerikanischen Armee durchgeführt worden war. Er verlor den Glauben an die Gerechtigkeit des Krieges, fühlte sich von der Armeeführung getäuscht und musste letztlich auch sich selbst als mitschuldig an der Vernichtung seines jungen Freundes und anderer unschuldiger Zivilisten betrachten. In der späteren Psychotherapie stellte sich die Konfrontation mit der Leiche des befreundeten Jungen als zentrales traumatogenes Erlebnis heraus. Lindy (1993) spricht von „traumaspecific meaning“ und meint damit die subjektive, ganz persönliche Bedeutung, die eine traumatische Situationskonstellation gewinnt. Diese Fallskizze können wir auch in der Begrifflichkeit des ZTST verstehen, wenn wir nämlich annehmen, dass der Schutz von Schwachen und Hilfsbedürftigen eine kompensatorische, ev. sogar traumakompensatorische Funktion für den Veteranen hatte. Jedenfalls war diese Haltung ein zentraler Bestandteil seines Selbstkonzepts gewesen. Sie war auch ein wichtiges Motiv, sich an einem „gerechten“ Krieg zu beteiligen. Nun wurde er selbst zum Mörder seiner Schutzbefohlenen, gerade in Verfolgung seiner durchaus altruistischen Motive. Solch „tragische“ Verwicklungen und eine paradoxe Gegenläufigkeit von Absicht und Handlung entsprechen oft der Struktur des zentralen traumatischen Situationsthemas.
Im Folgenden wollen wir uns mit einem weiteren situationstheoretischen Konzept befassen, das beim Verständnis der traumatischen Situation hilfreich sein kann, der Singularität versus Generalität von Situationen. In der Literatur findet sich häufig die Bemerkung, dass traumatisierte Personen dazu neigen, ihre Erfahrung und damit die traumatische Situation zu stark zu „generalisieren“, also in unangemessener Weise zu verallgemeinern. In der äußerlichen, objektiven Betrachtungsweise trifft diese Beobachtung ganz offensichtlich zu. Manche Traumapatienten verhalten sich so, als könnte die traumatische Situation sich jederzeit wiederholen. Dies geschieht allerdings auf der Ebene unbewusster Informationsverarbeitung. Herr R. z.B. kann deshalb nicht mehr mit dem Auto fahren, weil er auf der Ebene vorbewusster oder unbewusster → Kognitionen und daran gekoppelter physiologischer Reaktionsmuster die ständige Wiederholung des Unfalls erwartet. Es liegt in der Natur der so genannten phobischen Reaktion, dass eine bestimmte Reizkonfiguration übermäßig verallgemeinert und dann übertragen wird auf Situationen, die objektiv, von außen betrachtet in keinem Zusammenhang mit der traumatischen Erfahrung stehen. Für einen außenstehenden Beobachter ist diese Feststellung leicht zu treffen. Wie aber erkennt das betroffene Subjekt selbst den Unterschied zwischen einer Situation der Sicherheit und der Bedrohung? Wo endet der eine Situationstypus, wo beginnt der andere, und welche Kriterien entwickeln Betroffene für eine solche Unterscheidung?
Untersuchen wir diese Frage am Beispiel von Herrn R. Er hat die Erfahrung von hilflosem Ausgeliefertsein an lebensbedrohliche situative Umstände gemacht, sowohl als Kind wie auch später beim Unfall, beides unter unvorhersehbaren Umständen. Wie soll er nun voraussehen können, wann etwas Unvorhergesehenes geschehen kann und wann nicht? Zudem bilden lebensbedrohliche Situationen aus sich heraus einen ganz besonderen Bedeutungshorizont. Das Erlebnis von → Todesnähe führt von sich aus eine andere Form von „Generalisierung“ herbei. Insofern der Tod den Zeithorizont des Individuums begrenzt und „schließt“, ist er die allgemeinste Kategorie. Der Tod ist die Grenze überhaupt. So ist es nicht verwunderlich, dass eine Erfahrung, die der Todesnähe ausgesetzt ist, „grenzenlos“ verallgemeinert wird. Schon unsere alltäglichen Kategorien bilden wir nicht nach dem induktiven Muster eines allmählichen Aufstiegs vom Einzelnen zum Allgemeinen, sondern, wie u. a. Piaget nachgewiesen hat, zielt jedes kognitive Schema auf Allgemeingültigkeit, die durch zusätzliche Erfahrungsprozesse dann differenziert und modifiziert werden kann. So stellt nicht die Verallgemeinerung der traumatischen Erfahrung das erklärungsbedürftige Phänomen dar, sondern umgekehrt deren Differenzierung. In der dialektischen Terminologie von Hegel gesprochen: Situationen werden nicht als zusammenhanglose Einzelheiten aufgefasst, sondern immer als Besonderung allgemeiner Kategorien und Bedeutungen. So kann auch eine generelle Erschütterung von Welt- und Selbstverständnis beim traumatisierten Individuum durch die Erfahrung besonderer traumatischer Situationen bewirkt werden. Traumatische Situationen werden vom erlebenden Subjekt als „repräsentativ“ für zentrale Aspekte des Weltbildes genommen. Sie führen zu einer Erschütterung des Selbst- und Weltverhältnisses in bestimmten Bereichen oder – wenn sie sich der Erfahrung von Todesnähe verbinden – auch insgesamt. Die therapeutische Veränderung kann sich daher nicht einfach darauf beschränken, eine situationsbezogene Übergeneralisierung zu „löschen“. Vielmehr muss der gesamte Welt- und Selbstbezug des Subjekts, von der physiologischen Ebene über die emotionale Erfahrung bis hin zu kognitiven und, wenn man will, „alltagsphilosophischen“ Mustern der Welt- und Selbsterfahrung so umgearbeitet werden, dass die traumatische Situation verständlich wird im Rahmen der allgemeinen Welterfahrung. Dieses kognitive und emotionale Begreifen der traumatischen Situation in ihrer relativen Position zur sozialen Lebenswelt bestimmt den Weg vom „Opfer“ zum „Überlebenden“ einer traumatischen Erfahrung.
Vor allem durch die Todesdrohung und das Erlebnis von Todesnähe gewinnt die traumatische Situation eine Erlebnisqualität, die wir als → exemplarische Situation bezeichnen wollen. Die exemplarische Situation hat Modellcharakter für die Welterfahrung der traumatisierten Persönlichkeit. Viele Gewaltverbrecher, besonders wenn sie bestrebt sind, ihr Opfer auch seelisch zu verletzen, zielen darauf ab, die Situation für das Opfer zu einer exemplarischen zu machen. In einigen Fällen verwenden sie die Todesdrohung, um die besondere Situation für das Opfer zur allgemeinen zu gestalten. Die meisten Vergewaltiger nutzen die Todesdrohung zumindest implizit auch zu diesem Zweck. Ihr Verhalten zielt nicht auf sexuelle Befriedigung ab. Ihre „Befriedigung“ liegt vielmehr im erschütterten Selbst- und Weltverständnis eines Opfers, das dem Angriff hilflos ausgeliefert und gezwungen ist, den Täter als Herrn über Leben und Tod, als „absoluten Herrn“ (Hegel) anzuerkennen. Dass die exemplarische Extremsituation sich im Alltagsleben nicht ständig wiederholt, macht die Erfahrung – subjekttheoretisch gesehen – nicht weniger bedrohlich, sondern steigert manchmal noch ihre Bedrohlichkeit. Manche Psychoanalytiker haben versucht, die exemplarische Situationserfahrung von Traumaopfern durch den Begriff der „Introjektion“ zu erklären (von intro-iacere = nach innen werfen, sich gewissermaßen „reinziehen“). Die traumatische Situation und der Täter bilden demnach ein „Introjekt“ im Seelenleben des Opfers. Hier handelt es sich um einen räumlich-metaphorischen Versuch, Elemente des → Victimisierungssyndroms zu erklären, den Umstand nämlich, dass viele Opfer unbewusst, über lange Zeit, manchmal sogar lebenslang an die traumatische Erfahrung und den Täter gebunden bleiben. Kognitionstheoretisch ist die traumatische Situation für sie zu einer exemplarischen geworden ohne die Möglichkeit einer Differenzierung und Reorganisation von allgemeinen und besonderen situativen Charakteristika.
Die → Dialektik von Besonderem und Allgemeinem ist auch zu berücksichtigen bei der zeitlichen Dimension des Traumatisierungsprozesses. Wann endet eine traumatische Situation? In objektiver Betrachtungsweise fällt die Antwort leicht. Sie ist dann zu Ende, wenn die reale Bedrohung vorüber ist. Dieser objektive Zugang zielt in der → Situationsanalyse jedoch zu kurz. Ein Beispiel dafür ist die Auffassung einiger deutscher Gutachter nach dem zweiten Weltkrieg bei Ausgleichszahlungen an Holocaustopfer. Einige vertraten im Gefolge der deutschen Psychiater Karl Jaspers und Karl Bonhoeffer die Auffassung, dass der Aufenthalt in einem KZ sicher einen Stressor dargestellt habe. Dieser sei aber nach der Entlassung aus dem Lager vorüber gewesen. Wenn bei den Opfern dennoch Schäden zu beobachten seien, so könnten diese eben nicht auf den Stress des KZ-Aufenthalts zurückgehen, sondern auf konstitutionelle, somatische und psychische Schwächen der Opfer (zur beschämenden Geschichte der deutschen Begutachtung von Naziopfern vgl. Pross 1988, 1995). In Wirklichkeit stellte diese rein objektivistische Argumentation eine Retraumatisierung der Opfer dar oder genauer sogar eine Fortsetzung der Traumatisierung i. S. der → sequenziellen Traumatisierung.
Traumatische Situationen enden nicht nach der objektiven Zeit und nicht per se schon dann, wenn das traumatische Ereignis vorüber ist. Unter subjektiven und inter-subjektiven Gesichtspunkten enden sie, vor allem wenn sie von Menschen verursacht werden erst dann, wenn die zerstörte zwischenmenschliche und ethische Beziehung durch Anerkennung von Verursachung und Schuld wiederhergestellt wurde. Exemplarische Situationen enden nicht einfach, wenn Zeit vergeht. Daher heilt Zeit allein nicht alle Wunden. Vielmehr muss eine qualitativ veränderte Situation entstehen, die die traumatischen Bedingungen in sich „aufhebt“, d. h. sie überwindet und einen qualitativ neuen Anfang erlaubt. Bei dieser Auflösung und Überwindung von traumatischen Situationen sind Schuldanerkennung, Wiedergutmachung, aber auch Fragen von Sühne und Strafe von Bedeutung.
Bei politischer Traumatisierung in totalitären Regimen repräsentieren die oppositionellen Kräfte oft die menschlichen Werte innerhalb eines unmenschlichen Systems. Dennoch oder meistens gerade deshalb wurden sie verfolgt und traumatisiert. Hier ist auch objektiv eine repräsentative Situation entstanden, da der Einzelne als Repräsentant der ausgegrenzten Werte misshandelt wurde, nicht aber ursächlich als „individuelle Person“. Entsprechend erfordert Traumaverarbeitung in totalitären Regimen auch nach deren Zusammenbruch eine dialektische Vermittlung von Allgemeinem und Besonderem, worin die Repräsentanten der tyrannischen Herrschaft dahin gelangen müssen, das zugrunde gerichtete Wertsystem in sich und ihren Opfern zu erkennen und anzuerkennen. Eine komplementäre Einsicht besteht darin, dass nicht das Opfer „geschändet“, gedemütigt und oft psychophysisch zerstört wurde, sondern der Täter als „menschliches Wesen“ (Fischer 1996).
2.2 Der Riss zwischen Individuum und Umwelt: Peritraumatische Erfahrung im Modell des „Situationskreises“
Extrembelastungen und seelische Verletzung betreffen das menschliche Weltverhältnis in seiner psychophysischen und psychosozialen Gesamtheit. Wir hatten uns in Abschnitt 1.2 mit der Analogie zwischen körperlichen und seelischen Verletzungen befasst und zum Verständnis ein hierarchisches Modell der physisch-psychosozialen Systemebenen herangezogen (vgl. das Modell der Systemhierarchie, Abb. 2). Das Modell sieht so genannte Aufwärts- und Abwärtseffekte vor. Körperliche Verletzungen haben psychische Auswirkungen und seelische Verletzungen können körperliche Folgen nach sich ziehen. Wir werden uns im Folgenden mit einem Modell befassen, das uns das Zusammenspiel der Systemebenen verständlicher machen kann. Es wurde in seinen Grundzügen in der Biologie entwickelt von Jakob von Uexküll, um die Orientierung der Tiere in ihrer Lebenswelt, gewissermaßen deren Welt- und Situationsverständnis nachvollziehbar zu machen. Thure von Uexküll hat es zu einem Modell der Humanmedizin weiterentwickelt, um Krankheitsverläufe integrativ auf den unterschiedlichen Ebenen psychosozialer und somatischer Phänomene studieren zu können. Er nannte dieses integrierende Konzept vom Zusammenspiel des Menschen mit seiner Umwelt das Modell vom „Situationskreis“. Zusammen mit Wesiack hat von Uexküll dieses Modell fortlaufend weiter ausdifferenziert und für unterschiedliche biologische und psychosoziale Fragestellungen fruchtbar gemacht.
An unsere bisherigen Bemühungen um ein integratives, „synthetisches“ Verständnis der traumatischen Erfahrung schließt dieses Modell auch insofern an, als es ebenfalls mit dem Situationsbegriff arbeitet, der im vorigen Abschnitt als heuristischer Bezugsrahmen für die Traumaanalyse eingeführt wurde. Der Situationsbegriff verpflichtet bei v. Uexküll ebenso wie im phänomenologischen Ansatz zur systematischen Verbindung von Innen- und Außenbetrachtung, von Erleben und Verhalten. Auch biologische Funktionen lassen sich im Modell des Situationskreises (Abb.3) aus der Innenperspektive verstehen. So leistet das Modell einen Beitrag zu einer „subjektiven Biologie“ bzw. „Biologie des Subjekts“, als deren Pionier in Deutschland Jakob von Uexküll genannt werden kann.

Erklärung: Individuum und Umgebungsfaktoren sind zirkulär aufeinander bezogen. Ihre Verbindung wird symbolisiert durch die beiden Teilkreise, von denen der obere die rezeptorische Sphäre, die verschiedenen Sinneswahrnehmungen repräsentiert, der untere die effektorische Sphäre des Organismus, also Handlungen und Handlungsdispositionen.
Abbildung 3: Modell des Situationskreises nach Uexküll und Wesiack (1988)
Jakob von Uexküll hatte die beiden Teilsphären als Merk- und Wirkwelt der Organismen unterschieden. Merk- und Wirkwelt sind durch die organische Ausstattung der Lebewesen vorstrukturiert. Die rezeptorische Sphäre reagiert auf eine bestimmte Problemsituation in der Umgebung. Der Organismus bzw. das Individuum entwickelt eine Lösungsstrategie, die über die effektorische Sphäre günstigenfalls die Ausgangslage erfolgreich verändert, so dass der Kreis zwischen Merken und Wirken geschlossen und die Harmonie, eine wie v. Uexküll und Wesiack schreiben, Beziehung der Synthesis zwischen Organismus bzw. Individuum und Umwelt wieder hergestellt ist.
Im Inneren des Zirkels ist nun eine „kognitive“ Sequenz der Bedeutungszuschreibung eingetragen, in der sich tierisches und menschliches Verhalten von einander unterscheiden. Gemeinsam ist zunächst, dass sowohl Tiere wie Menschen aufgrund von „Bedeutungen“ handeln, die sie ihrer Umgebung zuschreiben. Die Bedeutungszuschreibung oder Bedeutungserteilung verwandelt Umgebung in Umwelt (Lagebestimmungen in situative Gegebenheiten, um an den phänomenologischen Situationsbegriff anzuknüpfen). Durch gelingende Bedeutungserteilung sind die Lebewesen zu effektivem Handeln in der Lage. Beim Menschen hat sich diese → semiotische Zwischensphäre des Umgangs mit Bedeutungen komplex ausdifferenziert. Durch „Probehandeln“ (Freud) im Denken, Durchspielen von Plänen und Handlungsresultaten in der Phantasie hat sich der menschliche Weltbezug im Vergleich zum tierischen vom → „Funktionskreis“ zum „Situationskreis“ erweitert. Während die Tiere mit ihrer Umgebung in einer funktionalen (im Sinne der „funktionalen Norm“), teilweise reflexgesteuerten Verbindung stehen – so wie auch der menschliche Organismus auf der Ebene des vegetativen und animalischen Nervensystems – haben die Fähigkeiten des Menschen im Gebrauch von Zeichen und Symbolen, insbesondere sein Umgang mit Sprache oder sprachähnlichen Zeichensystemen zur Öffnung des Funktionskreises geführt und zu seiner Verwandlung in die vergleichsweise reaktionsoffene Umweltbeziehung des Situationskreises. Die → semiotisch-kognitiven Möglichkeiten verschaffen auch der Individualisierung des Menschen einen größeren Raum. Prozesse der Bedeutungsverarbeitung und -zuschreibung sind stärker als bei den Tieren durch die persönliche Lebensgeschichte und deren individuelle Verarbeitung bestimmt. Wer z. B. Krankheitssymptome oder symptomatische Verhaltensweisen aus der Innenperspektive, dem Situationsverständnis des Patienten heraus verstehen will, muss sich empathisch mit dessen individueller Wirklichkeitskonstruktion befassen, die nur aus seiner besonderen Lebensgeschichte verständlich wird.
Rezeptorische und effektorische Sphäre sind antizipatorisch aufeinander abgestimmt. Die Situationswahrnehmung wird strukturiert durch antizipierte Handlungsmöglichkeiten. Sensorische Rezeption oder Wahrnehmung besteht also nicht in „passiver Reizaufnahme“. Sie ist vielmehr aktiv auswählend und insofern bedeutungserteilend. Die Wahrnehmung ist ihrerseits motiviert durch einen Mangelzustand, der das Gleichgewicht zwischen Individuum und Umwelt vorübergehend stört, so dass eine Problemsituation entsteht. Die semiotische Zwischensphäre von Bedeutungsunterstellung, -erprobung und -erteilung ermöglicht beim Menschen ein intelligentes problemlösendes Handeln, das den Gleichgewichtszustand zwischen Individuum und Umwelt wieder herstellt.
Harmonie oder Synthesis von Organismus und Umwelt wird gewährleistet durch interne Regulationssysteme, die wir mit Piaget als „Schemata“ bezeichnen können. Schemata unterliegen Piaget zufolge einem Regulationsprinzip mit zwei verschiedenen Funktionen, dem Assimilations- und Akkommodationsvorgang. Ist keine Problemsituation vorhanden, so ist das → Schema aktiv, indem es sich die Umgebungskonstellation assimiliert (= sich angleicht oder „anähnelt“), d. h., sie in „Umwelt“ verwandelt. In diesem Falle setzt die Umgebung der Reproduktion des Schemas keinen Widerstand entgegen. Tritt aber eine Problemsituation auf, so muss das Schema so lange umgearbeitet werden, bis das Problem durch effektives Handeln gelöst werden kann. Die Funktion, die das Schema intern reorganisiert, bezeichnen wir mit Piaget als Akkommodation. Ist sie erfolgreich, so kann die Umweltsituation wieder problemlos assimiliert werden. Die Akkommodation führt so zu einer neuen Assimilation, die Anpassung zur gelingenden „Einpassung“ (von Uexküll und Wesiack) des Organismus bzw. des Individuums in seine Umwelt, in eine → „ökologische Nische“.
Der Schemabegriff. Die inneren Strukturen oder Systeme, die im Situationskreis die Feinabstimmung zwischen Individuum und Umwelt leisten, können wir als rezeptorisch-effektorische Schemata bezeichnen, oder auch mit Jean Piaget als sensorisch-motorische Schemata (kurz sensomotorische Schemata). Piaget beruft sich mit diesem Konzept wiederholt auf die biologischen Arbeiten Jacob von Uexkülls. Thure von Uexküll und Wesiack beziehen ihrerseits Piagets Schemakonzept in das Modell vom Situationskreis ein. Auch in der modernen kognitiven Psychologie hat sich das Schemakonzept als ein zentrales heuristisches Instrument zur Untersuchung kognitiver Strukturen und Funktionen bewährt (z. B. Neisser 1967, 1976). Der Kern des Schemakonzepts ist hier – wie auch im Funktions- bzw. Situationskreis – das Zusammenspiel von rezeptorischer und effektorischer Sphäre, von Wahrnehmung und Handlung.