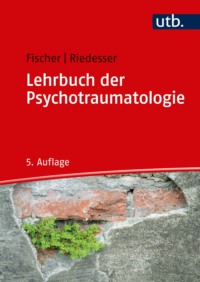Kitabı oku: «Lehrbuch der Psychotraumatologie», sayfa 7
2 Situation, Reaktion, Prozess – ein Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung
Bisher sind einige grundlegende Fragen, wie z. B. nach einer Definition von Trauma zwar angeklungen, aber nicht systematisch behandelt worden. Solche Fragen sind für das Verständnis von psychischer Traumatisierung und eine Wissenschaft Psychotraumatologie natürlich elementar. Manche der Fragen, die wir hier diskutieren, haben eine philosophische Dimension. Wer nicht gewohnt ist, sich mit philosophischen Fragen zu beschäftigen, wird vielleicht befremdet sein, derartige Überlegungen in einem wissenschaftlichen Lehrbuch anzutreffen. Allerdings konfrontiert uns das Trauma selbst mit fundamentalen Fragen der menschlichen Existenz und des Werterlebens. Von daher sollten wir philosophischen Problemen nicht ausweichen, auch wenn der Weg manchmal mühsam ist, uns das, was wir im Alltagsleben wissen, ohne zu wissen, dass wir es wissen, auch explizit vor Augen zu führen. Denn ein solches „Metawissen“(= Wissen über Wissen oder Wissen zweiten Grades) ist das Ziel philosophisch-psychologischer Bemühungen. Es ist aber auch, wie sich noch zeigen wird, eine wesentliche Dimension im Umgang mit dem Trauma.
Eine erste solche Frage stellt sich, wenn wir nach dem Begriff des Traumas fragen. Ist „Trauma“ nun eigentlich ein Ereignis oder ein Erlebnis? Handelt es sich um eine subjektive oder eine objektive Kategorie? Der Terminus „post-traumatische“ Belastungsstörung in den gegenwärtigen Diagnostikmanualen legt nahe, „Trauma“ sei ein Ereignis, das bereits vergangen ist, wenn sich die Symptome der Störung auszubilden beginnen. Nach dem Trauma (= post-traumatisch) bildet sich die Störung aus. Offensichtlich werden hier die Begriffe „Trauma“ und „traumatisches Ereignis“ miteinander vermischt, denn vergangen ist ja streng genommen nur das traumatische Ereignis: eine definitorische Nachlässigkeit, die für eine sich entwickelnde Wissenschaft nicht folgenlos bleibt. Dagegen ist festzuhalten, dass der Begriff Trauma nicht koextensiv mit „traumatischem Ereignis“ zu verstehen ist.
Wenn das Trauma also kein Ereignis ist, also kein „objektiver“, äußerlicher Vorgang, sollte „Trauma“ dann nicht subjektiv definiert werden? Etwa so: Trauma ist ein unerträgliches Erlebnis, das die individuellen Bewältigungsmöglichkeiten überschreitet. Für diesen Definitionsversuch sprechen einige gute Argumente, andere aber auch dagegen. Vor allem die Gefahr subjektiver Willkür und Beliebigkeit, sobald der Bezug des Erlebens auf das Ereignis außer Acht gelassen wird.
Schon die bisherigen Überlegungen machen deutlich, dass in der Psychotraumatologie keine einfachen, eindimensionalen Lösungen existieren nach Art eines weit verbreiteten Entweder-Oder-Denkens. Auf unsere Problemstellung angewandt etwa: Entweder lässt sich das Trauma ganz objektiv definieren (als objektives Ereignis) oder der Traumabegriff wird völlig „unscharf“, da er nur subjektiv ist und damit auch willkürlich verwendet werden kann.
Hier stellt sich die Frage: Liegt die Schwierigkeit nun eigentlich in der Sache selbst oder möglicherweise in unseren Denkgewohnheiten, die zu einfachen Schwarz/Weiß-Lösungen neigen? Wir sind der Meinung, dass letzteres zutrifft. Eine Wissenschaft wie die Psychotraumatologie hat immer zugleich mit Subjektivität und Objektivität zu tun. Wir müssen uns daher bemühen, unsere Denkgewohnheiten der Komplexität des Gegenstandes anzunähern. In der Psychotraumatologie benötigen wir eine Denkweise, die mit Widersprüchen umzugehen versteht, die den Widerspruch zum Beispiel zwischen einem objektiven und subjektiven Traumaverständnis nicht einfach als einen Irrweg oder als „unlogisch“ abtut, sondern ihn ganz im Gegenteil zur Grundlage der Forschung macht. Mit solchen in sich widersprüchlichen Phänomenen ist die Psychotraumatologie nahezu durchgehend befasst. Erforderlich ist daher eine dialektische Denkweise als Grundlage dieser Disziplin, die solchen Widersprüchen gerecht wird.
Wir können festhalten: „Trauma“ muss sowohl objektiv wie auch subjektiv definiert werden. Hieraus ergeben sich bereits einige negative definitorische Bestimmungen, die zur Vermeidung von Irrtümern nützlich sind. „Trauma“ ist keine Qualität, die einem Ereignis inhärent ist noch aber einem Erlebnis als solchem. Entscheidend ist vielmehr die Relation von Ereignis und erlebendem Subjekt. Im Mittelpunkt steht also die Beziehung des Subjekts zum Objekt oder zur „Umwelt“. Dieser ökopsychologische Gesichtspunkt ist für die Traumaforschung zentral, wurde aber und wird in traditionellen Disziplinen wie Klinischer Psychologie, Psychopathologie, Psychiatrie, Kinderpsychiatrie und auch in der Psychoanalyse oft vernachlässigt. So weit → ökologische Ansätze existieren, wie in der Entwicklungspsychologie (etwa Bronfenbrenner 1977) oder in der psychosomatischen Medizin (von Uexküll 1996, vgl. Abschnitt 2.2), wurden sie bisher noch nicht systematisch für die Traumaforschung entwickelt.
Epistemologisch wollen wir unseren Forschungsansatz in der Psychotraumatologie als ökologisch-dialektisch bezeichnen. Der ökologische Gesichtspunkt erfordert, traumatisierende Erfahrungen aus ihrem Umweltbezug, aus der wechselseitigen Beziehung von Person und Umwelt zu verstehen. Der dialektische Gesichtspunkt verdeutlicht hier u. a., dass zwischen Subjektivität und Objektivität, zwischen der „Innenperspektive“ des leidenden Subjekts und der „Außenperspektive“ des objektiven Beobachters ein spannungsreiches und in sich widersprüchliches Verhältnis besteht. Die Pole des Subjektiven und Objektiven können nicht „kurzgeschlossen“ werden, wie dies in einer reinen Erlebens- oder reinen Verhaltenspsychologie geschieht. Trauma ist kein „Stimulus“ oder „Stressor“ und auch keine bloße → „Kognition“. Vielmehr muss das dialektische Spannungsverhältnis zwischen Innen- und Außenperspektive in der Traumaforschung ertragen und produktiv verwendet werden.
Die „traumatische Situation“ ist aus diesem Zusammenspiel von Innen- und Außenperspektive, von traumatischen Umweltbedingungen und subjektiver Bedeutungszuschreibung, von Erleben und Verhalten zu verstehen. Sie bildet die erste Phase unseres heuristischen Verlaufsmodells der psychischen Traumatisierung. Die „Situation“ verstehen wir dabei zugleich als die minimale Beobachtungseinheit, die ohne Verlust entscheidender Verstehensmöglichkeiten nicht unterschritten werden kann. Wer sich nicht in die „Situation“ der Betroffenen hineinversetzt, kann eine traumatische Erfahrung nicht verstehen. Wir werden uns in Abschnitt 2.1 mit dem Begriff der „Situation“ ausführlich befassen, einmal in seinem theoretischen Bezug, wie er in der phänomenologischen Philosophie, Psychologie und Soziologie sowie der psychosomatischen Medizin entwickelt wurde. Eine → Phänomenologie und Typologie traumatischer Situationen ist zugleich aber auch ein praktisches Forschungsziel der Psychotraumatologie als einer angewandten wissenschaftlichen Disziplin.
Traumatische Situationen sind solche, auf die keine subjektiv angemessene Reaktion möglich ist. Sie erfordern dringend, z. T. aus Überlebensgründen eine angemessene und „not-wendige“ Handlung und lassen sie doch nicht zu. Wie reagieren wir auf Situationen, die eine angemessene Reaktion nicht zulassen? Die Paradoxie der traumatischen Situation ist zugleich die der „traumatischen Reaktion“, der zweiten Phase in unserem (ökologisch-dialektischen) Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung. Wie verarbeitet das betroffene Individuum oder die soziale Gruppe eine Situationserfahrung, die ihre subjektive Verarbeitungskapazität oder vielleicht die von uns allen massiv überschreitet? Das ist die leitende Forschungsfrage des Verlaufsmodells in Phase 2, im Hinblick auf die → traumatische Reaktion oder „Notfallreaktion“.
Auch ein dritter Gesichtspunkt schließlich ist in der Paradoxie der → traumatischen Reaktion (Situation) schon enthalten. Er leitet über zum dritten Moment des Verlaufsmodells, dem → traumatischen Prozess. Das Paradoxon der traumatischen Reaktion ist hier gewissermaßen auf Zeit gestellt. In der weiteren Lebensgeschichte, manchmal ein volles Leben lang, bemühen sich die Betroffenen, die überwältigende, physisch oder psychisch existenzbedrohende und oft unverständliche Erfahrung zu begreifen, sie in ihren Lebensentwurf, ihr Selbst- und Weltverständnis zu integrieren; dies in einem Wechselspiel von Zulassen der Erinnerung und kontrollierender Abwehr oder Kompensation, um erneute Panik und Reizüberflutung zu vermeiden. Auch hier ist die → Dialektik von Innen- und Außenperspektive für die psychotraumatologische Forschung grundlegend. Von der Außenperspektive des unbeteiligten Beobachters aus lässt sich die Zerstörung unseres Selbst- und Weltverständnisses, welche traumatische Erfahrungen bewirken, oft noch nicht einmal ahnen. Die systematische Erforschung traumatischer Prozesse auf dem Hintergrund von traumatischer Situation und Reaktion ist eines der Ziele unseres heuristischen Modells.
Die Phasen des Modells stehen nicht in einem zeitlichen, sondern in einem dynamischen Verhältnis zueinander. Sie gehen auseinander hervor, laufen parallel und durchdringen einander. Wann ist eine traumatische Situation beendet? Bei Ende der Konfrontation mit dem bedrohlichen Ereignis? Mit der Flucht, dem physischen Überleben? Oder erst mit dem psychischen Überleben, mit der Entwicklung der Betroffenen vom Opfer zum (psychisch) „Überlebenden“ einer traumatischen Situation?
Die Problematik, die das Trauma aufwirft, kann ein Mensch oftmals nicht allein bewältigen. Traumatische Situationen und die Verarbeitungs- und Selbstheilungsversuche der Betroffenen haben wesentlich eine soziale Dimension. Das traumatisierte Individuum ist kein isoliertes Einzelwesen, sondern um einen zunächst paradox klingenden Begriff zu verwenden, ein „individuelles Allgemeines“, d. h. die Besonderung jener allgemeinen menschlichen Möglichkeiten, sozialen Absprachen, Lebensprinzipien und Lebenswerte, an denen wir alle teilhaben, so dass ihre Verletzung letztlich uns alle als eine eigene Möglichkeit betrifft. Im Einzelfall sind von einem Desaster oder einer feindseligen, zerstörerischen Handlung bestimmte Individuen betroffen und andere nicht. Für das Trauma der Betroffenen, ihre traumatische Reaktion, den sich entwickelnden Prozess, den Heilungsverlauf oder weitere traumatische Sequenzen ist nun von wesentlicher Bedeutung, wie sich die Allgemeinheit zum individuellen Elend der Traumatisierten verhält. Unterliegen diese der gesellschaftlichen Verdrängung, Ausgrenzung oder gar Missachtung, weil sie durch ihr Leiden an die „Katastrophe“ erinnern, so ist für sie die traumatische Situation noch keineswegs beendet. Entscheidend ist, ob wir im traumatischen Leid unserer Mitmenschen das „allgemeine menschliche Wesen“ in seiner Besonderung, eventuell in seiner Entstellung und Zerstörung erkennen oder darin nur einen zwar bedauerlichen, statistisch aber durchaus „erwartbaren“ Einzelfall sehen.
Das verantwortliche Sich-Erkennen der Allgemeinheit im besonderen Elend der Opfer, das Bemühen um Hilfe für sie und ihre „Rehabilitation“, die Anerkennung von Gerechtigkeit und Würde ist vor allem bei absichtlich herbeigeführ-ten Desastern für den Traumaverlauf bzw. den Erholungs- und Restitutionspro-zess von großer Bedeutung. Lehnt ein soziales Kollektiv es beispielsweise ab, die Verantwortung zu übernehmen für Gewalttaten oder sonstiges Unrecht ge-gen Außenstehende oder Minoritäten, so untergräbt die verleugnete Schuld die psychische und moralische Substanz der Täter- oder Verursachergruppe oft über Generationen hinweg. Der „traumatische Prozess“ ist also nicht nur ein individueller, sondern stets auch ein sozialer Vorgang, worin die Täter-Opfer-Beziehung bzw. das soziale Netzwerk der Betroffenen und letztlich das soziale Kollektiv einbezogen sind.
Unser (ökologisch-dialektisches) → Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung enthält im Überblick die folgenden Annahmen, die als Heuristik bei der Untersuchung psychotraumatologischer Fragestellungen dienen:
•Die traumatische Erfahrung muss als dynamischer Verlauf untersucht werden. Dieser umfasst die Momente oder Phasen der traumatischen Situation, der traumatogenen Reaktion und des traumatischen Prozesses. Diese Phasen sind intern aufeinander bezogen und gehen dynamisch auseinander hervor.
•Das bewegende Moment des Traumaverlaufs ist die inhärente Paradoxie von existenziell bedrohlichen Handlungssituationen, die jedoch kein adäquates Verhalten zulassen; von Handlungsbemühungen, emotionalen und kognitiven Bewältigungsversuchen, die in sich zum Scheitern verurteilt sind; von Lebensentwürfen, die um den unbewältigten, traumatischen Erfahrungskomplex herum organisiert sind.
•Die traumatische Erfahrung findet im psychoökologischen Bezugssystem des sozialen Netzwerks statt. Dieses umfasst neben den Angehörigen, Freunden und Bekannten der Betroffenen die Täter-Opferbeziehung (bzw. Verursacher-Opferbeziehung) ebenso wie die jeweilige soziale Makrogruppe, in deren Einflusssphäre es zur Traumatisierung kommt.
Situation, Reaktion und Prozess sind in diesem Modell intern aufeinander bezogen, sie bilden drei unterscheidbare Momente einer einzigen dynamischen Verlaufsgestalt. Ein Verstoß gegen die Regeln des Modells ist zum Beispiel die isolierte Untersuchung einzelner Phasen ohne Rücksicht auf diese Verlaufsgestalt.
So hat die traditionelle, vor allem psychiatrische Psychopathologie immer wieder nosologische Einheiten beschrieben und mit personenbezogenen Attributionen versehen, die in Wirklichkeit nur aus der traumatischen Verlaufsgestalt heraus verständlich werden. Heute wissen wir beispielsweise, dass die Lebensgeschichte späterer „Borderline-Patienten“ schwere Kindheitstraumata aufweist, wie physische oder sexuelle Kindesmisshandlung und/oder ein extrem widersprüchliches Erziehungsverhalten. Auch „hysterische“ Patientinnen (zumeist werden Frauen so diagnostiziert) haben oft diesen Hintergrund von Lebenserfahrungen. Betrachtet man Lehrbücher der Psychopathologie, zum Teil auch der Psychoanalyse, so wird das Symptombild überwiegend, wenn nicht gar ausschließlich personbezogen dargestellt, entweder als ein System innerpsychischer Mechanismen oder als erbgenetisch bedingte Dysregulation des psychischen Geschehens. Wir stellen nicht in Frage, dass auch psychobiologische Faktoren an manchen psychopathologischen Erscheinungen beteiligt sind. So weit jedoch psychotraumatische Erfahrungen eine Rolle spielen, sind diese allein aus der dynamischen Verlaufsgestalt von Situation, Reaktion und Prozess heraus zu verstehen, nicht aber aus nur einem dieser Verlaufsmomente, etwa allein aus dem Symptombild, das sich in Phase 3, dem traumatischen Prozess herausbildet.
Unser Verlaufsmodell soll also eine Forschung und therapeutische Praxis anleiten, die am inneren Zusammenhang des Traumaerlebens und der Traumaverarbeitung orientiert ist und kann dabei behilflich sein, traditionelle Fehler und Sackgassen zu vermeiden, die aus einer objektivistischen oder aus einer kontext-isolierend intrapsychistischen Betrachtungsweise entstehen.
Hiermit sind einige theoretische Grundlagen unseres (ökologisch-dialektischen) Verlaufsmodells der psychischen Traumatisierung umrissen. Es bietet ein heuristisches Schema und einen „Erkenntnisalgorithmus“, die im wesentlichen auf der Annahme beruhen, dass sich die dynamische Verlaufsgestalt aus den immanenten Paradoxien und Widersprüchen der traumatischen Erfahrung und dem Versuch der betroffenen Persönlichkeit zur „Aufhebung“ dieser Widersprüche (im dreifachen dialektischen Sinne von tollere, elevare und conservare = auflösen, emporheben, erhalten) verstehen lässt.
Das Verlaufsmodell liegt als generative Struktur auch den weiteren Kapiteln im ersten Teil des Lehrbuchs, der Allgemeinen Psychotraumatologie und der differenziellen zugrunde. Daher geben wir im Folgenden einen Überblick über unsere weiteren Ausführungen zur Allgemeinen Psychotraumatologie auf der Grundlage des Modells und seinen zuvor skizzierten Annahmen.
In Kapitel 2 werden solche Gesichtspunkte behandelt, die sich unmittelbar auf die dynamische Gestalt und die Kernannahmen des Modells beziehen. Wir vertiefen zunächst in Abschnitt 2.1 und 2.2 unser Verständnis von der „traumatischen Situation“. Dabei werden vor allem solche Konzepte berücksichtigt, die ein synthetisches Konzept von Situationen ausgearbeitet haben, wie die phänomenologische Tradition und das Modell des → Situationskreises nach Th. v. Uexküll. Beide Ansätze setzen den „Subjekt- und den Objektpol“ von Situationen zueinander in die Beziehung einer Synthesis. Die traumatische Erfahrung ist demgegenüber u. a. durch eine Aufspaltung und Antithesis dieser beiden Pole bestimmt. Desto interessanter sind als Beschreibungsgrundlage Konzepte, die das „harmonische“, synthetische Zusammenspiel oder ein „Gleichgewicht“ von Subjekt- und Objektpol in alltäglichen Situationen untersuchen. Das phänomenologische Situationsverständnis thematisiert die Alltagserfahrung erwachsener Menschen, dies vor allem in Wahrnehmungsbegriffen. Für das „Situationskreis-Modell“ dagegen ist das Zusammenspiel von Wahrnehmung und Verhalten, von Sensorik und Motorik der Ausgangspunkt. Beide Zugänge können sich ergänzen und uns helfen, traumatische Situationen möglichst differenziert zu erfassen und zu analysieren.
Aufbauend auf diesem Situationsverständnis wird in den Abschnitten 2.3 und 2.4 dann die widersprüchliche, paradoxe Erfahrungswelt beschrieben, welche die traumatische Reaktion und den traumatischen Prozess anstößt. So weit der „synthetische Kernbereich“ des Modells, welcher der dynamischen Verlaufsgestaltung traumatischer Erfahrung Rechnung trägt.
Kapitel 3, die differenzielle Psychotraumatologie, enthält dagegen die analytische (= zerlegende) Darstellung einzelner Teilkomponenten des Modells bzw. der psychischen Traumatisierung. Hier wird die Darstellung vor allem nach einem objektiven, auf Situationsfaktoren und -konstellationen ausgerichteten und einem subjektiven oder genauer subjektorientierten Zugang differenziert. Im objektiven Zugang wird z. B. in Abschnitt 3.1 eine Einteilung der traumatischen Situationsfaktoren nach Intensität, Dauer oder Ereignisdimensionen vorgenommen. Auch Abschnitt 3.1.2 „Situationstypologie im Tierversuch“ ist diesem objektiven Zugang zugeordnet. Hier wird deutlich, dass dieser allerdings immer nur eine erste Annäherung ergibt, denn auch Tierexperimente lassen sich sehr wohl aus der Innenperspektive untersuchen. Wir verstehen das Experiment dann im Bezugsrahmen der artspezifischen Ökologie, als ein vom Versuchsleiter entworfenes Szenario. Nach dieser phänomenologisch- → hermeneutischen Operation der artspezifischen Subjektivierung und Relativierung der Experimentalsituation können eventuelle Analogien zum Menschen gezogen werden.
Primär durch den subjektorientierten Zugang, die Innenperspektive der traumatischen Erfahrungssituation, ist dann wieder Abschnitt 3.2 bestimmt, der subjektive Organisationsstrukturen oder -funktionen behandelt wie Gedächtnis, Abwehr, psychische Instanzen, Kontrollsysteme der Persönlichkeit, die bei der Verarbeitung der traumatischen Erfahrung wirksam sind, durch sie jedoch auch dauerhaft geschädigt werden können. Auch die folgenden Abschnitte, subjektive Disposition, protektive (schützende) Faktoren, der Erlebnisverlauf in traumatischen Situationen, primäre Abwehrreaktion, die Bewältigungs- und Selbstheilungsversuche im traumatischen Prozess entsprechen einem primär subjektbezogenen Zugang zur traumatischen Erfahrung und werden nur aus der Innenperspektive der traumatischen Situation heraus verständlich.
Abschnitt 3.3, Differenzieller Verlauf der traumatischen Reaktion und des traumatischen Prozesses, fasst die bis dahin erarbeiteten Gesichtspunkte zusammen in einer Übersicht über traumatische Verlaufsprozesse. Hieran knüpfen die Forschungsstrategien der Psychotraumatologie an (3.4).
Der synthetische und der analytische Teil der Darstellung verhalten sich komplementär zueinander. Die Psychotraumatologie benötigt eine immer detailliertere Erforschung einzelner Komponenten auf unterschiedlichen Systemebenen, der physikochemischen, physiologischen und psychosozialen (vgl. Das Modell der Systemhierarchie, Abb. 2). Es ist aber in kaum einem Forschungsbereich so bedenklich wie hier, wenn darüber der synthetische Bezug zur traumatischen Erfahrung verloren gehen würde. Die Detailforschung ist zunächst nur insoweit sinnvoll, als sie uns die traumatische Erfahrung und ihre Folgen immer umfassender verständlich macht. Erst aus diesem Verständnis heraus können sich dann neue Behandlungsansätze und -methoden ergeben.
2.1 Zur Phänomenologie der traumatischen Situation
Der Begriff der „Situation“ hat in Psychologie, Philosophie und Soziologie deshalb Bedeutung gewonnen, weil er sich dazu eignet, objektive und subjektive Faktoren oder, methodologisch gesprochen, den objektiven und subjektiven Zugang zum menschlichen Erleben und Verhalten systematisch aufeinander zu beziehen. Gerade dieser Zwang, Objektivität und Subjektivität in ihrer wechselseitigen Verschränkung und → Dialektik zu sehen, macht den Situationsbegriff für die Psychotraumatologie interessant. Situationen bilden die minimale Beobachtungseinheit in den Sozialwissenschaften, die ohne Verzicht auf entscheidende Sinnbezüge nicht weiter unterschritten werden kann. So können wir als die elementare Beobachtungseinheit der Psychotraumatologie die traumatische Situation definieren. Wir werden uns im Folgenden mit einigen Konzeptualisierungen des Situationsbegriffs in Philosophie, Sozialwissenschaften und Psychologie befassen und uns von hier aus der Struktur traumatischer Situationen nähern.
Die entscheidende philosophische Vorarbeit zur begrifflichen Fassung von Situationen verdanken wir der phänomenologischen Tradition in Philosophie und Psychologie im Anschluss an die Arbeiten von Edmund Husserl (1969). Die meisten Autoren, die sich systematisch dieses Begriffs bedienen, bemühen sich um eine Thematisierung des Bezugs von Subjektivität und Objektivität, die über die traditionelle Fassung dieser Begriffe als Erkenntnisbegriffe hinausgeht und die realen lebensweltlichen Bedingungen des Handelns und der menschlichen Orientierung umfassen. Die gründliche Ausarbeitung eines Situationsmodells für die Soziologie von Arbeitssituationen verdanken wir Konrad Thomas (1969). Thomas definiert Situation als die „Einheit von Subjekt und Gegebenheit, bestimmbar durch das Thema, umgrenzt von einem Horizont“ (S. 60). Im Unterschied zu Situation, verwendet er den Begriff der „Lage“ für die objektiven, zunächst nur von außen bestimmbaren Faktoren, die in den Situationsbezug des Subjekts zwar eingehen, aber dennoch nicht in ihm aufgehen. In anderen Modellen wird dieser objektive Aspekt auch Umgebung oder Außenwelt genannt, während z. B. im Situationskreismodell nach Thure von Uexküll „Umwelt“ die schon auf das Subjekt bezogene, vom Subjekt erfahrene Umgebung oder Außenwelt bezeichnet. In einer dialektischen Fassung des Situationsbegriffs sind Situationsfaktoren immer schon auf das erlebende und handelnde Subjekt bezogen. D. h. eine → Situationsanalyse erfasst die objektiven Lagebestimmungen in der Perspektive des handelnden und sich orientierenden Subjekts. Das Subjekt andererseits befindet sich in einer Situation, d. h., es ist selbst ein integrativer Bestandteil derselben, nicht ein abgegrenztes Element oder Subsystem, das sich einer Situation „gegenüber“ befindet. Wenn ich also das Verhalten und Erleben eines Subjekts verstehen will, so muss ich es immer „situiert“ (ein Ausdruck, den Sartre häufig verwendet hat) verstehen.
Ein Irrweg in der Situationsanalyse ist die voreilige Psychologisierung des subjektiven Situationsmoments. Wenn wir z. B. sagen, jemand „fühlt sich traumatisiert“, so bleibt dieses Erleben so lange unverständlich, wie wir es nicht im Kontext der entsprechenden Erlebnissituation verstehen und analysieren. Die Dialektik im situationstheoretischen Denken erfordert Begriffe, in denen Subjektivität und Objektivität als aufeinander bezogene Größen gefasst werden. Ein solcher Begriff ist bei Thomas das Konzept der situativen Gegebenheiten. Gegebenheiten sind Situationsfaktoren, so wie sie sich für ein erlebendes und handelndes Subjekt, also auch vermittelt durch dessen Erfahrungsschemata darstellen. Gegebenheiten sind andererseits für einen außenstehenden Beobachter beispielsweise auch die Schemata des Subjekts selbst, mit Hilfe derer es seine Erfahrung organisiert.
Situationen sind bestimmbar durch ihr jeweiliges Thema. In einer therapeutischen Situation z. B. werden andere Dinge thematisch als in einer alltäglichen Unterredung zwischen Freunden oder nahen Bekannten. Das Thema verbindet sich also eng mit den sozialen Rahmenbedingungen. Diese unterliegen einem mehr oder weniger hohen Grad an sozialer Normierung und Standardisierung. In der Psychotherapie beispielsweise haben wir es im Allgemeinen mit einer hochstandardisierten Interaktionssituation zu tun. In Anlehnung an Konzepte der „kognitiven Psychologie“ wurde neuerdings die Normierung und Standardisierung von Situationen mit dem Begriff des Scripts bezeichnet (für die kognitive Psychologie z. B. Rumelhart; zum Situationsbegriff Schott 1991, 135 ff). Script ist eine Metapher, die ursprünglich aus der Filmsprache stammt. Einer Szene in einem Film liegt ein Drehbuch zugrunde. Dieses besteht aus einem Script, das die Schauspieler und der Regisseur in Handlung umsetzen. Das Konzept erscheint uns für die Situationsanalyse deshalb geeignet zu sein, weil es objektiv standardisierte und subjektive Elemente umfasst, die in konkreten Situationen miteinander verwoben sind. Nach Lindsay und Norman (1981) enthält ein Script drei Arten von Handlungsabläufen:
1.Kulturell normierte Abläufe.
2.Situativ gesteuerte, d. h. durch die gegenseitigen Erwartungen der Interaktionspartner bestimmte Abläufe.
3.Personengesteuerte Handlungsabläufe, die sich auf die beteiligten Persönlichkeiten und ihre individuelle Biographie zurückführen lassen.
Am Beispiel einer Arztvisite weist das Drehbuch unter 1 hochgradig ritualisierte Handlungsabläufe auf. Gleichzeitig gehen aber auch die gegenseitigen Erwartungen jeweils von Arzt und Patient in die Handlungssequenz ein und wenn man die Analyse genau genug betreibt, lässt sich auch eine personengesteuerte Dramaturgie in ihnen entdecken, die über die jeweilige Interaktionssituation hinausreicht in die Biographie der Handelnden hinein. Auch hier können vor allem bei interaktionsgestörten Persönlichkeiten hochgradig ritualisierte Abläufe entdeckt werden, wie auch der Scriptbegriff bei Eric Berne in „Spiele der Erwachsenen“ zeigt (1964). „Script“ bezeichnet bei Berne den unbewussten Lebensentwurf einer Person, ein „Drehbuch“, das die verschiedenen Szenen und Situationsfolgen eines ganzen Lebenslaufes bestimmen kann. Situationen sind umgrenzte Einheiten von Erleben, Verhalten und sozialer Interaktion, die zwar auseinander hervorgehen und ineinander übergehen können, sich aber durch eine Grenze voneinander unterscheiden. Für die Bezeichnung dieser Grenze zwischen Situationsfolgen schlägt Thomas (1969) den Begriff des Horizonts vor. Die Horizont-Metapher entstammt der phänomenologischen Tradition von Edmund Husserl und entspringt der räumlichen Erfahrung, beispielsweise der eines Wanderers. Eine Situation ist demnach begrenzt von dem Erlebnishorizont dessen, der sich in ihr befindet. Es ist aber immer auch möglich, diesen Horizont zu „erweitern“, die Situation zu „überschreiten“ und sie dadurch zu verändern.
Dieses Überschreiten einer Situation auf eine künftige Lösung und Weiterentwicklung hin, ist Bestandteil des Situationsmodells von Thomas. Ist es ausgeschlossen, den Horizont einer Situation zu überschreiten, sie auf einen Zukunftsentwurf hin zu verändern, so geraten wir bereits in die Sphäre pathogener, möglicherweise sogar traumatischer Situationen, da das menschliche Weltverhältnis auf die Veränderung negativer Situationsfaktoren hin angelegt ist. Auch das „Thema“ der Situation hat objektive und je persönliche Aspekte. Das Thema einer psychotherapeutischen Situation beispielsweise bilden Erleben und Verhalten des Patienten. Ebenso können aber auch die therapeutische Beziehung und das Erleben oder Verhalten des Therapeuten zum Thema werden. Das Situationsthema ist also zunächst vorgegeben, durch reflexive Thematisierung des in der Situation Thematischen kann sich eine Situation jedoch weiterentwickeln. Ein Wechsel des Themas führt oft schon einen Wechsel der Situation herbei, so etwa, wenn in einer traditionellen Vorlesungsveranstaltung eine hochschulpolitische Diskussion gefordert wird und dann auch stattfindet. Der Übergang vom vorgegebenen Thema zur „Thematisierung“ der Situation entspricht dem Übergang von Kommunikation zur Meta-Kommunikation. Dieses meta-kommunikative Überschreiten vorgegebener Situationsthemen gehört zum „offenen Horizont“der einer gelingenden Situationsgestalt normalerweise eignet. Umgekehrt sind der Verlust des „offenen Horizonts“ und die Unmöglichkeit von Meta-Kommunikation charakteristische Merkmale potenziell traumatischer Situationen.
Wenn wir nun versuchen, das Situationskonzept für die Analyse traumatischer Situationen heranzuziehen, so müssen wir zunächst einmal der Forderung nach „Einheit von Subjekt und Gegebenheiten“ Rechnung tragen. Dies bedeutet, dass wir die objektiven Lagebestimmungen einer traumatischen Situation als „Situationsfaktoren“ fassen müssen, d. h. in der Weise, wie sie sich für das erlebende und handelnde Subjekt in dieser „traumatischen Situation“ darstellen. Eine Beschreibung traumatischer Lagefaktoren an sich, d. h. ohne Bezug auf ein erlebendes Subjekt, wäre in der Psychotraumatologie ein sinnloses Unternehmen. Zwar ist es möglich, subjektive und objektive Aspekte der traumatischen Situation getrennt darzustellen, wie wir dies in den folgenden Kapiteln versuchen werden. Für die Grundlagen einer allgemeinen Psychotraumatologie jedoch muss die Klammer des Situationsbezuges stets erhalten bleiben. Nur so wird es möglich, Situationen wirklich zu erfassen. Das Gleiche gilt umgekehrt für die Untersuchung der Strukturen und Funktionen des erlebenden und sich verhaltenden Subjekts. Auch hier ist es möglich, das Erleben des Subjekts getrennt zu thematisieren, z. B. eine Analyse der traumatischen Reaktion als solcher vorzunehmen, etwa unter physiologischen Aspekten. Wir können traumatische Erlebnisreaktionen beschreiben, müssen uns dabei jedoch bewusst sein, dass hier eine Abstraktion vorliegt, die unserer Begrifflichkeit entstammt und nicht der realen Verfassung unseres Gegenstandes. „Nichtsituierte“ oder „desituierte“ Subjekte sind Abstraktionen, die lediglich zu Darstellungszwecken vorübergehend gerechtfertigt erscheinen. Sobald eine solche Abstraktion in ihrer Bedeutung für das reale Leben verstanden werden soll, ist es notwendig, sie zu resituieren, d. h., sie wieder in den konstitutiven Situationsbezug erlebender und handelnder Subjekte einzufügen.