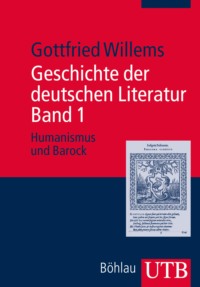Kitabı oku: «Geschichte der deutschen Literatur. Band 1», sayfa 3
Wie präsent das Oeuvre Shakespeares im kulturellen Leben der Gegenwart ist, ist nicht zuletzt daraus zu ersehen, daß es öfter verfilmt worden ist als das jedes anderen Autors der Weltliteratur. Fast jedes Jahr bringt mehrere neue Verfilmungen, und sie finden vielfach selbst dann ihr Publikum, wenn sie – wie „Heinrich V.“ von Kenneth Branagh – im Kostüm der Shakespeare-Zeit daherkommen und sich an die hochpoetischen, mit humanistischem Bildungsgut vollgepfropften Originaldialoge halten. Und natürlich ist auch das produktive Gespräch der Literatur mit Shakespeare bis heute nicht abgerissen, auch und gerade dort nicht, wo sie sich entschieden modernen Konzepten verschrieben hat. Hier sei nur an die „Hamletmaschine“ (1978) von Heiner Müller sowie an den „Park“ (1983) von Botho Strauß erinnert, wo noch einmal die Elfenwelt des „Sommernachtstraums“ beschworen wird.
Shakespeare ist wohl das beste Beispiel dafür, daß auch die frühe Neuzeit zu literarischen Werken fähig war, die das Publikum bis heute in ihren Bann zu ziehen vermögen, daß auch ihre Kultur über gedankliche und ästhetische Ressourcen verfügte, die eine Literatur entstehen ließen, die den Menschen bis heute etwas zu sagen hat. Shakespeare ist freilich eine einzigartige Erscheinung, und so lassen sich ihm nur
[<< 32]
wenige Autoren an die Seite stellen, die auf ähnlich eindrucksvolle Weise für die Bildungswelt der frühen Neuzeit zeugen. Doch es gibt sie, und es gibt genug von ihnen, um den Befund zu verallgemeinern. Da ist zunächst an Cervantes – mit vollständigem Namen: Miguel de Cervantes Saavedra – und seinen Roman „Don Quijote“ (1605 –1616) zu denken, und sodann an Molière – mit bürgerlichem Namen Jean-Baptiste Poquelin – und dessen Theater, an Komödien wie „Der Arzt wider Willen“ (1667), „Der Misanthrop“ (1667), „Tartuffe“ (1669), „Der Bürger als Edelmann“ (1672), „Der eingebildete Kranke“ (1673) und „Der Geizige“ (1682). Wie die Werke von Shakespeare finden auch sie bis heute auf direktem Wege zu einem breiten Publikum.
Und ein weiterer Autor kann hier noch genannt werden, der zwar nicht ganz so bekannt ist, weil sein Werk nicht der Kernzone der Literatur angehört, der jedoch gerade von der modernen Literatur als Gesprächspartner besonders ernst genommen worden ist: Michel de Montaigne (1533 –1592). Seine „Essais“ (1580 –1595), kurze Aufsätze über die verschiedensten Gegenstände des Interesses, gelten als erstes Beispiel der Gattung „Essay“ und Muster der essayistischen Schreibweise, also eines literarischen Phänomens, das gerne für typisch modern gehalten wird. In ihnen will man erstmals die Stimme des modernen Individuums vernehmen, wie es sich als Selbstdenker durch die Welt bewegt, selbst den ehrwürdigsten Traditionen und der Wissenschaft mit Skepsis begegnet und in allem auf die eigene Erfahrung und die eigene Einsicht setzt.
Moderne Züge?
Shakespeare, Cervantes, Molière, Montaigne – diesen Namen läßt sich aus deutscher Sicht allenfalls der von Grimmelshausen an die Seite stellen. Denn er ist der einzige, der eine vergleichbare Präsenz im literarischen Leben der Gegenwart hat, und auch das nur mit Abstrichen. Literarhistoriker neigen dazu, an den Werken der genannten Autoren um solcher Präsenz willen bereits moderne Züge zu entdecken, so als hätten diese etwas von den Lebensverhältnissen, den Interessen und Vorstellungen des modernen Menschen vorausgeahnt; und manche berufen sich dabei immer noch auf das, was eine Genieästhetik, die freilich inzwischen in die Jahre gekommen ist und weniger der Wissenschaft als der wundersamen Welt des populären Künstlerkitschs angehört, „die antizipatorische Kraft der Kunst“ nennt.
Doch niemand kann in die Zukunft schauen, auch kein Dichter. Ein Shakespeare war genauso ein Kind seiner Zeit wie jeder andere
[<< 33]
unter seinen schreibenden Zeitgenossen, war ebenso in die Lebens- und Vorstellungswelt seiner Epoche eingeschlossen wie sie und verfügte nicht über besondere, vom Himmel der Inspiration gefallene seherische Gaben – wie sollte er auch! Bei dem, was sein Werk vor anderen auszeichnet und was es die große historische Distanz bis heute scheinbar mühelos hat überwinden lassen, kann es sich nur um besondere gedankliche und ästhetische Qualitäten handeln, um Qualitäten, wie sie aus der Fähigkeit eines Autors erwachsen, schärfer und rücksichtsloser als andere in die Welt und auf die Mitmenschen zu blicken und die Möglichkeiten seiner Zeit energischer zu ergreifen und konsequenter und einfallsreicher zu nutzen als sie.
Zwei weitere Momente kommen hinzu, die dem modernen Leser die Annäherung an die genannten Autoren erleichtern. Zum einen sind sie in Fragen der Religion zurückhaltender als viele ihrer Zeitgenossen, sind sie nicht so penetrant fromm und so ängstlich um theologische Korrektheit bemüht wie diese, was heute vom Leser im allgemeinen mit dem Gefühl der Monotonie quittiert wird: was auch an Geschichten, Gefühlen und Gedanken vor ihm ausgebreitet werden mag – am Ende steht der immer gleiche Sturz in den immer gleichen Abgrund des Glaubens. Von solcher Diskretion kann bei Grimmelshausen allerdings nicht die Rede sein; bei ihm sind religiöse Fragen allgegenwärtig. Dafür kommt sein Werk dem modernen Leser an anderer Stelle entgegen: es verlangt ihm nicht so viel an humanistischer Bildung ab wie das anderer frühneuzeitlicher Autoren, ist nicht in gleichem Maße mit dem gelehrten Wissen der Zeit durchdrungen; davon wird noch zu reden sein.
Und zum andern sind die Werke dieser Autoren dank ihrer ununterbrochenen Präsenz über die Jahrhunderte hin dem modernen Leser am besten erschlossen. Jede Generation hat sie im Licht der jeweils neu aufkommenden Interessen gedeutet und damit ihr Teil dazu beigetragen, daß sie an den Horizont der Gegenwart herangeführt wurden. Wer heute Shakespeare liest, der kann dabei von dem Bild profitieren, das sich Aufklärung, Klassik und Romantik, Vormärz und Realismus von ihm gemacht haben; denn durch sie sind seine Texte nach und nach mit den meisten der Fragen und Gesichtspunkte in Berührung gebracht worden, die einen Menschen von heute bei der Lektüre leiten mögen.
[<< 34]
Die Macht des kulturellen Gedächtnisses
Es gibt in der frühen Neuzeit also doch eine ganze Reihe von Autoren und Werken, die bestens in Erinnerung geblieben sind, die unter dem Vorzeichen großer historischer und ästhetischer Bedeutung auf uns gekommen sind, und überdies auf eine Weise, durch die uns der Zugang zu ihnen leicht gemacht wird. Die Stellung im Haushalt des kulturellen Gedächtnisses und die Zugänglichkeit für den heutigen Leser sind freilich nicht alles. Das kulturelle Gedächtnis ist kein Gottesgericht, und was dem Leser im ersten Zugriff Mühe bereitet, muß deshalb nicht immer schon irrelevant und uninteressant sein; ja ist es nicht vielfach gerade das wenig Beachtete und halb schon Vergessene, das Sperrige, Beschwerliche und Befremdliche, was uns am ehesten dazu verhilft, neue Erfahrungen zu machen und neue Einsichten zu gewinnen?
Hier hatte allerdings zunächst die Frage nach dem kulturellen Gedächtnis 6 und den Problemen des Zugangs zur Literatur im Vordergrund zu stehen, denn mit ihr beginnt die Arbeit der Literaturgeschichtsschreibung. Was immer sie anpackt, kommt als ein Gegenstand auf sie zu, dem das kollektive Gedächtnis der Gesellschaft bereits seinen Stempel aufgedrückt hat, den es mit bestimmten Erwartungen, bestimmten Vorstellungen und Wertungen versehen, ja geradezu imprägniert hat. Es ist überall mit am Werk, wo sich Menschen der Literatur zuwenden, in den Räumen ihrer kulturellen Sozialisation – im Elternhaus, in der Schule, im Freundeskreis – genauso wie in denen des öffentlichen Lebens und der medialen Kommunikation, die Wissenschaft nicht ausgenommen. So bekommt in Deutschland jedes Kind früher oder später mit, daß es einen Goethe und einen Schiller gegeben hat und daß diese etwas geschaffen haben, das heute noch von vielen für bedeutsam gehalten wird, wenn es vielleicht auch schon etwas angestaubt sein mag, und das wird in dieser oder jener Form einen Einfluß auf seinen Umgang mit Literatur haben. Und wenn man von einer bestimmten kulturgeschichtlichen Erscheinung nur wenig oder gar nichts zu hören bekommt, so wie von weiten Teilen der frühneuzeitlichen Literatur, dann begründet auch dies eine
[<< 35]
Erwartung, nämlich eine Art „Null-Erwartung“, und auch solche „Null-Erwartung“ hat Folgen.
Literaturwissenschaft und kulturelles Gedächtnis
Das kulturelle Gedächtnis bezeichnet den Wissens-Fond, um nicht zu sagen: den Bodensatz des literarischen Lebens, und so hat es die Literaturwissenschaft zunächst mit ihm aufzunehmen. Seine Kenntnis allein erlaubt es ihr, sich gezielt auf die Problemfelder einzustellen, um deren Bearbeitung willen sie von der Gesellschaft unterhalten wird: auf die Aufgabe, das literarische Leben zu fördern, indem sie ihm ein Mehr an Wissen zuführt und damit seinen Horizont und seinen Aktionsradius erweitert – ein Unternehmen, mit dem sich letztlich die Hoffnung verbindet, daß die Horizonte des individuellen und gesellschaftlichen Lebens so überhaupt erweitert werden könnten, daß sich neue Optionen des Denkens und Handelns eröffnen oder vergessene Optionen neuerlich bewußt werden würden.
Das erste, was die Literarwissenschaft bei der Annäherung an eine Epoche zu tun hat, ist also, die Bestände des kulturellen Gedächtnisses zu sichten und sich von ihrem Einfluß Rechenschaft zu geben, so wie hier geschehen. Sie kann sich weder damit begnügen, diese Bestände einfach zu übernehmen, noch sie pauschal in Frage zu stellen; vielmehr muß sie versuchen, sie kritisch auf die Vorstellungen und Wertungen hin zu durchleuchten, die ihnen zugrunde liegen, die Voraussetzungen aufzuzeigen, unter denen sie sich gebildet, und die Folgen, die sie gezeitigt haben. Nur so kann ja jenes Mehr an Wissen entstehen, um dessen Gewinnung es zu tun ist.
Dabei rückt eben das, was der kollektiven Erinnerung entfallen ist, was sie als etwas Beschwerliches und Befremdliches beiseite gesetzt und für überholt erklärt, ja um seiner Unbehaglichkeit willen womöglich verdrängt hat, in den Mittelpunkt des Interesses. Es geht nun gerade um das Vergessene, Verdrängte und Befremdliche, und es geht selbst dort darum, wo man sich die Lieblingskinder des kulturellen Gedächtnisses, die Klassiker vornimmt. Denn anders als die Protagonisten des literarischen Lebens kann es sich ein Literarhistoriker, der die Aufgabe seines Fachs ernst nimmt, nicht mit einem aufklärerischen Cervantes, einem romantischen Shakespeare oder einem realistischen Grimmelshausen bequem machen, muß er es auch und gerade bei solchen kanonischen Autoren mit dem aufnehmen, was von einem heutigen Leser an
[<< 36]
ihren Werken im ersten Anlauf als irritierend und beschwerlich empfunden werden mag.
Das Spannungsfeld von Identität und Alterität
Dem Leser kann dies letztlich nur recht sein. Die Literarhistorie kommt damit nämlich einem Verlangen entgegen, das in jeder Lektüre mit am Werk ist, ja das geradezu einen Grundimpuls des Lesens bezeichnet. Denn warum greifen wir zu einem Buch? Doch weil wir einmal etwas anderes hören wollen; weil wir über die Lebens- und Vorstellungswelt, an die wir gewöhnt sind, hinausgehen und uns mit Möglichkeiten des menschlichen Daseins konfrontieren wollen, die nicht die unseren sind, die uns insofern zunächst fremd sind und vielleicht sogar auf Dauer fremd bleiben. Freilich verbindet sich damit die Hoffnung, über solcher Lektüre auch etwas für die eigene Lebens- und Vorstellungswelt zu gewinnen, zu erleben, daß die eigenen Selbstverhältnisse zugleich sicherer und offener werden und das eigene Leben und Denken sowohl eine Bereicherung erfahren als auch klarere Konturen annehmen.
Die moderne Literaturwissenschaft verhandelt diese beiden Aspekte des Lesens gerne unter dem Titel „Identität und Alterität“. Lesend gehen wir sowohl auf Momente aus, mit denen wir uns identifizieren können, als auch auf solche, die uns als ein „alter“, ein Anderes, Unbekanntes, Fremdes entgegentreten. Genauer betrachtet, handelt es sich um einen Prozeß dialektischer Wechselwirkung. In der Konfrontation mit Alterität konstituiert sich Identität, und im Innewerden von Identität wird Alterität allererst zu Alterität. Dies ist aber eben als ein Prozeß zu verstehen und nicht als ein einmaliger Akt mit einem unverrückbaren Resultat. Denn die Begegnung mit dem Fremden kann auch dazu führen, daß wir in einen produktiven Dialog mit ihm eintreten und es uns unter diesem oder jenem Aspekt zueigen machen. Damit aber geraten beide Seiten gleichzeitig in Bewegung: Fremdes hört auf, fremd zu sein, und die Identität wird eine andere – was nichts anderes heißt, als daß Momente, mit denen man sich bis dato identifiziert hat, nun selbst zu etwas Fremdem werden.
Jede Lektüre vollzieht sich in einem Spannungsfeld von Identität und Alterität, Lesergewohnheit und Leserneugier, und je mehr ein Text der Neugier an Alterität, an Unbekanntem, Ungewöhnlichem, Befremdlichem zu bieten hat, desto mehr kann im Leser bei der Auseinandersetzung mit ihm in Bewegung geraten, desto besser sind die
[<< 37]
Aussichten auf eine spannende und ergiebige Leseerfahrung. Wenn das aber richtig ist, dann muß uns gerade eine Literatur wie die der frühen Neuzeit, die uns wegen ihrer großen historischen Distanz inzwischen in vielem fremd geworden ist, eben weil sie uns fremd geworden ist, besonders viel zu sagen haben. Freilich wird man sich den Schatz an Leseerfahrungen, den sie für uns bereithält, nur in dem Maße erschließen können, in dem man es bewußt und gezielt mit diesem fremd Gewordenen aufnimmt, in dem man sich bei der Lektüre nicht mit bequemen Möglichkeiten der Identifikation zufrieden gibt und alles andere einfach überliest.
1.2 Literaturgeschichte als Ort der Begegnung mit dem Fremden
Literatur als Medium einer Begegnung mit dem Fremden – was das heißt, haben die Germanistik und ihre Literaturgeschichtsschreibung 7 erst in einem langen, mühsamen Prozeß lernen müssen. Zwar standen die Fragen von Identität und Alterität seit jeher im Mittelpunkt ihres Interesses, denn es waren sie, denen sie ihre Existenz verdankten, doch hatten sie zunächst von ihnen ein mehr oder weniger statisches, undialektisch starres Verständnis. Eine Begegnung mit dem Fremden, die diesen Namen verdiente, die nicht nur eine Konfrontation, sondern auch ein Austausch wäre, war nicht vorgesehen.
Literaturgeschichte im Dienst der nationalen Identität
Wie bereits erwähnt, gehen die ersten Anfänge der Germanistik auf das frühe 19. Jahrhundert und die nationalromantische Bewegung zurück, formierte sie sich unter dem Vorzeichen des nationalen Gedankens, wie er alsbald nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa zu einer Dominante der Kultur werden sollte. Demgemäß
[<< 38]
verfolgten ihre Gründer, die Generation der Brüder Grimm, mit dem neuen Fach vor allem ein Ziel: sie wollten ihren deutschen „Volksgenossen“ mit der Erforschung der deutschen Sprache, Literatur und Volkskultur ein Bewußtsein von ihrer nationalen Identität, ihrer deutschen Eigenart geben und damit einen Beitrag zum „Werden der Nation“ leisten; denn das hatten die Deutschen zu Beginn des 19. Jahrhunderts ja erst noch vor sich. In diesem Sinne sollte das neue Fach der alten, der Klassischen Philologie, die sich um die griechische und lateinische Welt kümmerte, als eine Nationalphilologie an die Seite treten.
Dabei ging man mit größter Selbstverständlichkeit von zwei Voraussetzungen aus, die sich keineswegs von selbst verstehen, die vielmehr durchaus problematisch sind und einer kritischen Prüfung bedürfen. Zum einen begriff man die nationale Identität als Basis der Identität des Individuums; das Ich sollte nur in eben dem Maße zu sich selbst finden, mit sich ins reine kommen können, in dem es sich seines deutschen Charakters bewußt wurde und den „deutschen Volksgeist“, die „deutsche Volksseele“ an sich selbst kultivierte. Und zum anderen verstand man Identität als eine statische Größe; das „deutsche Wesen“ sollte sich dank des immer gleichen deutschen „Bluts und Bodens“ zu allen Zeiten gleich geblieben sein.
Und so suchte man denn in allen Phasen der Literaturgeschichte, selbst in den ältesten Zeiten, selbst in der altgermanischen Sagenwelt und im Umfeld des ersten namhaften Germanenfürsten Hermann des Cheruskers – jenes Arminius, der den Römern 9 n. Chr. die Schlacht im Teutoburger Wald geliefert haben soll – die Spuren dieses unwandelbaren „deutschen Wesens“. Man kann sich aus heutiger Sicht nur darüber wundern, wie genau man seinerzeit zu wissen meinte, was „deutsche Eigenart“ sei; so war man sich etwa dessen sicher, daß Treue, Biederkeit, Frömmigkeit und Tiefsinn typisch deutsche Werte seien. In sämtlichen bedeutenden Werken der deutschen Literatur sollte sich derlei bald mehr und bald weniger deutlich gezeigt haben, am deutlichsten aber in denen der beiden „Blütezeiten“, der „mittelhochdeutschen“ und der „Weimarer Klassik“. Da sollte alles, was die Identität der Deutschen phasenweise hatte überlagern und niederhalten können, entweder völlig abgeschüttelt oder restlos in „deutsche Eigenart“ verwandelt worden sein.
[<< 39]
Demgemäß wurde der Alterität hier vor allem die Rolle eines „agent provocateur“ der Identität zugewiesen. Eine Begegnung mit dem Fremden, wie sie den Deutschen zuerst durch die Römer und zuletzt durch die Franzosen zugemutet worden sein sollte, war nur in zwei verschiedenen Formen vorgesehen: in der der Überfremdung, also eines Überfalls auf die deutsche Identität, eines mehr oder weniger gewaltsamen Anschlags auf das „ewige deutsche Wesen“, sowie in der der Anverwandlung, und das heißt: in Form eines Geschehens, bei dem sich das Fremde als ein bis dato noch nicht bewußt gewordenes und unentfaltet gebliebenes Eigenes entpuppte, bei dem es den Charakter der Alterität verlor und zu einem integralen Bestandteil der Identität wurde. So oder so sollte die Begegnung mit dem Fremden nicht mehr und nichts anderes bewirken können als eine neuerliche, nunmehr besonders entschiedene Besinnung auf das Eigene, als ein klareres Bewußtsein der eigenen Identität und eine konsequentere Entfaltung der eigenen Potentiale. Daß es auch einen produktiven Austausch mit dem Fremden geben und die Identität sich dabei zu ihrem eigenen Besten verändern könnte, war außerhalb der Vorstellung. Man hatte eben noch keine dynamischen, hatte nur statische Begriffe von Identität.
Nationalphilologie und Komparatistik
Dabei ist es bis weit ins 20. Jahrhundert hinein geblieben. Erst das Erlebnis des Ersten und Zweiten Weltkriegs, der beiden großen Katastrophen des europäischen Nationalismus, brachte einen Wandel. Er begann unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Versuch, die Germanistik systematisch mit den anderen Nationalphilologien, die sich im 19. Jahrhundert gebildet hatten, mit Fächern wie Romanistik und Anglistik ins Gespräch zu bringen. Aus ihm ist damals ein neuer Zweig der Literaturwissenschaft erwachsen, die Komparatistik oder Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft.8
Was hier an neuen Formen der Literaturgeschichtsschreibung erprobt wurde, blieb zunächst freilich noch immer den alten Konzepten von Identität und Alterität verhaftet. Denn man versuchte die Grenzen zwischen den Nationalphilologien lediglich dadurch
[<< 40]
aufzubrechen, daß man die Instanz der Identität tiefer legte, daß man eine gemeineuropäische Identität unterhalb der verschiedenen nationalen Identitäten herauszuarbeiten suchte, als einen gemeinsamen Fond von Wesenszügen, in dem alle europäischen Nationen miteinander verbunden wären. Diese gemeineuropäische Identität dachte man sich aber ebenso als eine statische Größe, als unwandelbare, unverlierbare Eigenart wie die zuvor entwickelten nationalen Identitäten. Sie sollte vor allem auf den drei Faktoren beruhen, in denen man die Grundpfeiler des „Abendlands“ erkennen wollte: 1. auf dem Erbe der Antike, auf dem, was von den alten Griechen und Römern auf die modernen europäischen Nationen gekommen war, 2. auf dem jüdisch-christlichen Erbe, auf den Traditionen der christlichen Religion, und 3. auf dem germanischen Erbe; denn die modernen europäischen Nationen gehen ja weithin auf die Staatenbildung der Germanen in den Zeiten der Völkerwanderung zurück. An einen vierten, womöglich noch wichtigeren Komplex, an die europäische Aufklärung, die nach und nach alle diese Erbschaften kritisch hinterfragt und auf Distanz gestellt hatte, dachte man zunächst noch kaum.
Kritik am Konzept der Nationalphilologie
Bei alledem blieb das Konzept der Nationalphilologie im Kern unangetastet. Das änderte sich allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg, oder vielmehr in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts; denn so lange dauerte es, bis man sich endlich dazu durchgerungen hatte, mit aller Entschiedenheit die Konsequenzen aus den kriegerischen Debakeln des europäischen Nationalismus zu ziehen und sich, wo immer es möglich schien, von ihm zu lösen. Da wurde dann gefragt, ob sich die Germanistik noch immer als eine „deutsche Wissenschaft“ begreifen wolle 9 und warum ihre Literaturgeschichtsschreibung so lange auf das Moment der nationalen Identität fixiert gewesen sei. Hatte das die Literatur je wirklich beschäftigt? Hatten nicht seit jeher ganz andere Themen und Probleme für sie im Vordergrund gestanden, Fragen, die überall auf der Welt im Kern die gleichen waren und nur am Rande von den Besonderheiten einer Nationalkultur überformt wurden wie die Frage nach dem Verhältnis von Individuum
[<< 41]
und Gesellschaft, individueller Freiheit und sozialen Zwängen, Liebe und Gewalt, Selbstverwirklichung, Unterdrückung und Anpassung? Und hatte man nicht selbst bei dem Thema der Identität zunächst und vor allem an sie zu denken? Aus solchen Überlegungen erwuchs eine Literaturwissenschaft, die sich mehr und mehr auf allgemeine sozialgeschichtliche und sozialpsychologische Fragen fokussierte und nur in diesem Zusammenhang noch auf den nationalen Kontext einging.
Zugleich suchte die Literaturwissenschaft immer tiefer in die Dialektik von Identität und Alterität einzudringen. Dabei wurde sie von jener Entwicklung vor sich hergetrieben, die in den Debatten der Gegenwart unter dem Schlagwort der „Globalisierung“ firmiert, der Entwicklung hin zu einer „multikulturellen Gesellschaft“, wie ein weiteres vielberufenes Schlagwortwort lautet. Wir leben heute in einer Welt, in der immer mehr Menschen immer öfter ins Ausland reisen, ja mit aller Selbstverständlichkeit auf dem gesamten Globus unterwegs sind, sei es weil es das Studium oder der Beruf von ihnen verlangt oder weil sie ihre Freizeit auf Reisen verbringen, und in der ein jeder zugleich in seinem heimatlichen Umfeld immer häufiger mit Menschen zu tun bekommt, die aus einem anderen Kulturkreis stammen und dies in ihrem Gebaren und ihrer Lebensführung weder verleugnen können noch wollen. Wir sind mithin nicht mehr nur ausnahmsweise, bei seltenen Gelegenheiten, sondern permanent und in allen möglichen Zusammenhängen des alltäglichen Lebens mit Alterität konfrontiert, mit Lebensformen, Haltungen, Werten, Weltanschauungen, Religionen, die nicht die unseren sind, die uns fremd sind und die uns insofern einiges an Selbstverleugnung abverlangen – nicht anders als denen, die es mit uns aufnehmen müssen. Natürlich kommt es dabei immer wieder zu Mißverständnissen und Konflikten, ja mancherorts ist gar von einem „clash of civilisations“ die Rede.
Die Dialektik von Identität und Alterität
Vor diesem Hintergrund schien es unumgänglich, die Problematik von Identität und Alterität noch einmal neu und anders zu denken. Dabei versuchte man vor allem auf jenem Weg voranzukommen, der hier mit dem Begriff der Dialektik umschrieben worden ist. So wurde nun mit neuem Nachdruck gefragt, inwieweit die eigene Identität an den Vorstellungen beteiligt sei, die man sich von Alterität mache, und wieviel Alterität sich womöglich in dem verberge, was man jeweils für seine Identität halte, zwei Fragen, die die Literaturwissenschaft um so
[<< 42]
lieber aufnahm, als auch die moderne Literatur des 20. Jahrhunderts mehr und mehr dazu übergegangen war, das Verhältnis von Identität und Alterität in ihrem Sinne zu erkunden.
„Postcolonial Studies“
Der ersten Frage, der nach dem Anteil der Identität an den Begriffen von Alterität, wurde mancherorts eine solche Aufmerksamkeit zuteil, daß daraus geradezu eine neue „Methode“, eine besondere Richtung der literaturwissenschaftlichen Forschung erwachsen ist: die „postcolonial studies“.10 Hier versucht man sich an einer Generalabrechnung mit dem, was man den „Eurozentrismus“ nennt. Die These ist, daß die Bilder, die wir uns in unserer Literatur und Wissenschaft von fremden Kulturen machen – und das heißt: von Kulturen, mit denen Europa vor allem infolge seines Kolonialismus in Berührung gekommen ist – durch und durch von Begriffen und Wertungen geprägt seien, die in der europäischen Identität gründen, und zwar auch dann und gerade dann, wenn sie einem Versuch entsprungen sind, Alterität zu fassen, also der Identität jener anderen Kulturen auf die Spur zu kommen. Damit sind Vorstellungen wie die gemeint, daß bestimmte Völker ein „natürlicheres“ Leben führen würden als die Europäer oder daß ihre Kultur einen „exotischen“ Charakter hätte. Alle diese Bilder verfallen dem Generalverdacht, nicht mehr als die indirekte Selbstillumination einer selbstgefällig-selbstbezüglichen europäischen Identität zu sein, und damit eine Fortsetzung des Kolonialismus mit anderen Mitteln.
Hier hat man es also gerade auf jene „abendländische“ Identität abgesehen, mit deren Rekonstruktion die Literaturwissenschaft in ihrer komparatistischen Phase die engen Grenzen der Nationalphilologien zu überwinden suchte. Und auch die Art und Weise, wie sie seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts durch das Starkmachen sozialgeschichtlicher und sozialpsychologischer Fragen der Fixierung auf nationale Identitäten entkommen wollte, findet hier nur wenig Gegenliebe. Denn was sie dabei an Themen und Problemen benannte, die den Menschen aller Nationen und Kulturkreise gemein sein sollten, Themen wie das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft,
[<< 43]
individueller Freiheit und sozialen Zwängen, Selbstverwirklichung, Unterdrückung und Anpassung, gilt den „Postkolonialisten“ als Resultat einer Begriffsbildung, die ganz und gar Europa angehört, die nämlich auf dessen wissenschaftlicher Soziologie und Psychologie beruht, und damit auf einer spezifisch europäischen Kultur von Logik und Wissenschaft. Deshalb wäre es ihrer Meinung nach verfehlt, von ihnen aus außereuropäische Kulturen ins Visier zu nehmen.
Bei solchen Überlegungen verwickeln sich die „Postkolonialisten“ allerdings immer wieder in einen Widerspruch, der ihr gesamtes Unternehmen gefährdet: sie unterwerfen die Kultur Europas um einer möglichst schlagenden Kritik am „Eurozentrismus“ willen eben den starren Begriffen von Identität und Alterität, deren Anwendung auf fremde Kulturen sie ihr zum Vorwurf machen. Da meint man vielfach nur allzu genau und sicher zu wissen, was die problematischen Merkmale der europäischen Identität seien. Diesem Dilemma können die „Postkolonialisten“ wohl nur dadurch entkommen, daß sie ihre zentrale Frage, die nach dem Anteil der Identität am Definieren von Alterität, konsequent mit deren dialektischem Gegenstück verbinden, der Frage nach der Alterität im Binnenraum der Identität, und daß sie deren Ertrag auch ihrem Bild von der Kultur Europas zugute kommen lassen.
Das Fremde im eigenen Haus
Dabei dürfte es sich freilich um den schwierigeren Teil der Aufgabe handeln – schwieriger schon allein deshalb, weil er dem, der sie angeht, eine erhebliche psychische Anstrengung abverlangt. Denn die Frage nach dem, was in der eigenen Identität an Alterität umgehen mag, die Frage nach dem Fremden im eigenen Haus, ist eine unbehagliche Frage. Man möchte nur allzu gerne glauben, in der Kultur der Kollektive, denen man sich zugehörig fühlt – der Nation, der Region, der Gemeinde, der Familie, der Kirche, der Partei, des Vereins, der Alters- oder Berufsgruppe, der „peer group“ – sei einem alles gleich nah und zugänglich, sei man überall gleichermaßen zu Hause und bei sich selbst. Man möchte nicht wahrhaben, daß sich in dem Gefüge von Traditionen und Konventionen, mit dem man sich bei solchem Sich-zugehörig-Fühlen identifiziert, womöglich Momente verbergen, die man bei Lichte besehen nur mit Unverständnis und dem Gefühl der Verunsicherung würde quittieren können. Und doch kommt letztlich niemand daran vorbei, sich der Alterität in der Identität zu
[<< 44]
stellen, zumal heute, angesichts der Herausforderungen der „Globalisierung“. Denn nur wer um das Fremde im eigenen Haus weiß, kann Mittel und Wege finden, dem Fremden, das von außen an ihn herantritt, auf angemessene Weise zu begegnen.
Einkehr ins Eigene vs. Begegnung mit dem Fremden
Die „Nationalphilologie“ Germanistik näherte sich der Geschichte der deutschen Literatur von dem Gedanken aus, daß ein Deutscher beim Gang durch die verschiedenen Epochen nur auf Gegenstände treffen würde, die ihm im Grunde immer schon vertraut wären, in denen er überall sein Eigenstes, das „ewige deutsche Wesen“ würde wiederfinden können, so daß er sich in der Auseinandersetzung mit ihnen immer besser mit sich selbst bekannt machen und seiner Identität immer sicherer werden könnte. Ob Goethe oder Lessing, Opitz, Luther oder Hans Sachs, Walther von der Vogelweide oder Wolfram von Eschenbach, Dietrich von Bern oder Hermann der Cherusker – sie alle sollten ihm als einem Deutschen letztlich gleich nah und zugänglich sein. Aber das war nie mehr als eine windige Spekulation. Denn die deutsche Geschichte kennt wie die Geschichte jeder anderen Nation nicht nur Formen kontinuierlicher Entwicklung, sondern auch Kontinuitätsbrüche, Phasen tiefer Einschnitte und grundstürzender Wandlungen, und diese hatten nun einmal stets zur Folge, daß Traditionen abrissen und Konventionen ausrangiert wurden, daß kulturelle Bestände fremd und unverständlich wurden oder vollends dem Vergessen anheimfielen.