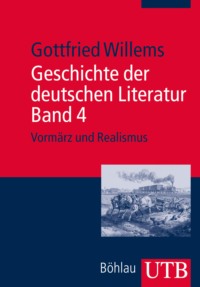Kitabı oku: «Geschichte der deutschen Literatur Band 4», sayfa 5
Die These vom Ende der Kunst
Hegel war es, der in seinen „Vorlesungen über die Ästhetik“ (1817–1829, aus Vorlesungsmitschriften 1835–1838 in Buchform herausgegeben) mit der These vom Ende der Kunst der Diskussion das entscheidende Stichwort geliefert hatte: „Uns gilt die Kunst nicht mehr als die höchste Weise, in welcher die Wahrheit sich Existenz verschafft“23 – ein Satz, der wie ein Menetekel über dem Kunstkult des 19. Jahrhunderts schwebt.24 Und Hegel hatte auch bereits die meisten der Argumente zusammengetragen, mit denen man sich an die Bearbeitung des Problems machte. Diese gehen zum Teil noch auf die „Querelle des Anciens et des Modernes“ zurück, in der die Aufklärer des 18. Jahrhunderts die Vorzüge und Nachteile der neuzeitlichen Kunst und Literatur im Vergleich mit dem Erbe der klassischen Antike herausgearbeitet hatten, und sodann vor allem auf die Theorie der Entfremdung, die Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) in das Selbstbild der Moderne eingebracht und die Friedrich Schiller (1759–1805) in seinen Abhandlungen „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ (1795) und „Über naive und sentimentalische Dichtung“ (1795/96) zu einer Grundlage der Theorie der modernen Kunst gemacht hatte.
Auf dieser Basis suchte die Ästhetik des 19. Jahrhunderts in immer neuen Anläufen zu zeigen, daß und warum die Kunst der Gegenwart keine Werke von klassischer Vollendung mehr zuwege bringen könne. Im Rahmen weitgespannter geschichtsphilosophischer Theorien wurde dargelegt, daß die Entwicklung der Menschheit an einem Punkt angelangt sei, an dem die Kunst weder einen Stoff, ein „Objekt“ mehr vorfände, noch über die „subjektiven“ Mittel mehr verfügte, die es [<<58] ihr erlauben würden, Bilder von wahrer Schönheit und von schöner Wahrheit zu schaffen.
Was den Stoff, das „Objekt“ anbelangt, so sollte der Fortschritt von „Kunst und Wissenschaft“ zu Lebensformen geführt haben, die zu weit von der Natur und dem „Naturschönen“ entfernt, zu künstlich, technisch, bürokratisch, zu kompliziert und unübersichtlich wären, um noch in eine künstlerische Darstellung eingeholt zu werden, die nicht immer wieder dem unpoetisch-prosaischen Grundcharakter der Verhältnisse Tribut zollen und ins Dröge verfallen müßte. Und was die „subjektiven“ Mittel, die Möglichkeiten der Kunst betrifft, einen solch widerspenstigen Stoff zu bewältigen, so sollte es um sie auch nicht viel besser bestellt sein. Denn gehörte das „Subjekt“, gehörte das Bewußtsein des Künstlers nicht ebenfalls diesen vertrackten Verhältnissen an, war es nicht immer schon von einer entsprechend hochgetriebenen, durch- und überreflektierten Bildung durchdrungen, so daß es nur noch mit Vorstellungen hantieren konnte, die für die Kunst bald zu abstrakt und bald zu speziell, bald zu theorielastig und bald zu einzelkrämerisch waren? Mochte die Kunst der Gegenwart dank des Fortschritts auch mehr und anderes wissen können als die der Vergangenheit – das machte ihre Werke allenfalls wahrer, aber keineswegs schöner. „Jeder Fortschritt der Cultur (ist heute) ein Rückschritt der Schönheit“ (Friedrich Theodor Vischer).25
Mit dieser Diagnose stellte die Ästhetik des 19. Jahrhunderts dem Fortschritt nun aber ein mehr als zwiespältiges Zeugnis aus. Die Verhältnisse sollten dem Menschen im Zuge der Modernisierung auf eine Weise über den Kopf gewachsen sein, die es ihm nicht mehr erlaubte, sich mit Hilfe seiner ästhetischen Vermögen als Person, als Individuum und Subjekt zu ihnen ins Verhältnis zu setzen, jedenfalls nicht in einer Form, die ihn vollends befriedigen könnte. Denn was heißt hier Schönheit? Es heißt, mit Eindrücken, mit Gegenständen oder der Darstellung von Gegenständen konfrontiert zu sein, die gefallen können, und zwar ganz und gar gefallen, an denen rein gar nichts auszusetzen ist und die insofern dazu angetan sind, ein Gefühl der Befriedigung, ja des Glücks zu verschaffen. Es heißt letztlich eine [<<59] Erfahrung zu machen, durch die man sich zumindest zeitweise im Einklang mit der Welt und mit sich selbst fühlen kann.
Eben solche Erfahrungen, solche „Schönheit“ sollte die Kunst nun nicht mehr vermitteln können, sie sollte keine Mittel und Wege mehr finden können, um der Überforderung durch eine immer komplizierter und unübersichtlicher werdende Welt Herr zu werden. Sie sollte allenfalls noch dem Gefühl der „Zerrissenheit“, des „Weltschmerzes“, dem „unglücklichen Bewußtsein“ (Hegel)26 Ausdruck verleihen können, das solche Überforderung mit sich brachte. Die Lage der Kunst so einzuschätzen, hieß aber nichts anderes, als die Frage zu stellen, ob der Prozeß der Modernisierung, soviel er auch in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens an Fortschritt gebracht haben mochte, die Menschen letztlich wirklich glücklicher machen würde. So wird von der Ästhetik aus deutlich, daß das Epigonenbewußtsein noch mehr und anderes war als nur der Preis, der für das Postulat einer Klassik und den Glauben an diese Klassik zu zahlen war, daß es auch so etwas wie der Selbstzweifel, um nicht zu sagen: das schlechte Gewissen des Fortschritts war.
Abrechnung mit den Epigonen an der Schwelle zur Moderne
Es dauerte lange, dauerte im Grunde bis in die späten achtziger Jahre, bis Kunst und Literatur aus dem Bann des Epigonenbewußtseins heraustraten. Erste Angriffe gab es allerdings schon in den siebziger Jahren. Hier sind vor allem Friedrich Nietzsche (1844–1900) und seine „Unzeitgemäßen Betrachtungen“ (1873–1876) zu nennen, und hier wiederum besonders die Abhandlung „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“. Da versucht sich Nietzsche an einer Generalabrechnung mit dem Historismus, insbesondere mit der Akademisierung der Bildung, die sich unter seinem Vorzeichen vollzogen hatte. In ihr will er die wichtigste Ursache für den Kleinmut der zeitgenössischen Kunst und Kultur erblicken. Und so fordert er die Jugend auf, rückhaltlos mit ihnen zu brechen, nicht mehr mit schülerhafter Ängstlichkeit auf die Klassiker zurückzuschauen, sondern den Blick nach vorne, in die Zukunft zu richten und dabei auf nichts anderes zu setzen als auf sich selbst und auf das Leben, das jeder immer schon in sich hat. Wenn die Jugend nur erst zu einem [<<60] solchen Wagnis bereit wäre, würde auch eine große, selbstbewußte neue Kunst nicht ausbleiben.
In einem Punkt gibt Nietzsche allerdings der Ästhetik Hegelscher Prägung indirekt Recht: er rechnet nicht mehr mit einer Kunst, die zugleich schön und wahr sein würde; Schönheit und Wahrheit würden in Zukunft getrennte Wege gehen müssen. Und so hat es die Jugend, die sich von Nietzsche zu einem Neuaufbruch in Kunst und Literatur inspirieren ließ, hat es die Generation der Symbolisten und Naturalisten, die in den achtziger Jahren die Bühne betrat, in der Tat auch gehalten. Während die Symbolisten ganz auf Schönheit ausgingen und nicht anstanden, sich dabei über all das hinwegzusetzen, was die moderne Welt um sie herum an Wahrheit ausbrütete, setzten die Naturalisten ganz auf Wahrheit, auch und gerade dann, wenn sie häßlich war.
Was immer Symbolisten und Naturalisten aber auch trennen mochte – darin waren sie sich einig, daß mit dem Epigonenbewußtsein ein für allemal Schluß sein sollte. So tritt der Naturalist Arno Holz (1863–1929) 1886 in der Einleitung zu seinen „Liedern eines Modernen“ mit der hochgemuten Erklärung vor sein Publikum, er wolle „unter allen Epigonen (…) der allerletzte“ sein,27 und so setzt sich der Symbolist Hugo von Hofmannsthal (1874–1929) 1891 in einem Sonett mit dem Titel „Epigonen“ von den Vorgängern mit den Worten ab: „Und richtend wird es euch entgegendröhnen: / Verfluchte Schar von Gegenwartsverächtern!“28 „Ihr möchtet wohl was Klassisches gern“, heißt es nun, „Allein vom Scheitel bis zum Fuße / Bin ich modern, modern, modern!“ (Otto Julius Bierbaum).29
Epigonenbewußtsein und Individualisierung
Damit sind wir am Ende des 19. Jahrhunderts, an der Schwelle zur Moderne im engeren und eigentlichen Sinne angelangt. Wenn wir von hier aus den Blick zu Immermann und dem Roman zurücklenken, mit dem er dem Epigonendiskurs das Stichwort gab, so können wir noch einen weiteren Grund für das Epigonenbewußtsein in Erfahrung [<<61] bringen, ein Moment, das für dessen Ausbildung womöglich eine noch größere Bedeutung hatte als der Historismus mit seiner Fixierung auf Klassiken und seinem latenten Zweifel am Fortschritt: die Individualisierung, wie sie überall mit der Modernisierung einhergeht, die Emanzipation des Individuums und die damit verbundene Aufwertung alles Individuellen, Persönlichen, Subjektiven.
Zunächst fällt auf, daß Immermanns Protagonisten dort, wo sie gegen ihre Umwelt und gegen sich selbst den Verdacht des Epigonentums erheben, gar nicht in erster Linie an die Kunst denken, an jenen Bereich der Kultur, in dem der Epigonendiskurs dann vor allem Platz gegriffen hat, daß sie vielmehr alle möglichen Aspekte des zeitgenössischen Lebens ins Visier nehmen, also auf das moderne Leben insgesamt zielen. Und sodann wird deutlich, welchen Maßstab sie anlegen, wenn sie sich und ihren Zeitgenossen attestieren, nurmehr ein Leben aus zweiter Hand zu führen, nur noch als „Nachhall eines andern selbständigen Geistes“ zu agieren und mit „entwendetem Tiefsinn“, „geraubtem Scharfblick“ und „geborgten Ideen“ zu wirtschaften, mit „Ideen“, die sie sich weder gründlich angeeignet noch vollends verstanden hätten und mit denen sie sich auch nicht wirklich identifizierten, so daß sich niemand mehr „in seinem Kreise zu Hause“ fühle. Es ist das Maß des authentischen Selbstseins, der Grundwert der Individualisierung; denn ein solches Leben aus zweiter Hand kann ja erst dort zu einem existentiellen Problem werden, wo das authentische Selbstsein die Qualität eines obersten Werts gewonnen hat.
Daß die Nachfolger Immermanns die Diagnose der epigonalen Existenz anders als Immermann selbst vor allem auf Kunst und Literatur bezogen haben, läßt sich freilich unschwer verstehen, wenn man sich die Geschichte der Individualisierung seit dem 18. Jahrhundert in Erinnerung ruft. Da zeigt sich nämlich, daß die Entfaltung des modernen Individualismus und die Entwicklung von Kunst und Literatur auf dem Weg in die Moderne von Anfang an aufs engste verknüpft waren. Kunst und Literatur waren der Raum, in dem sich die Gesellschaft der Individualisierung bewußt wurde, in dem sie sich erste Begriffe von ihr bildete und ihre Möglichkeiten und Grenzen erkundete. Und zugleich gestalteten sich Kunst und Literatur auf eine Weise um, durch die sie sich mehr und mehr zum Sprachrohr des Individuums machten, bemühten sie sich zunehmend um Formen, die es [<<62] ihnen erlauben würden, dem Leben des Einzelnen nachzugehen und die je eigene, besondere Perspektive dieses Einzelnen auf die Welt zur Darstellung zu bringen.
Der deutlichste Ausdruck dieses Wandels war die Forderung der Originalität. Das Kunstwerk sollte nun zunächst und vor allem originell sein; in seinen Themen und Formen sollte sich die je eigene, besondere Kreativität seines Autors, sollte sich eine durch und durch individualisierte Autorschaft bezeugen. Originalität galt als das Siegel des authentischen Selbstseins, und an solcher Authentizität war nun alles gelegen.
Dabei ist es übrigens bis heute weithin geblieben, trotz alles dessen, was die Wissenschaft dagegen meinte vorbringen zu müssen; auch heute noch will die Literatur ihren Beitrag zum kulturellen Leben wesentlich darin erkennen, daß sie mit originellen Inhalten und formalen Lösungen der Stimme des Einzelnen im alles beherrschenden Getöse der anonymen gesellschaftlichen Diskurse Gehör verschafft. Kein Wunder also, wenn Immermanns Leser bei der Rede vom Epigonentum vor allem an den Bereich der Kultur dachten, der auf dem Weg in die Moderne mehr und mehr zum Sachwalter des Individuums und seines Verlangens nach authentischem Selbstsein geworden war, an Kunst und Literatur.
2.3 Die Ambivalenz der Individualisierung
Daß die Literatur in erster Linie ein Sprachrohr des Individuums sei, daß sie mehr als jede andere Form kultureller Aktivität die Möglichkeit eröffne, das besondere Lebensgefühl und die je eigenen Erfahrungen, Ansichten und Probleme eines einzelnen Menschen zur Geltung zu bringen, und daß ein literarisches Kunstwerk demgemäß zunächst und vor allem ein authentischer Ausdruck von Individualität, eben „originell“ und keinesfalls „epigonal“ zu sein habe, ist eine Erwartung, die auf dem Weg in die Moderne mehr und mehr den Zugang zur Literatur bestimmt hat und die schließlich ins Zentrum der literarischen Kommunikation gerückt ist – wohlgemerkt: erst in der Moderne; es handelt sich um eine Vorstellung, die so erst seit dem 18. Jahrhundert mit der Literatur verknüpft wird. [<<63]
Das Individuum in der Literatur der Frühen Neuzeit
Davon kann man sich unschwer überzeugen, wenn man auf die vormoderne Literatur, etwa auf die Literatur der Frühen Neuzeit zurückblickt. Da zeigt sich, wie spät die Literatur erst zu einem Medium der Individualisierung geworden ist und daß sie zuvor vor allem die Aufgabe hatte, den Besitz einer Gesellschaft an Wahrem-Gutem-Schönem zu sichern, wie er sich wesentlich der Überlieferung verdankt, und dieses kollektive Gut dem Einzelnen nahezubringen.
Wenn es denn eine Zeit gab, in der die Autoren allen Grund gehabt hätten, gegen sich selbst den Verdacht des Epigonentums zu hegen, dann war es die Zeit des Humanismus und des Barock. Denn die Literatur hatte sich hier ganz der „imitatio veterum“, der „Nachahmung der Alten“ verschrieben. Die Autoren orientierten sich an Vorbildern der klassischen Antike und suchten in ihren Werken soviel wie möglich von dem Wissen und den ästhetischen Qualitäten ihrer antiken „Muster“ wiederzubringen. Und dennoch findet sich bei ihnen keine Spur von den Selbstzweifeln, mit denen das Epigonenbewußtsein die Autoren des 19. Jahrhunderts plagte – im Gegenteil: man konnte einem Autor keinen größeren Gefallen tun, als ihn einen zweiten Homer oder Vergil, einen zweiten Pindar oder Horaz, Euripides oder Seneca zu nennen.
Es fehlte hier eben noch der Maßstab des authentischen Selbstseins; man wußte noch nichts von Individualisierung. Natürlich waren die Menschen auch damals schon Individuen, aber sie lebten in einer Kultur, die nicht auf das Individuelle, sondern auf das Typische, auf kollektive Standards, und das heißt: auf Traditionen und Konventionen fokussiert war. Denn es war die Kultur einer Gesellschaft, die als eine Ständegesellschaft im Kern noch immer eine traditionale Gesellschaft war, die sich jedenfalls trotz alles dessen, was sie bereits an Modernisierungsschritten erlebte, noch immer als eine traditionale Gesellschaft begriff.
In einer solchen Gesellschaft ist das Leben des Einzelnen durch die Überlieferung vorgezeichnet; man lebt in dem Glauben und der Sitte der Väter. Wie sich der Lebensweg des Einzelnen gestaltet, ist in seinen Möglichkeiten durch seine Herkunft, durch den Stand vorherbestimmt, in den er hineingeboren ist. Wer von adligen Eltern abstammt, wird in der Regel das typische Leben eines Adligen führen, der Sohn eines Kaufmanns wird auch wieder ein Kaufmann werden, [<<64] der Sohn eines Handwerkers ein Handwerker, der eines Bauern ein Bauer oder ein Knecht, und jeder von ihnen wird sich dabei mit aller Selbstverständlichkeit an den Üblichkeiten seines Stands orientieren. Was wir heute Selbstverwirklichung nennen, ist hier weithin auf den Versuch begrenzt, die Möglichkeiten seines Stands auszuschöpfen und dabei dessen Standards gerecht zu werden. Ein individuelles Profil ergibt sich vor allem aus dem Grad, in dem das dem Einzelnen gelingt.
Die Literatur hat nun keineswegs dagegen Einspruch erhoben, wie man von heutigen Vorstellungen von Kunst aus annehmen möchte, hat es keineswegs als ihre ureigenste Aufgabe begriffen, im Namen des Individuums an dem Gefüge von Traditionen und Konventionen Kritik zu üben, das die Basis der Ständegesellschaft war – im Gegenteil: sie hat alles dafür getan, um dieses Gefüge zu sichern, erblickte sie in ihm doch einen Ausdruck der gottgegebenen Weltordnung, so wie es die zeitgenössische Theologie und Wissenschaft lehrten. Wie sie selbst aus der „Nachahmung der Alten“, aus dem Fundus der Überlieferung lebte, so wollte sie es ihren Lesern ermöglichen, ihr Leben am Leitfaden altehrwürdiger Traditionen und Konventionen zu gestalten. Demgemäß hat sie die Figuren, die sie zur Darstellung brachte, im allgemeinen vor der Folie durch die Tradition geheiligter idealtypischer Bilder der Stände entwickelt, hat sie sich überall darum bemüht, ihren Lesern an Tugendexempeln die konventionellen „Tugenden“ dieser Stände vorzurücken, und die individuelle Abweichung von solchen „Tugenden“ als „Laster“ gegeißelt.
Aufklärung und Individualisierung
Das änderte sich erst im 18. Jahrhundert, in der Zeit, in der die Modernisierung und mit ihr die meisten der politischen, sozialen, ökonomischen und kulturellen Entwicklungen Fahrt aufnahmen, die Immermann in seinen „Epigonen“ auf einem ersten Höhepunkt zeigt, und in der sich zugleich und in engem Zusammenhang damit eine Aufklärung formierte, die ihre vornehmste Aufgabe darin sah, dem Menschen die Emanzipation von der Autorität der Überlieferung zu ermöglichen. Die Modernisierung brauchte die Individualisierung, sie brauchte das „individualisierte Ich“ (Fritz Mauthner), das sich aus eigenem Antrieb und auf eigene Rechnung in Bewegung setzte, das mit neuen Ideen und originellen Vorhaben aus dem Gefüge der Traditionen und Konventionen ausbrach und damit eben die Dynamik in die Welt brachte, von der sie lebte. Kein Wunder also, wenn im [<<65] Zuge der Modernisierung die Spielräume für die Selbstverwirklichung, für das Zimmern eines Lebensgebäudes, das ganz auf die Bedürfnisse und Vorstellungen eines bestimmten Individuums zugeschnitten wäre, immer größer wurden.
In ebendiesem Sinne veränderte sich nun auch die Literatur. Sie verschrieb sich mehr und mehr der Individualisierung, und es dauerte nicht lange, bis sie sich an die Spitze der Bewegung gesetzt hatte und zur zentralen Plattform des Individualisierungsdiskurses geworden war. Das gelang ihr vor allem durch die Art und Weise, wie sie die antike Vorstellung vom Genie, von genialer Autorschaft zu neuerlicher Geltung brachte. Im Nachdenken über die „original composition“ (Edward Young) von Kunstwerken, über das „Originalgenie“ und seine „Originalwerke“ wurde erkundet, bis zu welchen Graden von Besonderheit, ja Absonderlichkeit sich die Individualisierung treiben ließe und wie gerade solche Besonderheit zur Quelle von Kreativität, zur Basis kultureller Produktivität zu werden vermöchte.30
Als typisch kann hier das Werk des Engländers Laurence Sterne (1713–1768) gelten, der mit verschiedenen Arbeiten, insbesondere mit dem Roman „The Life and Opinions of Tristram Shandy“ (1760–1767), den Inbegriff exzentrischer Individualität, den Spleen, also das genaue Gegenteil konventioneller ständischer „Tugend“, zu literarischen Ehren brachte. Solche Vorstöße in das Terrain individueller Besonderheit waren einer Gesellschaft mehr als willkommen, die sich anschickte, den Weg der Modernisierung einzuschlagen, wurden jedenfalls überall dort begrüßt, wo man sich der Modernisierung verschrieb, und das hat nicht wenig zu dem Aufstieg von Kunst und Literatur zu höchster gesellschaftlicher Wertschätzung beigetragen, der sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vollzog.
Rousseaus Philosophie der Selbstverwirklichung
Einen ersten Höhepunkt des Individualisierungsdiskurses bezeichnet das Werk von Jean-Jacques Rousseau. Rousseau verstand es, die verschiedenen Ansätze, die in den Diskussionen des 18. Jahrhunderts erprobt worden waren, auf eine Weise zusammenzuführen und zuzuspitzen, die ihnen die größtmögliche Wirkung verschaffte, eine [<<66] Wirkung, die bis heute angehalten hat. Wo immer seither die Sache des Individuums verhandelt wird, da ist auch Rousseaus Philosophie der Selbstverwirklichung nicht weit.
Rousseau war einer der ersten, die die neuen Begriffe von Individualität geradezu in den Mittelpunkt der Anthropologie rückten, die Vorstellung vom Menschen ganz auf den Begriff des Individuums gründeten. Für ihn ist der Mensch zunächst und vor allem ein Individuum und erst in zweiter Linie ein „zoon politikon“, ein soziales Wesen. Als Individuum kam er aus der Hand der Natur, um sich in der Frühphase der Menschheitsgeschichte, in den glücklichen Zeiten des Naturzustands ganz dem Leben eines Einzelgängers hinzugeben.
Erst der Prozeß der Zivilisation brachte ihn dann in dauerhafte soziale Zusammenhänge. Dafür hatte er freilich einen hohen Preis zu entrichten, den Preis einer immer engeren und festeren Einbindung in jenes Gefüge von Institutionen, Traditionen und Konventionen, in dem sich eine bürgerliche Gesellschaft konstituiert, einer Domestikation im Namen einer Unzahl von Regeln, Dogmen und Normen, die ihm mehr und mehr die Luft zum Atmen nahmen. Am Ende, in der Gegenwart Rousseaus, sollte er sich schließlich unter Verhältnissen wiederfinden, unter denen die Spielräume der Selbstverwirklichung auf ein Minimum geschrumpft wären, die kein authentisches Selbstsein mehr zuließen, Verhältnisse, zu deren Kennzeichnung Rousseau den Begriff der Entfremdung prägte. Dieses Bild steht zwar in Widerspruch zu allem, was wir über den Weg von der traditionalen zur modernen Gesellschaft wissen, doch kam es eben dem neuen Willen zum authentischen Selbstsein entgegen.
Mit dem Begriff der Entfremdung schuf Rousseau einen Kampfbegriff, der sich bald schon als eine besonders effektive Waffe im Dienst der Individualisierung bewähren sollte. Wo immer jemand auf dem Weg der Selbstverwirklichung an Grenzen stieß, da mußte er die Ursache nun nicht mehr bei sich selbst suchen, konnte er seine Mißerfolge mit Hilfe des Begriffs der „Entfremdung“ Fehlentwicklungen der Gesellschaft anlasten und Veränderungen einklagen, die ihm neue, weitere Spielräume eröffnen würden.
Goethe als „Befreier“ des Individuums
Auch in der deutschen Literatur hat die Individualisierung ihre entschiedenen Vorkämpfer gehabt. An erster Stelle ist hier Goethe zu nennen. Es gibt von Goethe einen späten Text, eine letzte Äußerung zu [<<67] poetologischen Fragen, die man geradezu sein literarisches Testament nennen könnte, den Aufsatz „Noch ein Wort für junge Dichter“ (1832), und da spricht er beim Rückblick auf sein Leben als Autor nicht etwa von seinem Beitrag zur Ausbildung einer klassischen deutschen Literatur, sondern einzig von seinem Einstehen für die Individualisierung. Ja die Rubrizierung als Klassiker wird von ihm hier wie auch früher schon ausdrücklich zurückgewiesen, weil sich die Vorstellung von klassischen Vorbildern für ihn nicht mit den Zielen der Individualisierung verträgt.
Denn was ist ein Klassiker? Es ist, mit dem Philosophen Kant zu reden, ein „Genie“, das „der Kunst die Regel gibt“,31 dessen Werke mithin für die, die nach ihm kommen, eine normative Bedeutung erlangen, in Worten Goethes: ein „Meister (…), unter dessen Anleitung wir uns in einer Kunst fortwährend üben und welcher uns (…) stufenweise die Grundsätze mitteilt, nach welchen handelnd wir das ersehnte Ziel am sichersten erreichen“.
In solchem Sinne war ich Meister von niemand. Wenn ich aber aussprechen soll, was ich den Deutschen überhaupt, insbesondere den jungen Dichtern geworden bin, so darf ich mich wohl ihren Befreier nennen; denn sie sind an mir gewahr geworden, daß, wie der Mensch von innen heraus leben, der Künstler von innen heraus wirken müsse, indem er, gebärde er sich wie er will, immer nur sein Individuum zutage fördern wird. (…) jeder (muß nur) sich selbst kennen lernen, weil hier kein fremder, äußerer Maßstab (z. B. ein klassisches Vorbild) zu Hülfe zu nehmen ist. (…) Zu (…) den jungen Dichtern sprech’ ich (…): Ihr habt jetzt eigentlich keine Norm, die müßt ihr euch selbst geben; fragt euch nur bei jedem Gedicht, ob es ein (selbst) Erlebtes enthalte und ob dieses Erlebte euch gefördert habe. (HA 12, 360–361)
Goethe hatte alles Recht, sich in diesem Sinne einen „Befreier“ zu nennen. Bereits bei seinen ersten Auftritten auf der Bühne der Literatur hatte er sich auf den Spuren seines Vorgängers und Vorbilds Rousseau für die Belange des Individuums stark gemacht, und er hatte dabei [<<68] Töne angeschlagen, wie sie bis dahin in der deutschen Literatur noch nicht zu hören gewesen waren. So wagte er sich in der frühen Rede „Zum Shakespeares-Tag“ (1771) mit Worten vor, die man geradezu eine Unabhängigkeitserklärung des Individuums nennen könnte:
Ich! Der ich mir alles bin, da ich alles nur durch mich kenne! So ruft jeder, der sich fühlt, und macht große Schritte durch dieses Leben (…). Auf die Reise, meine Herren! (HA 12, 224)
Und in der Hymne „Prometheus“ (1774) läßt er ein lyrisches Ich auftreten, das den Göttern als den obersten Autoritäten der Gesellschaft, als Inbegriff ihrer Traditionen und Konventionen, Dogmen und Normen mit den Worten den Kredit aufkündigt:
Hast du’s nicht alles selbst vollendet,
Heilig glühend Herz? (HA 1, 45)
Mit diesen und ähnlich markanten programmatischen Interventionen wurde Goethe zum Stichwortgeber und Wortführer einer Generation von Autoren, die die Sache des Individuums zu ihrem ureigensten Anliegen machte – ein Aufbruch zu neuen Ufern, der die Literatur nach und nach von Grund auf veränderte. Und auch einige der folgenreichsten literarischen Vorstöße in das neue Terrain gehen auf Goethe zurück. So hat er etwa mit den Sesenheimer Liedern und dem Wilhelm-Meister-Roman die lange Erfolgsgeschichte der beiden Gattungen begründet, die in besonderem Maße der Individualisierung Raum gaben, die des Erlebnisgedichts und des Entwicklungs- und Bildungsromans, zweier Gattungen, die seinerzeit durchaus neu, die jedenfalls ohne antikes Vorbild waren und die bald schon in den Mittelpunkt der literarischen Produktion rücken sollten. Im Erlebnisgedicht geht es um den authentischen Ausdruck von individuellem Erleben, und zwar so, daß die erlebnishafte Zuwendung zur Welt zugleich als ein Innewerden des Selbstseins begreiflich wird, als erlebnishafte Selbstvergewisserung eines durch und durch „individualisierten Ichs“. Und der Entwicklungs- und Bildungsroman dient nichts anderem als dem Versuch, das Drama der Selbstverwirklichung durchzuspielen und zu durchdenken. [<<69]
Die Gefahren der Individualisierung
Bei allem Engagement für die Sache des Individuums hat sich Goethe aber anders als Rousseau nie mit dem Propagieren der Individualisierung begnügt. Gerade weil ihm das Schicksal des Individuums ein besonderes Anliegen war, hat er nicht nur nach den Möglichkeiten, sondern auch nach den Grenzen der Individualisierung gefragt, hat er wie von ihren Chancen, so auch von ihren Gefahren gehandelt. Spätestens seit „Götz von Berlichingen“ (1773) und „Die Leiden des jungen Werthers“ (1774) hat er seinem Leser immer wieder vor Augen geführt, daß ein Individuum, das sich von den dogmatischen und normativen Fesseln der Gesellschaft freispricht und für autonom erklärt, über dem Versuch, sich ganz auf die eigenen Füße zu stellen, unweigerlich Gefahr laufe, die Fühlung mit der Wirklichkeit zu verlieren, aus allen natürlichen und sozialen Zusammenhängen herauszufallen und damit eben die Mit- und Gegenspieler, die Kontakt- und Reibungsflächen einzubüßen, ohne die so etwas wie Selbstverwirklichung nicht zu haben ist, mit dem Ergebnis, daß es ganz auf sich selbst zurückgeworfen werde, sich mehr und mehr in sich selbst verschließe und verrenne, um schließlich in der Weltlosigkeit seiner Isolation vollends nach innen, in sich selbst hinein abstürzen und in zwanghafter Beschäftigung mit sich selbst gleichsam in sich selbst zu verbrennen. Allein aus sich heraus – so Goethes Überzeugung – vermag niemand sich selbst zu gewinnen. Was als Selbstverwirklichung beginnt, ist immer in der Gefahr, als „Selbstentwirklichung“ zu enden – die Ambivalenz der Individualisierung.
In dieser Sicht der Dinge hat Goethe sich beim Blick auf die Generation von Autoren, die nach ihm kamen – die Generation von Jean Paul (1763–1825), Friedrich Hölderlin (1770–1843) und Heinrich von Kleist (1777–1811) – immer wieder bestätigt gefühlt. Denn das waren Autoren, für die die ersten Schritte in Richtung Individualisierung, die die Generation Goethes getan hatte, bereits eine pure Selbstverständlichkeit waren und die nun alles unternahmen, um ihnen weitere, noch radikalere Schritte folgen zu lassen. Goethe sah in ihren Arbeiten einen Subjektivismus sich Bahn brechen, der nichts von den Gefahren der Individualisierung wissen wollte, und so hat er alles versucht, um diese Autoren und ihre Leser wieder „aus sich heraus zu bringen“ und an das „Objekt“, die Realität, an die Natur und die real existierende [<<70] Gesellschaft zu verweisen, einschließlich des zivilisatorischen Erbes, der Institutionen, Traditionen und Konventionen, die die geschichtlich-gesellschaftliche Welt ausmachen.
Subjektivismus im Vormärz
So kam es, daß eine nächste Generation von Autoren, die Generation des Vormärz, Goethe gar nicht mehr mit dem Projekt der Individualisierung in Verbindung brachte, an dem er doch, wie „Noch ein Wort an die jungen Dichter“ zeigt, bis zuletzt mit großer Entschiedenheit festgehalten hatte, und daß sie eben um dieser Individualisierung willen – in Worten von Heine – eine „Insurrektion gegen Goethe“ startete. Was „neue frische Geister“ als „die schöne objektive Welt“ begriffen, die Goethe „durch Wort und Beispiel gestiftet“ habe, das „zivilisierte Goethentum“, sollte „über den Haufen (geworfen)“ werden, um „an dessen Stelle das Reich der wildesten Subjektivität (zu) begründen“; so Heine in einer Rezension von 1828 (HS 1, 455). Die Individualisierung sollte über Goethe hinaus und immer weiter vorangetrieben werden, und die Literatur sollte dabei weiterhin als ihre Speerspitze fungieren.