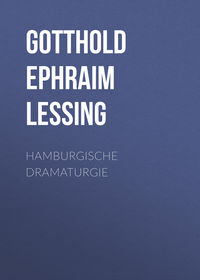Kitabı oku: «Hamburgische Dramaturgie», sayfa 28
Einundachtzigstes Stueck Den 9. Februar 1768
Will ich denn nun aber damit sagen, dass kein Franzose faehig sei, ein wirklich ruehrendes tragisches Werk zu machen? dass der volatile Geist der Nation einer solchen Arbeit nicht gewachsen sei?—Ich wuerde mich schaemen, wenn mir das nur eingekommen waere. Deutschland hat sich noch durch keinen Bouhours laecherlich gemacht. Und ich, fuer mein Teil, haette nun gleich die wenigste Anlage dazu. Denn ich bin sehr ueberzeugt, dass kein Volk in der Welt irgendeine Gabe des Geistes vorzueglich vor andern Voelkern erhalten habe. Man sagt zwar: der tiefsinnige Englaender, der witzige Franzose. Aber wer hat denn die Teilung gemacht? Die Natur gewiss nicht, die alles unter alle gleich verteilet. Es gibt ebensoviel witzige Englaender als witzige Franzosen, und ebensoviel tiefsinnige Franzosen, als tiefsinnige Englaender: der Prass von dem Volke aber ist keines von beidem.—
Was will ich denn? Ich will bloss sagen, was die Franzosen gar wohl haben koennten, dass sie das noch nicht haben: die wahre Tragoedie. Und warum noch nicht haben?—Dazu haette sich der Herr von Voltaire selbst besser kennen muessen, wenn er es haette treffen wollen.
Ich meine: sie haben es noch nicht; weil sie es schon lange gehabt zu haben glauben. Und in diesem Glauben werden sie nun freilich durch etwas bestaerkt, das sie vorzueglich vor allen Voelkern haben; aber es ist keine Gabe der Natur: durch ihre Eitelkeit.
Es geht mit den Nationen, wie mit einzelnen Menschen.—Gottsched (man wird leicht begreifen, wie ich eben hier auf diesen falle) galt in seiner Jugend fuer einen Dichter, weil man damals den Versmacher von dem Dichter noch nicht zu unterscheiden wusste. Philosophie und Kritik setzten nach und nach diesen Unterschied ins Helle: und wenn Gottsched mit dem Jahrhunderte nur haette fortgehen wollen, wenn sich seine Einsichten und sein Geschmack nur zugleich mit den Einsichten und dem Geschmacke seines Zeitalters haetten verbreiten und laeutern wollen: so haette er vielleicht wirklich aus dem Versmacher ein Dichter werden koennen. Aber da er sich schon so oft den groessten Dichter hatte nennen hoeren, da ihn seine Eitelkeit ueberredet hatte, dass er es sei: so unterblieb jenes. Er konnte unmoeglich erlangen, was er schon zu besitzen glaubte: und je aelter er ward, desto hartnaeckiger und unverschaemter ward er, sich in diesem traeumerischen Besitze zu behaupten.
Gerade so, duenkt mich, ist es den Franzosen ergangen. Kaum riss Corneille ihr Theater ein wenig aus der Barbarei: so glaubten sie es der Vollkommenheit schon ganz nahe. Racine schien ihnen die letzte Hand angelegt zu haben; und hierauf war gar nicht mehr die Frage (die es zwar auch nie gewesen), ob der tragische Dichter nicht noch pathetischer, noch ruehrender sein koenne, als Corneille und Racine, sondern dieses ward fuer unmoeglich angenommen, und alle Beeiferung der nachfolgenden Dichter musste sich darauf einschraenken, dem einen oder dem andern so aehnlich zu werden als moeglich. Hundert Jahre haben sie sich selbst, und zum Teil ihre Nachbarn mit, hintergangen: nun komme einer und sage ihnen das, und hoere, was sie antworten!
Von beiden aber ist es Corneille, welcher den meisten Schaden gestiftet und auf ihre tragischen Dichter den verderblichsten Einfluss gehabt hat. Denn Racine hat nur durch seine Muster verfuehrt; Corneille aber durch seine Muster und Lehren zugleich.
Diese letztern besonders, von der ganzen Nation (bis auf einen oder zwei Pedanten, einen Hedelin, einen Dacier, die aber oft selbst nicht wussten, was sie wollten) als Orakelsprueche angenommen, von allen nachherigen Dichtern befolgt: haben—ich getraue mich, es Stueck vor Stueck zu beweisen,—nichts anders, als das kahlste, waessrigste, untragischste Zeug hervorbringen koennen.
Die Regeln des Aristoteles sind alle auf die hoechste Wirkung der Tragoedie kalkuliert. Was macht aber Corneille damit? Er traegt sie falsch und schielend genug vor; und weil er sie doch noch viel zu strenge findet: so sucht er, bei einer nach der andern, quelque moderation, quelque favorable interpretation; entkraeftet und verstuemmelt, deutelt und vereitelt eine jede,—und warum? pour n'etre pas obliges de condamner beaucoup de poemes que nous avons vu reussir sur nos theatres; um nicht viele Gedichte verwerfen zu duerfen, die auf unsern Buehnen Beifall gefunden. Eine schoene Ursache!
Ich will die Hauptpunkte geschwind beruehren. Einige davon habe ich schon beruehrt; ich muss sie aber, des Zusammenhanges wegen, wiederum mitnehmen.
1. Aristoteles sagt: die Tragoedie soll Mitleid und Furcht erregen.– Corneille sagt: o ja, aber wie es koemmt; beides zugleich ist eben nicht immer noetig; wir sind auch mit einem zufrieden; itzt einmal Mitleid, ohne Furcht; ein andermal Furcht, ohne Mitleid. Denn wo blieb' ich, ich der grosse Corneille, sonst mit meinem Rodrigue und meiner Chimene? Die guten Kinder erwecken Mitleid; und sehr grosses Mitleid: aber Furcht wohl schwerlich. Und wiederum: wo blieb' ich sonst mit meiner Kleopatra, mit meinem Prusias, mit meinem Phokas? Wer kann Mitleid mit diesen Nichtswuerdigen haben? Aber Furcht erregen sie doch.—So glaubte Corneille: und die Franzosen glaubten es ihm nach.
2. Aristoteles sagt: die Tragoedie soll Mitleid und Furcht erregen; beides, versteht sich, durch eine und ebendieselbe Person.—Corneille sagt: wenn es sich so trifft, recht gut. Aber absolut notwendig ist es eben nicht; und man kann sich gar wohl auch verschiedener Personen bedienen, diese zwei Empfindungen hervorzubringen; so wie ich in meiner "Rodogune" getan habe.—Das hat Corneille getan: und die Franzosen tun es ihm nach.
3. Aristoteles sagt: durch das Mitleid und die Furcht, welche die Tragoedie erweckt, soll unser Mitleid und unsere Furcht, und was diesen anhaengig, gereiniget werden.—Corneille weiss davon gar nichts und bildet sich ein, Aristoteles habe sagen wollen. Die Tragoedie erwecke unser Mitleid, um unsere Furcht zu erwecken, um durch diese Furcht die Leidenschaften in uns zu reinigen, durch die sich der bemitleidete Gegenstand sein Unglueck zugezogen. Ich will von dem Werte dieser Absicht nicht sprechen: genug, dass es nicht die Aristotelische ist; und dass, da Corneille seinen Tragoedien eine ganz andere Absicht gab, auch notwendig seine Tragoedien selbst ganz andere Werke werden mussten, als die waren, von welchen Aristoteles seine Absicht abstrahieret hatte; es mussten Tragoedien werden, welches keine wahre Tragoedien waren. Und das sind nicht allein seine, sondern alle franzoesische Tragoedien geworden; weil ihre Verfasser alle nicht die Absicht des Aristoteles, sondern die Absicht des Corneille sich vorsetzten. Ich habe schon gesagt, dass Dacier beide Absichten wollte verbunden wissen: aber auch durch diese blosse Verbindung wird die erstere geschwaecht, und die Tragoedie muss unter ihrer hoechsten Wirkung bleiben. Dazu hatte Dacier, wie ich gezeigt, von der erstern nur einen sehr unvollstaendigen Begriff, und es war kein Wunder, wenn er sich daher einbildete, dass die franzoesischen Tragoedien seiner Zeit noch eher die erste, als die zweite Absicht erreichten. "Unsere Tragoedie", sagt er, "ist, zufolge jener, noch so ziemlich gluecklich, Mitleid und Furcht zu erwecken und zu reinigen. Aber diese gelingt ihr nur sehr selten, die doch gleichwohl die wichtigere ist, und sie reiniget die uebrigen Leidenschaften nur sehr wenig, oder da sie gemeiniglich nichts als Liebesintrigen enthaelt, wenn sie ja eine davon reinigte, so wuerde es einzig und allein die Liebe sein, woraus denn klar erhellet, dass ihr Nutzen nur sehr klein ist.126 Gerade umgekehrt! Es gibt noch eher franzoesische Tragoedien, welche der zweiten, als welche der ersten Absicht ein Genuege leisten. Ich kenne verschiedene franzoesische Stuecke, welche die ungluecklichen Folgen irgendeiner Leidenschaft recht wohl ins Licht setzen; aus denen man viele gute Lehren, diese Leidenschaft betreffend, ziehen kann: aber ich kenne keines, welches mein Mitleid in dem Grade erregte, in welchem die Tragoedie es erregen sollte, in welchem ich, aus verschiedenen griechischen und englischen Stuecken gewiss weiss, dass sie es erregen kann. Verschiedene franzoesische Tragoedien sind sehr feine, sehr unterrichtende Werke, die ich alles Lobes wert halte: nur, dass es keine Tragoedien sind. Die Verfasser derselben konnten nicht anders, als sehr gute Koepfe sein; sie verdienen, zum Teil, unter den Dichtern keinen geringen Rang: nur dass sie keine tragische Dichter sind; nur dass ihr Corneille und Racine, ihr Crebillon und Voltaire von dem wenig oder gar nichts haben, was den Sophokles zum Sophokles, den Euripides zum Euripides, den Shakespeare zum Shakespeare macht. Diese sind selten mit den wesentlichen Foderungen des Aristoteles im Widerspruch: aber jene desto oefterer. Denn nur weiter—
Zweiundachtzigstes Stueck Den 12. Februar 1768
4. Aristoteles sagt: man muss keinen ganz guten Mann, ohne alle sein Verschulden, in der Tragoedie ungluecklich werden lassen; denn so was sei graesslich.—"Ganz recht", sagt Corneille; "ein solcher Ausgang erweckt mehr Unwillen und Hass gegen den, welcher das Leiden verursacht, als Mitleid fuer den, welchen es trifft. Jene Empfindung also, welche nicht die eigentliche Wirkung der Tragoedie sein soll, wuerde, wenn sie nicht sehr fein behandelt waere, diese ersticken, die doch eigentlich hervorgebracht werden sollte. Der Zuschauer wuerde missvergnuegt weggehen, weil sich allzuviel Zorn mit dem Mitleiden vermischt, welches ihm gefallen haette, wenn er es allein mit wegnehmen koennen. Aber", koemmt Corneille hintennach; denn mit einem Aber muss er nachkommen—"aber, wenn diese Ursache wegfaellt, wenn es der Dichter so eingerichtet, dass der Tugendhafte, welcher leidet, mehr Mitleid fuer sich, als Widerwillen gegen den erweckt, der ihn leiden laesst: alsdenn?—Oh, alsdenn", sagt Corneille, "halte ich dafuer, darf man sich gar kein Bedenken machen, auch den tugendhaftesten Mann auf dem Theater im Ungluecke zu zeigen."127 —Ich begreife nicht, wie man gegen einen Philosophen so in den Tag hineinschwatzen kann; wie man sich das Ansehen geben kann, ihn zu verstehen, indem man ihn Dinge sagen laesst, an die er nie gedacht hat. Das gaenzlich unverschuldete Unglueck eines rechtschaffenen Mannes, sagt Aristoteles, ist kein Stoff fuer das Trauerspiel; denn es ist graesslich. Aus diesem Denn, aus dieser Ursache, macht Corneille ein Insofern, eine blosse Bedingung, unter welcher es tragisch zu sein aufhoert. Aristoteles sagt: es ist durchaus graesslich, und eben daher untragisch. Corneille aber sagt: es ist untragisch, insofern es graesslich ist. Dieses Graessliche findet Aristoteles in dieser Art des Unglueckes selbst: Corneille aber setzt es in den Unwillen, den es gegen den Urheber desselben verursacht. Er sieht nicht, oder will nicht sehen, dass jenes Graessliche ganz etwas anders ist als dieser Unwille; dass, wenn auch dieser ganz wegfaellt, jenes doch noch in seinem vollen Masse vorhanden sein kann: genug, dass vors erste mit diesem Quid pro quo verschiedene von seinen Stuecken gerechtfertiget scheinen, die er so wenig wider die Regeln des Aristoteles will gemacht haben, dass er vielmehr vermessen genug ist, sich einzubilden, es habe dem Aristoteles bloss an dergleichen Stuecken gefehlt, um seine Lehre darnach naeher einzuschraenken und verschiedene Manieren daraus zu abstrahieren, wie demohngeachtet das Unglueck des ganz rechtschaffenen Mannes ein tragischer Gegenstand werden koenne. En voici, sagt er, deux ou trois manieres que peut-etre Aristote n'a su prevoir, parce qu'on n'en voyait pas d'exemples sur les theatres de son temps. Und von wem sind diese Exempel? Von wem anders, als von ihm selbst? Und welches sind jene zwei oder drei Manieren? Wir wollen geschwind sehen.—"Die erste", sagt er, "ist, wenn ein sehr Tugendhafter durch einen sehr Lasterhaften verfolgt wird, der Gefahr aber entkoemmt, und so, dass der Lasterhafte sich selbst darin verstricket, wie es in der 'Rodogune' und im 'Heraklius' geschiehet, wo es ganz unertraeglich wuerde gewesen sein, wenn in dem ersten Stuecke Antiochus und Rodogune, und in dem andern Heraklius, Pulcheria und Martian umgekommen waeren, Kleopatra und Phokas aber triumphieret haetten. Das Unglueck der erstern erweckt ein Mitleid, welches durch den Abscheu, den wir wider ihre Verfolger haben, nicht erstickt wird, weil man bestaendig hofft, dass sich irgendein gluecklicher Zufall ereignen werde, der sie nicht unterliegen lasse." Das mag Corneille sonst jemanden weismachen, dass Aristoteles diese Manier nicht gekannt habe! Er hat sie so wohl gekannt, dass er sie, wo nicht gaenzlich verworfen, wenigstens mit ausdruecklichen Worten fuer angemessener der Komoedie als Tragoedie erklaert hat. Wie war es moeglich, dass Corneille dieses vergessen hatte? Aber so geht es allen, die im voraus ihre Sache zu der Sache der Wahrheit machen. Im Grunde gehoert diese Manier auch gar nicht zu dem vorhabenden Falle. Denn nach ihr wird der Tugendhafte nicht ungluecklich, sondern befindet sich nur auf dem Wege zum Ungluecke; welches gar wohl mitleidige Besorgnisse fuer ihn erregen kann, ohne graesslich zu sein.—Nun, die zweite Manier! "Auch kann es sich zutragen", sagt Corneille, "dass ein sehr tugendhafter Mann verfolgt wird, und auf Befehl eines andern umkoemmt, der nicht lasterhaft genug ist, unsern Unwillen allzusehr zu verdienen, indem er in der Verfolgung, die er wider den Tugendhaften betreibet, mehr Schwachheit als Bosheit zeiget. Wenn Felix seinen Eidam Polyeukt umkommen laesst, so ist es nicht aus wuetendem Eifer gegen die Christen, der ihn uns verabscheuungswuerdig machen wuerde, sondern bloss aus kriechender Furchtsamkeit, die sich nicht getrauet, ihn in Gegenwart des Severus zu retten, vor dessen Hasse und Rache er in Sorgen stehet. Man fasset also wohl einigen Unwillen gegen ihn, und missbilliget sein Verfahren; doch ueberwiegt dieser Unwille nicht das Mitleid, welches wir fuer den Polyeukt empfinden, und verhindert auch nicht, dass ihn seine wunderbare Bekehrung, zum Schlusse des Stuecks, nicht voellig wieder mit den Zuhoerern aussoehnen sollte." Tragische Stuemper, denke ich, hat es wohl zu allen Zeiten und selbst in Athen gegeben. Warum sollte es also dem Aristoteles an einem Stuecke von aehnlicher Einrichtung gefehlt haben, um daraus ebenso erleuchtet zu werden, als Corneille? Possen! Die furchtsamen, schwanken, unentschlossenen Charaktere, wie Felix, sind in dergleichen Stuecken ein Fehler mehr und machen sie noch obendarein ihrerseits kalt und ekel, ohne sie auf der andern Seite im geringsten weniger graesslich zu machen. Denn, wie gesagt, das Graessliche liegt nicht in dem Unwillen oder Abscheu, den sie erwecken: sondern in dem Ungluecke selbst, das jene unverschuldet trifft; das sie einmal so unverschuldet trifft als das andere, ihre Verfolger moegen boese oder schwach sein, moegen mit oder ohne Vorsatz ihnen so hart fallen. Der Gedanke ist an und fuer sich selbst graesslich, dass es Menschen geben kann, die ohne alle ihr Verschulden ungluecklich sind. Die Helden haetten diesen graesslichen Gedanken so weit von sich zu entfernen gesucht, als moeglich: und wir wollten ihn naehren? wir wollten uns an Schauspielen vergnuegen, die ihn bestaetigen? wir? die Religion und Vernunft ueberzeuget haben sollte, dass er ebenso unrichtig als gotteslaesterlich ist?—Das naemliche wuerde sicherlich auch gegen die dritte Manier gelten; wenn sie Corneille nicht selbst naeher anzugeben vergessen haette.
5. Auch gegen das, was Aristoteles von der Unschicklichkeit eines ganz Lasterhaften zum tragischen Helden sagt, als dessen Unglueck weder Mitleid noch Furcht erregen koenne, bringt Corneille seine Laeuterungen bei. Mitleid zwar, gesteht er zu, koenne er nicht erregen; aber Furcht allerdings. Denn ob sich schon keiner von den Zuschauern der Laster desselben faehig glaube, und folglich auch desselben ganzes Unglueck nicht zu befuerchten habe: so koenne doch ein jeder irgendeine jenen Lastern aehnliche Unvollkommenheit bei sich hegen und durch die Furcht vor den zwar proportionierten, aber doch noch immer ungluecklichen Folgen derselben, gegen sie auf seiner Hut zu sein lernen. Doch dieses gruendet sich auf den falschen Begriff, welchen Corneille von der Furcht und von der Reinigung der in der Tragoedie zu erweckenden Leidenschaften hatte, und widerspricht sich selbst. Denn ich habe schon gezeigt, dass die Erregung des Mitleids von der Erregung der Furcht unzertrennlich ist und dass der Boesewicht, wenn es moeglich waere, dass er unsere Furcht erregen koenne, auch notwendig unser Mitleid erregen muesste. Da er aber dieses, wie Corneille selbst zugesteht, nicht kann, so kann er auch jenes nicht und bleibt gaenzlich ungeschickt, die Absicht der Tragoedie erreichen zu helfen. Ja, Aristoteles haelt ihn hierzu noch fuer ungeschickter als den ganz tugendhaften Mann; denn er will ausdruecklich, falls man den Held aus der mittlere Gattung nicht haben koenne, dass man ihn eher besser als schlimmer waehlen solle. Die Ursache ist klar: ein Mensch kann sehr gut sein und doch noch mehr als eine Schwachheit haben, mehr als einen Fehler begehen, wodurch er sich in unabsehliches Unglueck stuerzet, das uns mit Mitleid und Wehmut erfuellet, ohne im geringsten graesslich zu sein, weil es die natuerliche Folge seines Fehlers ist.—Was Dubos128 von dem Gebrauche der lasterhaften Personen in der Tragoedie sagt, ist das nicht, was Corneille will. Dubos will sie nur zu den Nebenrollen erlauben, bloss zu Werkzeugen, die Hauptpersonen weniger schuldig zu machen; bloss zur Abstechung. Corneille aber will das vornehmste Interesse auf sie beruhen lassen, so wie in der "Rodogune": und das ist eigentlich, was mit der Absicht der Tragoedie streitet, und nicht jenes. Dubos merket dabei auch sehr richtig an, dass das Unglueck dieser subalternen Boesewichter keinen Eindruck auf uns mache. "Kaum", sagt er, "dass man den Tod des Narciss im Britannicus bemerkt." Aber also sollte sich der Dichter auch schon deswegen ihrer so viel als moeglich enthalten. Denn wenn ihr Unglueck die Absicht der Tragoedie nicht unmittelbar befoerdert, wenn sie blosse Hilfsmittel sind, durch die sie der Dichter desto besser mit andern Personen zu erreichen sucht: so ist es unstreitig, dass das Stueck noch besser sein wuerde, wenn es die naemliche Wirkung ohne sie haette. Je simpler eine Maschine ist, je weniger Federn und Raeder und Gewichte sie hat, desto vollkommener ist sie.
Dreiundachtzigstes Stueck Den 16. Februar 1768
6. Und endlich, die Missdeutung der ersten und wesentlichsten Eigenschaft, welche Aristoteles fuer die Sitten der tragischen Personen fodert! Sie sollen gut sein, die Sitten. "Gut?" sagt Corneille. "Wenn gut hier so viel als tugendhaft heissen soll: so wird es mit den meisten alten und neuen Tragoedien uebel aussehen, in welchen schlechte und lasterhafte, wenigstens mit einer Schwachheit, die naechst der Tugend so recht nicht bestehen kann, behaftete Personen genug vorkommen." Besonders ist ihm fuer seine Kleopatra in der "Rodogune" bange. Die Guete, welche Aristoteles fodert, will er also durchaus fuer keine moralische Guete gelten lassen; es muss eine andere Art von Guete sein, die sich mit dem moralisch Boesen ebensowohl vertraegt, als mit dem moralisch Guten. Gleichwohl meinet Aristoteles schlechterdings eine moralische Guete: nur dass ihm tugendhafte Personen, und Personen, welche in gewissen Umstaenden tugendhafte Sitten zeigen, nicht einerlei sind. Kurz, Corneille verbindet eine ganz falsche Idee mit dem Worte Sitten, und was die Proaeresis ist, durch welche allein, nach unserm Weltweisen, freie Handlungen zu guten oder boesen Sitten werden, hat er gar nicht verstanden. Ich kann mich itzt nicht in einen weitlaeuftigen Beweis einlassen; er laesst sich nur durch den Zusammenhang, durch die syllogistische Folge aller Ideen des griechischen Kunstrichters einleuchtend genug fuehren. Ich verspare ihn daher auf eine andere Gelegenheit, da es bei dieser ohnedem nur darauf ankoemmt, zu zeigen, was fuer einen ungluecklichen Ausweg Corneille, bei Verfehlung des richtigen Weges, ergriffen. Dieser Ausweg lief dahin: dass Aristoteles unter der Guete der Sitten den glaenzenden und erhabnen Charakter irgendeiner tugendhaften oder strafbaren Neigung verstehe, sowie sie der eingefuehrten Person entweder eigentuemlich zukomme oder ihr schicklich beigeleget werden koenne: le caractere brillant et eleve d'une habitude vertueuse ou criminelle, selon qu'elle est propre et convenable a la personne qu'on introduit. "Kleopatra in der 'Rodogune'", sagt er, "ist aeusserst boese: da ist kein Meuchelmord, vor dem sie sich scheue, wenn er sie nur auf dem Throne zu erhalten vermag, den sie allem in der Welt vorzieht; so heftig ist ihre Herrschsucht. Aber alle ihre Verbrechen sind mit einer gewissen Groesse der Seele verbunden, die so etwas Erhabenes hat, dass man, indem man ihre Handlungen verdammt, doch die Quelle, woraus sie entspringen, bewundern muss. Ebendieses getraue ich mir von dem 'Luegner' zu sagen. Das Luegen ist unstreitig eine lasterhafte Angewohnheit; allein Dorant bringt seine Luegen mit einer solchen Gegenwart des Geistes, mit so vieler Lebhaftigkeit vor, dass diese Unvollkommenheit ihm ordentlich wohl laesst und die Zuschauer gestehen muessen, dass die Gabe, so zu luegen, ein Laster sei, dessen kein Dummkopf faehig ist."—Wahrlich, einen verderblichern Einfall haette Corneille nicht haben koennen! Befolget ihn in der Ausfuehrung, und es ist um alle Wahrheit, um alle Taeuschung, um allen sittlichen Nutzen der Tragoedie getan! Denn die Tugend, die immer bescheiden und einfaeltig ist, wird durch jenen glaenzenden Charakter eitel und romantisch: das Laster aber mit einem Firnis ueberzogen, der uns ueberall blendet, wir moegen es aus einem Gesichtspunkte nehmen, aus welchem wir wollen. Torheit, bloss durch die ungluecklichen Folgen von dem Laster abschrecken wollen, indem man die innere Haesslichkeit desselben verbirgt! Die Folgen sind zufaellig; und die Erfahrung lehrt, dass sie ebensooft gluecklich als ungluecklich fallen. Dieses bezieht sich auf die Reinigung der Leidenschaften, wie sie Corneille sich dachte. Wie ich mir sie vorstelle, wie sie Aristoteles gelehrt hat, ist sie vollends nicht mit jenem truegerischen Glanze zu verbinden. Die falsche Folie, die so dem Laster untergelegt wird, macht, dass ich Vollkommenheiten erkenne, wo keine sind; macht, dass ich Mitleiden habe, wo ich keines haben sollte. Zwar hat schon Dacier dieser Erklaerung widersprochen, aber aus untriftigern Gruenden; und es fehlt nicht viel, dass die, welche er mit dem Pater Le Bossu dafuer annimmt, nicht ebenso nachteilig ist, wenigstens den poetischen Vollkommenheiten des Stuecks ebenso nachteilig werden kann. Er meinet naemlich, "die Sitten sollen gut sein", heisse nichts mehr als, sie sollen gut ausgedrueckt sein, qu'elles soient bien marquees. Das ist allerdings eine Regel, die, richtig verstanden, an ihrer Stelle aller Aufmerksamkeit des dramatischen Dichters wuerdig ist. Aber wenn es die franzoesischen Muster nur nicht bewiesen, dass man "gut ausdruecken" fuer stark ausdruecken genommen haette. Man hat den Ausdruck ueberladen, man hat Druck auf Druck gesetzt, bis aus charakterisierten Personen personifierte Charaktere; aus lasterhaften oder tugendhaften Menschen hagere Gerippe von Lastern und Tugenden geworden sind.—
Hier will ich diese Materie abbrechen. Wer ihr gewachsen ist, mag die Anwendung auf unsern "Richard" selbst machen.
Vom "Herzog Michel", welcher auf den "Richard" folgte, brauche ich wohl nichts zu sagen. Auf welchem Theater wird er nicht gespielt, und wer hat ihn nicht gesehen oder gelesen? Krueger hat indes das wenigste Verdienst darum; denn er ist ganz aus einer Erzaehlung in den Bremischen Beitraegen genommen. Die vielen guten satirischen Zuege, die er enthaelt, gehoeren jenem Dichter, sowie der ganze Verfolg der Fabel. Kruegern gehoert nichts, als die dramatische Form. Doch hat wirklich unsere Buehne an Kruegern viel verloren. Er hatte Talent zum Niedrig-Komischen, wie seine "Kandidaten" beweisen. Wo er aber ruehrend und edel sein will, ist er frostig und affektiert. Hr. Loewen hat seine Schriften gesammelt, unter welchen man jedoch "Die Geistlichen auf dem Lande" vermisst. Dieses war der erste dramatische Versuch, welchen Krueger wagte, als er noch auf dem Grauen Kloster in Berlin studierte.
Den neunundvierzigsten Abend (donnerstags, den 23. Julius) ward das Lustspiel des Hrn. von Voltaire "Die Frau, die recht hat" gespielt, und zum Beschlusse des L'Affichard "Ist er von Familie?"129 wiederholt.
"Die Frau, die recht hat" ist eines von den Stuecken, welche der Hr. von Voltaire fuer sein Haustheater gemacht hat. Dafuer war es nun auch gut genug. Es ist schon 1758 zu Carouge gespielt worden: aber noch nicht zu Paris; soviel ich weiss. Nicht als ob sie da, seit der Zeit, keine schlechtern Stuecke gespielt haetten: denn dafuer haben die Marins und Le Brets wohl gesorgt. Sondern weil—ich weiss selbst nicht. Denn ich wenigstens moechte doch noch lieber einen grossen Mann in seinem Schlafrocke und seiner Nachtmuetze, als einen Stuemper in seinem Feierkleide sehen.
Charaktere und Interesse hat das Stueck nicht; aber verschiedne Situationen, die komisch genug sind. Zwar ist auch das Komische aus dem allergemeinsten Fache, da es sich auf nichts als aufs Inkognito, auf Verkennungen und Missverstaendnisse gruendet. Doch die Lacher sind nicht ekel; am wenigsten wuerden es unsre deutschen Lacher sein, wenn ihnen das Fremde der Sitten und die elende Uebersetzung das mot pour rire nur nicht meistens so unverstaendlich machte.
Den funfzigsten Abend (freitags, den 24. Julius) ward Gressets "Sidney" wiederholt. Den Beschluss machte "Der sehende Blinde".
Dieses kleine Stueck ist vom Le Grand, und auch nicht von ihm. Denn er hat Titel und Intrige und alles einem alten Stuecke des De Brosse abgeborgt. Ein Offizier, schon etwas bei Jahren, will eine junge Witwe heiraten, in die er verliebt ist, als er Ordre bekoemmt, sich zur Armee zu verfuegen. Er verlaesst seine Versprochene mit den wechselseitigen Versicherungen der aufrichtigsten Zaertlichkeit. Kaum aber ist er weg, so nimmt die Witwe die Aufwartungen des Sohnes von diesem Offiziere an. Die Tochter desselben macht sich gleichergestalt die Abwesenheit ihres Vaters zunutze und nimmt einen jungen Menschen, den sie liebt, im Hause auf. Diese doppelte Intrige wird dem Vater gemeldet, der, um sich selbst davon zu ueberzeugen, ihnen schreiben laesst, dass er sein Gesicht verloren habe. Die List gelingt; er koemmt wieder nach Paris, und mit Hilfe eines Bedienten, der um den Betrug weiss, sieht er alles, was in seinem Hause vorgeht. Die Entwicklung laesst sich erraten; da der Offizier an der Unbestaendigkeit der Witwe nicht laenger zweifeln kann, so erlaubt er seinem Sohne, sie zu heiraten, und der Tochter gibt er die naemliche Erlaubnis, sich mit ihrem Geliebten zu verbinden. Die Szenen zwischen der Witwe und dem Sohn des Offiziers, in Gegenwart des letzten, haben viel Komisches; die Witwe versichert, dass ihr der Zufall des Offiziers sehr nahe gehe, dass sie ihn aber darum nicht weniger liebe; und zugleich gibt sie seinem Sohn, ihrem Liebhaber, einen Wink mit den Augen oder bezeugt ihm sonst ihre Zaertlichkeit durch Gebaerden. Das ist der Inhalt des alten Stueckes vom De Brosse,130 und ist auch der Inhalt von dem neuen Stuecke des Le Grand. Nur dass in diesem die Intrige mit der Tochter weggeblieben ist, um jene fuenf Akte desto leichter in einen zu bringen. Aus dem Vater ist ein Onkel geworden, und was sonst dergleichen kleine Veraenderungen mehr sind. Es mag endlich entstanden sein wie es will; gnug, es gefaellt sehr. Die Uebersetzung ist in Versen, und vielleicht eine von den besten, die wir haben; sie ist wenigstens sehr fliessend und hat viele drollige Zeilen.