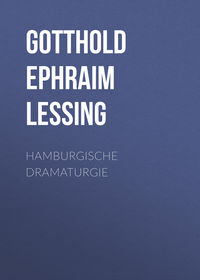Kitabı oku: «Hamburgische Dramaturgie», sayfa 30
Siebenundachtzig-und achtundachtzigstes Stueck Den 4. Maerz 1768
Und so sind andere Anmerkungen des Palissot mehr, wenn nicht ganz richtig, doch auch nicht ganz falsch. Er sieht den Ring, in den er mit seiner Lanze stossen will, scharf genug; aber in der Hitze des Ansprengens verrueckt die Lanze, und er stoesst den Ring gerade vorbei.
So sagt er ueber den "Natuerlichen Sohn" unter andern: "Welch ein seltsamer Titel! der natuerliche Sohn! Warum heisst das Stueck so? Welchen Einfluss hat die Geburt des Dorval? Was fuer einen Vorfall veranlasst sie? Zu welcher Situation gibt sie Gelegenheit? Welche Luecke fuellt sie auch nur? Was kann also die Absicht des Verfassers dabei gewesen sein? Ein paar Betrachtungen ueber das Vorurteil gegen die uneheliche Geburt aufzuwaermen? Welcher vernuenftige Mensch weiss denn nicht von selbst, wie ungerecht ein solches Vorurteil ist?"
Wenn Diderot hierauf antwortete: Dieser Umstand war allerdings zur Verwickelung meiner Fabel noetig; ohne ihn wuerde es weit unwahrscheinlicher gewesen sein, dass Dorval seine Schwester nicht kennet und seine Schwester von keinem Bruder weiss; es stand mir frei, den Titel davon zu entlehnen, und ich haette den Titel von noch einem geringern Umstande entlehnen koennen. —Wenn Diderot dieses antwortete, sag' ich, waere Palissot nicht ungefaehr widerlegt?
Gleichwohl ist der Charakter des natuerlichen Sohnes einem ganz andern Einwurfe blossgestellet, mit welchem Palissot dem Dichter weit schaerfer haette zusetzen koennen. Diesem naemlich: dass der Umstand der unehelichen Geburt und der daraus erfolgten Verlassenheit und Absonderung, in welcher sich Dorval von allen Menschen so viele Jahre hindurch sahe, ein viel zu eigentuemlicher und besonderer Umstand ist, gleichwohl auf die Bildung seines Charakters viel zuviel Einfluss gehabt hat, als dass dieser diejenige Allgemeinheit haben koenne, welche nach der eignen Lehre des Diderot ein komischer Charakter notwendig haben muss.—Die Gelegenheit reizt mich zu einer Ausschweifung ueber diese Lehre: und welchem Reize von der Art brauchte ich in einer solchen Schrift zu widerstehen?
"Die komische Gattung", sagt Diderot,135 "hat Arten, und die tragische hat Individua. Ich will mich erklaeren. Der Held einer Tragoedie ist der und der Mensch. es ist Regulus, oder Brutus, oder Cato, und sonst kein anderer. Die vornehmste Person einer Komoedie hingegen muss eine grosse Anzahl von Menschen vorstellen. Gaebe man ihr von ohngefaehr eine so eigene Physiognomie, dass ihr nur ein einziges Individuum aehnlich waere, so wuerde die Komoedie wieder in ihre Kindheit zuruecktreten.—Terenz scheinet mir einmal in diesen Fehler gefallen zu sein. Sein Heautontimorumenos ist ein Vater, der sich ueber den gewaltsamen Entschluss graemet, zu welchem er seinen Sohn durch uebermaessige Strenge gebracht hat, und der sich deswegen nun selbst bestraft, indem er sich in Kleidung und Speise kuemmerlich haelt, allen Umgang fliehet, sein Gesinde abschafft und das Feld mit eigenen Haenden bauet. Man kann gar wohl sagen, dass es so einen Vater nicht gibt. Die groesste Stadt wuerde kaum in einem ganzen Jahrhunderte ein Beispiel einer so seltsamen Betruebnis aufzuweisen haben."
Zuerst von der Instanz des "Heautontimorumenos". Wenn dieser Charakter wirklich zu tadeln ist: so trifft der Tadel nicht sowohl den Terenz, als den Menander. Menander war der Schoepfer desselben, der ihn, allem Ansehen nach, in seinem Stuecke noch weit ausfuehrlichere Rolle spielen lassen, als er in der Kopie des Terenz spielet, in der sich seine Sphaere, wegen der verdoppelten Intrige, wohl sehr einziehen muessen.136 Aber dass er von Menandern herruehrt, dieses allein schon haette, mich wenigstens, abgeschreckt, den Terenz desfalls zu verdammen. Das [Greek: o Menandre kai bie, poteros ar' ymon poteron emimaesato]; ist zwar frostiger, als witzig gesagt: doch wuerde man es wohl ueberhaupt von einem Dichter gesagt haben, der Charaktere zu schildern imstande waere, wovon sich in der groessten Stadt kaum in einem ganzen Jahrhunderte ein einziges Beispiel zeiget? Zwar in hundert und mehr Stuecken koennte ihm auch wohl ein solcher Charakter entfallen sein. Der fruchtbarste Kopf schreibt sich leer; und wenn die Einbildungskraft sich keiner wirklichen Gegenstaende der Nachahmung mehr erinnern kann, so komponiert sie deren selbst, welches denn freilich meistens Karikaturen werden. Dazu will Diderot bemerkt haben, dass schon Horaz, der einen so besonders zaertlichen Geschmack hatte, den Fehler, wovon die Rede ist, eingesehen und im Vorbeigehen, aber fast unmerklich, getadelt habe.
Die Stelle soll die in der zweiten Satire des ersten Buchs sein, wo Horaz zeigen will, "dass die Narren aus einer Uebertreibung in die andere entgegengesetzte zu fallen pflegen. Fufidius", sagt er, "fuerchtet fuer einen Verschwender gehalten zu werden. Wisst ihr, was er tut? Er leihet monatlich fuer fuenf Prozent und macht sich im voraus bezahlt. Je noetiger der andere das Geld braucht, desto mehr fodert er. Er weiss die Namen aller jungen Leute, die von gutem Hause sind und itzt in die Welt treten, dabei aber ueber harte Vaeter zu klagen haben. Vielleicht aber glaubt ihr, dass dieser Mensch wieder einen Aufwand mache, der seinen Einkuenften entspricht? Weit gefehlt! Er ist sein grausamster Feind, und der Vater in der Komoedie, der sich wegen der Entweichung seines Sohnes bestraft, kann sich nicht schlechter quaelen: non se pejus cruciaverit."—Dieses schlechter, dieses pejus, will Diderot, soll hier einen doppelten Sinn haben; einmal soll es auf den Fufidius, und einmal auf den Terenz gehen; dergleichen beilaeufige Hiebe, meinet er, waeren dem Charakter des Horaz vollkommen gemaess.
Das letzte kann sein, ohne sich auf die vorhabende Stelle anwenden zu lassen. Denn hier, duenkt mich, wuerde die beilaeufige Anspielung dem Hauptverstande nachteilig werden. Fufidius ist kein so grosser Narr, wenn es mehr solche Narren gibt. Wenn sich der Vater des Terenz ebenso abgeschmackt peinigte, wenn er ebensowenig Ursache haette, sich zu peinigen, als Fufidius, so teilt er das Laecherliche mit ihm, und Fufidius ist weniger seltsam und abgeschmackt. Nur alsdenn, wenn Fufidius, ohne alle Ursache, ebenso hart und grausam gegen sich selbst ist, als der Vater des Terenz mit Ursache ist, wenn jener aus schmutzigem Geize tut, was dieser aus Reu und Betruebnis tat: nur alsdenn wird uns jener unendlich laecherlicher und veraechtlicher, als mitleidswuerdig wir diesen finden.
Und allerdings ist jede grosse Betruebnis von der Art, wie die Betruebnis dieses Vaters: die sich nicht selbst vergisst, die peiniget sich selbst. Es ist wider alle Erfahrung, dass kaum alle hundert Jahre sich ein Beispiel einer solchen Betruebnis finde: vielmehr handelt jede ungefaehr ebenso; nur mehr oder weniger, mit dieser oder jener Veraenderung. Cicero hatte auf die Natur der Betruebnis genauer gemerkt; er sahe daher in dem Betragen des Heautontimorumenos nichts mehr, als was alle Betruebte, nicht bloss von dem Affekte hingerissen, tun, sondern auch bei kaelterm Gebluete fortsetzen zu muessen glauben.137 Haec omnia recta, vera, debita putantes, faciunt in dolore: maximeque declaratur, hoc quasi officii judicio fieri, quod si qui forte, cum se in luctu esse vellent, aliquid fecerunt humanius, aut si hilarius locuti essent, revocant se rursus ad moestitiam, peccatique se insimulant, quod dolere intermiserint: pueros vero matres et magistri castigare etiam solent, nec verbis solum, sed etiam verberibus, si quid in domestico luctu hilarius ab iis factum est, aut dictum: plorare cogunt.—Quid ille Terentianus ipse se puniens? usw.
Menedemus aber, so heisst der Selbstpeiniger bei dem Terenz, haelt sich nicht allein so hart aus Betruebnis; sondern, warum er sich auch jeden geringen Aufwand verweigert, ist die Ursache und Absicht vornehmlich dieses: um desto mehr fuer den abwesenden Sohn zu sparen und dem einmal ein desto gemaechlicheres Leben zu versichern, den er itzt gezwungen, ein so ungemaechliches zu ergreifen. Was ist hierin, was nicht hundert Vaeter tun wuerden? Meint aber Diderot, dass das Eigene und Seltsame darin bestehe, dass Menedemus selbst hackt, selbst graebt, selbst ackert: so hat er wohl in der Eil' mehr an unsere neuere, als an die alten Sitten gedacht. Ein reicher Vater itziger Zeit wuerde das freilich nicht so leicht tun: denn die wenigsten wuerden es zu tun verstehen. Aber die wohlhabensten, vornehmsten Roemer und Griechen waren mit allen laendlichen Arbeiten bekannter und schaemten sich nicht, selbst Hand anzulegen.
Doch alles sei, vollkommen wie es Diderot sagt! Der Charakter des Selbstpeinigers sei wegen des Allzueigentuemlichen, wegen dieser ihm fast nur allein zukommenden Falte, zu einem komischen Charakter so ungeschickt, als er nur will. Waere Diderot nicht in eben den Fehler gefallen? Denn was kann eigentuemlicher sein, als der Charakter seines Dorval? Welcher Charakter kann mehr eine Falte haben, die ihm nur allein zukoemmt, als der Charakter dieses natuerlichen Sohnes? "Gleich nach meiner Geburt", laesst er ihn von sich selbst sagen, "ward ich an einen Ort verschleudert, der die Grenze zwischen Einoede und Gesellschaft heissen kann; und als ich die Augen auftat, mich nach den Banden umzusehen, die mich mit den Menschen verknuepften, konnte ich kaum einige Truemmern davon erblicken. Dreissig Jahre lang irrte ich unter ihnen einsam, unbekannt und verabsaeumet umher, ohne die Zaertlichkeit irgendeines Menschen empfunden, noch irgendeinen Menschen angetroffen zu haben, der die meinige gesucht haette." Dass ein natuerliches Kind sich vergebens nach seinen Eltern, vergebens nach Personen umsehen kann, mit welchen es die naehern Bande des Bluts verknuepfen: das ist sehr begreiflich; das kann unter zehnen neunen begegnen. Aber dass es ganze dreissig Jahre in der Welt herumirren koenne, ohne die Zaertlichkeit irgendeines Menschen empfunden zu haben, ohne irgendeinen Menschen angetroffen zu haben, der die seinige gesucht haette: das, sollte ich fast sagen, ist schlechterdings unmoeglich. Oder wenn es moeglich waere, welche Menge ganz besonderer Umstaende muessten von beiden Seiten, von seiten der Welt und von seiten dieses so lange insulierten Wesens zusammengekommen sein, diese traurige Moeglichkeit wirklich zu machen? Jahrhunderte auf Jahrhunderte werden verfliessen, ehe sie wieder einmal wirklich wird. Wolle der Himmel nicht, dass ich mir je das menschliche Geschlecht anders vorstelle! Lieber wuenschte ich sonst, ein Baer geboren zu sein, als ein Mensch. Nein, kein Mensch kann unter Menschen so lange verlassen sein! Man schleudere ihn hin, wohin man will: wenn er noch unter Menschen faellt, so faellt er unter Wesen, die, ehe er sich umgesehen, wo er ist, auf allen Seiten bereit stehen, sich an ihn anzuketten. Sind es nicht vornehme, so sind es geringe! Sind es nicht glueckliche, so sind es unglueckliche Menschen! Menschen sind es doch immer. So wie ein Tropfen nur die Flaeche des Wassers beruehren darf, um von ihm aufgenommen zu werden und ganz in ihm zu verfliessen: das Wasser heisse, wie es will, Lache oder Quelle, Strom oder See, Belt oder Ozean.
Gleichwohl soll diese dreissigjaehrige Einsamkeit unter den Menschen den Charakter des Dorval gebildet haben. Welcher Charakter kann ihm nun aehnlich sehen? Wer kann sich in ihm erkennen? nur zum kleinsten Teil in ihm erkennen?
Eine Ausflucht, finde ich doch, hat sich Diderot auszusparen gesucht. Er sagt in dem Verfolge der angezogenen Stelle: "In der ernsthaften Gattung werden die Charaktere oft ebenso allgemein sein, als in der komischen Gattung; sie werden aber allezeit weniger individuell sein, als in der tragischen." Er wuerde sonach antworten: Der Charakter des Dorval ist kein komischer Charakter; er ist ein Charakter, wie ihn das ernsthafte Schauspiel erfodert; wie dieses den Raum zwischen Komoedie und Tragoedie fuellen soll, so muessen auch die Charaktere desselben das Mittel zwischen den komischen und tragischen Charakteren halten; sie brauchen nicht so allgemein zu sein als jene, wenn sie nur nicht so voellig individuell sind, als diese; und solcher Art duerfte doch wohl der Charakter des Dorval sein.
Also waeren wir gluecklich wieder an dem Punkte, von welchem wir ausgingen. Wir wollten untersuchen, ob es wahr sei, dass die Tragoedie Individua, die Komoedie aber Arten habe: das ist, ob es wahr sei, dass die Personen der Komoedie eine grosse Anzahl von Menschen fassen und zugleich vorstellen muessten; dahingegen der Held der Tragoedie nur der und der Mensch, nur Regulus oder Brutus oder Cato sei und sein solle. Ist es wahr, so hat auch das, was Diderot von den Personen der mittlern Gattung sagt, die er die ernsthafte Komoedie nennt, keine Schwierigkeit, und der Charakter seines Dorval waere so tadelhaft nicht. Ist es aber nicht wahr, so faellt auch dieses von selbst weg, und dem Charakter des natuerlichen Sohnes kann aus einer so ungegruendeten Einteilung keine Rechtfertigung zufliessen.
Neunundachtzigstes Stueck Den 8. Maerz 1768
Zuerst muss ich anmerken, dass Diderot seine Assertion ohne allen Beweis gelassen hat. Er muss sie fuer eine Wahrheit angesehen haben, die kein Mensch in Zweifel ziehen werde, noch koenne; die man nur denken duerfe, um ihren Grund zugleich mitzudenken. Und sollte er den wohl gar in den wahren Namen der tragischen Personen gefunden haben? Weil diese Achilles und Alexander und Cato und Augustus heissen und Achilles, Alexander, Cato, Augustus wirkliche einzelne Personen gewesen sind: sollte er wohl daraus geschlossen haben, dass sonach alles, was der Dichter in der Tragoedie sie sprechen und handeln laesst, auch nur diesen einzeln so genannten Personen, und keinem in der Welt zugleich mit, muesse zukommen koennen? Fast scheint es so. Aber diesen Irrtum hatte Aristoteles schon vor zweitausend Jahren widerlegt und auf die ihr entgegenstehende Wahrheit den wesentlichen Unterschied zwischen der Geschichte und Poesie, sowie den groessern Nutzen der letztern vor der ersten gegruendet. Auch hat er es auf eine so einleuchtende Art getan, dass ich nur seine Worte anfuehren darf, um keine geringe Verwunderung zu erwecken, wie in einer so offenbaren Sache ein Diderot nicht gleicher Meinung mit ihm sein koenne.
"Aus diesen also", sagt Aristoteles,138 nachdem er die wesentlichen Eigenschaften der poetischen Fabel festgesetzt, "aus diesen also erhellet klar, dass des Dichters Werk nicht ist, zu erzaehlen, was geschehen, sondern zu erzaehlen, von welcher Beschaffenheit das Geschehene und was nach der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit dabei moeglich gewesen. Denn Geschichtschreiber und Dichter unterscheiden sich nicht durch die gebundene oder ungebundene Rede: indem man die Buecher des Herodotus in gebundene Rede bringen kann und sie darum doch nichts weniger in gebundener Rede eine Geschichte sein werden, als sie es in ungebundener waren. Sondern darin unterscheiden sie sich, dass jener erzaehlet, was geschehen; dieser aber, von welcher Beschaffenheit das Geschehene gewesen. Daher ist denn auch die Poesie philosophischer und nuetzlicher als die Geschichte. Denn die Poesie geht mehr auf das Allgemeine, und die Geschichte auf das Besondere. Das Allgemeine aber ist, wie so oder so ein Mann nach der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit sprechen und handeln wuerde; als worauf die Dichtkunst bei Erteilung der Namen sieht. Das Besondere hingegen ist, was Alcibiades getan oder gelitten hat. Bei der Komoedie nun hat sich dieses schon ganz offenbar gezeigt; denn wenn die Fabel nach der Wahrscheinlichkeit abgefasst ist, legt man die etwanigen Namen sonach bei und macht es nicht wie die jambischen Dichter, die bei dem Einzeln bleiben. Bei der Tragoedie aber haelt man sich an die schon vorhandenen Namen; aus Ursache, weil das Moegliche glaubwuerdig ist und wir nicht moeglich glauben, was nie geschehen, dahingegen was geschehen offenbar moeglich sein muss, weil es nicht geschehen waere, wenn es nicht moeglich waere. Und doch sind auch in den Tragoedien, in einigen nur ein oder zwei bekannte Namen, und die uebrigen sind erdichtet; in einigen auch gar keiner, so wie in der >Blume< des Agathon. Denn in diesem Stuecke sind Handlungen und Namen gleich erdichtet, und doch gefaellt es darum nichts weniger."
In dieser Stelle, die ich nach meiner eigenen Uebersetzung anfuehre, mit welcher ich so genau bei den Worten geblieben bin, als moeglich, sind verschiedene Dinge, welche von den Auslegern, die ich noch zu Rate ziehen koennen, entweder gar nicht oder falsch verstanden worden. Was davon hier zur Sache gehoert, muss ich mitnehmen.
Das ist unwidersprechlich, dass Aristoteles schlechterdings keinen Unterschied zwischen den Personen der Tragoedie und Komoedie, in Ansehung ihrer Allgemeinheit, macht. Die einen sowohl als die andern, und selbst die Personen der Epopee nicht ausgeschlossen, alle Personen der poetischen Nachahmung ohne Unterschied, sollen sprechen und handeln, nicht wie es ihnen einzig und allein zukommen koennte, sondern so wie ein jeder von ihrer Beschaffenheit in den naemlichen Umstaenden sprechen oder handeln wuerde und muesste. In diesem [Greek: katholou], in dieser Allgemeinheit liegt allein der Grund, warum die Poesie philosophischer und folglich lehrreicher ist als die Geschichte; und wenn es wahr ist, dass derjenige komische Dichter, welcher seinen Personen so eigene Physiognomien geben wollte, dass ihnen nur ein einziges Individuum in der Welt aehnlich waere, die Komoedie, wie Diderot sagt, wiederum in ihre Kindheit zuruecksetzen und in Satire verkehren wuerde: so ist es auch ebenso wahr, dass derjenige tragische Dichter, welcher nur den und den Menschen, nur den Caesar, nur den Cato, nach allen den Eigentuemlichkeiten, die wir von ihnen wissen, vorstellen wollte, ohne zugleich zu zeigen, wie alle diese Eigentuemlichkeiten mit dem Charakter des Caesar und Cato zusammengehangen, der ihnen mit mehrern kann gemein sein, dass, sage ich, dieser die Tragoedie entkraeften und zur Geschichte erniedrigen wuerde.
Aber Aristoteles sagt auch, dass die Poesie auf dieses Allgemeine der Personen mit den Namen, die sie ihnen erteile, ziele ([Greek: ou stochazetai ae poiaesis onomata epitithemenae]); welches sich besonders bei der Komoedie deutlich gezeigt habe. Und dieses ist es, was die Ausleger dem Aristoteles nachzusagen sich begnuegt, im geringsten aber nicht erlaeutert haben. Wohl aber haben verschiedene sich so darueber ausgedrueckt, dass man klar sieht, sie muessen entweder nichts, oder etwas ganz Falsches dabei gedacht haben. Die Frage ist: wie sieht die Poesie, wenn sie ihren Personen Namen erteilt, auf das Allgemeine dieser Personen? und wie ist diese ihre Ruecksicht auf das Allgemeine der Person, besonders bei der Komoedie, schon laengst sichtbar gewesen?
Die Worte: [Greek: esti de katholou men, to poio ta poi atta symbainei legein, ae prattein kata to eikos, ae io anankaion, ou stochazetai ae poiaesis onomata epitithemenae], uebersetzt Dacier: Une chose generale, c'est ce que tout homme d'un tel ou d'un tel caractere a du dire, ou faire vraisemblablement ou necessairement, ce qui est le but de la poesie lors meme, qu'elle impose les noms a ses personnages. Vollkommen so uebersetzt sie auch Herr Curtius: "Das Allgemeine ist, was einer, vermoege eines gewissen Charakters, nach der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit redet oder tut. Dieses Allgemeine ist der Endzweck der Dichtkunst, auch wenn sie den Personen besondere Namen beilegt.—Auch in ihrer Anmerkung ueber diese Worte stehen beide fuer einen Mann; der eine sagt vollkommen eben das, was der andere sagt. Sie erklaeren beide, was das Allgemeine ist; sie sagen beide, dass dieses Allgemeine die Absicht der Poesie sei: aber wie die Poesie bei Erteilung der Namen auf dieses Allgemeine sieht, davon sagt keiner ein Wort. Vielmehr zeigt der Franzose durch sein lors meme, sowie der Deutsche durch sein auch wenn, offenbar, dass sie nichts davon zu sagen gewusst, ja, dass sie gar nicht einmal verstanden, was Aristoteles sagen wollen. Denn dieses lors meme, dieses auch wenn, heisst bei ihnen nichts mehr als ob schon; und sie lassen den Aristoteles sonach bloss sagen, dass ungeachtet die Poesie ihren Personen Namen von einzeln Personen beilege, sie demohngeachtet nicht auf das Einzelne dieser Personen, sondern auf das Allgemeine derselben gehe. Die Worte des Dacier, die ich in der Note anfuehren will,139 zeigen dieses deutlich. Nun ist es wahr, dass dieses eigentlich keinen falschen Sinn macht; aber es erschoepft doch auch den Sinn des Aristoteles hier nicht. Nicht genug, dass die Poesie, ungeachtet der von einzeln Personen genommenen Namen, auf das Allgemeine gehen kann: Aristoteles sagt, dass sie mit diesen Namen selbst auf das Allgemeine ziele, [Greek: ou stochazetai]. Ich sollte doch wohl meinen, dass beides nicht einerlei waere. Ist es aber nicht einerlei: so geraet man notwendig auf die Frage: wie zielt sie darauf? Und auf diese Frage antworten die Ausleger nichts.
Duplex quae ex argumento facta est simplici,
von dem Dichter wirklich so geschrieben und nicht anders zu verstehen ist, als die Dacier und nach ihr der neue englische Uebersetzer des Terenz, Colman, sie erklaeren. Terence only meant to say, that he had doubled the characters; instead of one old man, one young gallant, one mistress, as in Menander, he had two old men etc. He therefore adds very properly: novam esse ostendi,—which certainly could not have been implied, had the characters been the same in the Greek poet. Auch schon Adrian Barlandus, ja selbst die alte Glossa interlinealis des Ascensius, hatte das duplex nicht anders verstanden; propter senes et juvenes sagt diese; und jener schreibt: nam in hac latina senes duo, adolescentes item duo sunt. Und dennoch will mir diese Auslegung nicht in den Kopf, weil ich gar nicht einsehe, was von dem Stuecke uebrigbleibt, wenn man die Personen, durch welche Terenz den Alten, den Liebhaber und die Geliebte verdoppelt haben soll, wieder wegnimmt. Mir ist es unbegreiflich, wie Menander diesen Stoff ohne den Chremes und ohne den Clitipho habe behandeln koennen; beide sind so genau hineingeflochten, dass ich mir weder Verwicklung noch Aufloesung ohne sie denken kann. Einer andern Erklaerung, durch welche sich Julius Scaliger laecherlich gemacht hat, will ich gar nicht gedenken. Auch die, welche Eugraphius gegeben hat, und die vom Faerne angenommen worden, ist ganz unschicklich. In dieser Verlegenheit haben die Kritici bald das duplex, bald das simplici in der Zeile zu veraendern gesucht, wozu sie die Handschriften gewissermassen berechtigten. Einige haben gelesen:
Duplex quae ex Argumente facta est duplici.
Andere:
Simplex quae ex argumento facta est duplici.
Was bleibt noch uebrig, als dass nun auch einer lieset:
Simplex quae ex argumento facta est simplici?
Und in allem Ernste: so moechte ich am liebsten lesen. Man sehe die Stelle im Zusammenhange, und ueberlege meine Gruende:
Ex integra Graeca integram comoediam
Hodie sum acturus Heautontimorumenon:
Simplex quae ex argumento facta est simplici.
Multas contaminasse graecas, dum facit
Paucas latinas—