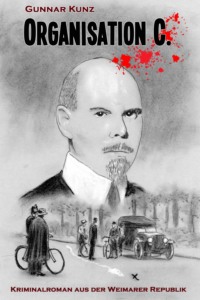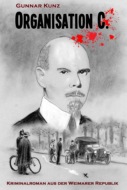Kitabı oku: «Organisation C.», sayfa 2
Gewohnheitsmäßig begab sich Hendrik zur Fensterbank und warf einen Blick in die Blumentöpfe, um zu sehen, ob Erste Hilfe noch möglich war. Die Ackerminze war zerrupft, die Begonien sahen aus, als habe jemand die Blätter abgefressen, und die Gartenkresse bestand nur noch aus Stielen. »Kannst du dir keine Frühstücksstulle leisten?«
»Das war nicht ich – die Läuse sind daran schuld.«
Vorsichtig drehte Hendrik ein übrig gebliebenes Blatt um. Tatsächlich war darunter alles schwarz. »Sieht aus, als würdest du Läusekolonien züchten und keine Pflanzen.«
»Hab‘ schon alles probiert, die kommen immer wieder.« Gregor stieg vom Stuhl und bot seinen Besuchern mit einer Geste Platz an. »Was führt euch her?«
»Wir waren gerade in der Nähe«, meinte Diana, »da dachten wir, wir sagen mal guten Tag.«
»Die Sedanstraße liegt in Weißensee, nicht in der Nähe«, erwiderte Gregor mit Blick auf Dianas linken Mundwinkel. Eine Spur getrockneter Blaubeersaft verriet, dass sie und Hendrik Agnes Lilienthal besucht hatten, Hendriks und Gregors Tante, die eine legendäre Blaubeertorte backte.
Hendrik grinste. »Klugscheißer.«
Sein Bruder blinzelte und lehnte sich im Stuhl zurück. »Ihr seid also neugierig, ob es etwas Neues über den Toten im Grunewald gibt.«
Diana konnte sich nicht länger beherrschen. »Gibt es etwas?«
»Dr. Paulys Obduktionsbericht ist da.« Gregor nahm eine Mappe von seinem Schreibtisch und blätterte durch die darin liegenden Papiere. »Seine Beobachtungen lassen wie immer an Klarheit und Genauigkeit nichts zu wünschen übrig. Es ist eine Freude, mit dem Mann zusammenzuarbeiten.«
»Und? Was sagt er?«
»Im Wesentlichen bestätigt er seine vorläufige Einschätzung von vorgestern. Drei Kugeln, deren erste bereits tödlich war. Zeitpunkt: Ende September, Anfang Oktober, plusminus ein paar Wochen.« Gregor legte den Bericht beiseite. »Der Mageninhalt hat nichts gebracht, außer der Erkenntnis, dass der Tote lange nichts gegessen, dafür aber umso mehr getrunken hatte. Der Chemiker wollte sich zwar nicht festlegen, glaubt aber, Alkohol nachgewiesen zu haben, der nicht durch Fäulnisbildung entstanden ist, vermutlich Bier. Schwierigkeiten bereitet uns immer noch die Identifizierung der Leiche. Meine Männer sehen gerade die Vermisstenkartei durch.« Er griff nach einer weiteren Mappe. »Dann haben wir noch die ballistische Untersuchung …«
»Ballistik – dabei geht es um Kugeln und Pistolen und so, nicht wahr?«, fragte Diana.
»Richtig. Sollten wir bei einem Verdächtigen eine Waffe finden, können wir möglicherweise sagen, ob die tödlichen Schüsse daraus abgegeben wurden oder nicht.«
»Das geht?«
»Einfach ist es nicht. Und leider laufen jede Menge Scharlatane herum, die vor Gericht als Sachverständige auftreten, aber keine Ahnung haben, was sie eigentlich tun. Doch im Prinzip: Ja, es geht. Jede Waffe hat ihre charakteristischen Merkmale. Sie haben sicher von den Anarchisten Sacco und Vanzetti gehört, drüben in Amerika. Die wurden aufgrund eben dieser Merkmale ihrer Waffen verurteilt.«
»Was sind das für Merkmale?«
»Bei der Fabrikation werden spiralartige Rillen in die Läufe geschnitten, um die Kugeln beim Abschuss in Rotation zu versetzen. Soviel ich davon verstehe, erhöht das die Reichweite und die Zielgenauigkeit. Keine Rille gleicht der anderen, dafür sorgen schon Unregelmäßigkeiten durch die Schneidewerkzeuge bei der Herstellung. Jedenfalls verursacht jeder Lauf Schrammen im Geschoss, die so individuell sind wie Fingerabdrücke. Es gibt einen Franzosen, der behauptet, dass auch die Schlagbolzen unverwechselbare Spuren auf den Böden der Patronenhülsen hinterlassen. Unter dem Mikroskop kann man all diese Spuren gut erkennen, allerdings ist ein direkter Vergleich schwierig. Man müsste ein Mikroskop erfinden, mit dem man die Bilder von Kugel und Vergleichskugel übereinander legen kann, oder wenigstens nebeneinander …«
Er starrte an die Decke und dachte eine Weile über seine Bemerkung nach. Dann schüttelte er den Kopf und vertiefte sich wieder in den Inhalt des Papiers in seiner Hand. »Kaliber 9 Millimeter … Länge … Gewicht … Die Tatwaffe ist vermutlich eine Mauser C/96, die sogenannte Besenstiel-Mauser. Eine typische Militärpistole. Aber das will nichts heißen, bei den Mengen an Waffen, die derzeit verschoben werden.«
»Verschoben?«
»Die Hälfte der Waffen, die nach den Bestimmungen des Versailler Vertrages vernichtet werden sollen, verschwindet in dubiosen Kanälen. Wird in geheimen Waffenlagern gehortet oder ins Ausland verkauft, nach Irland oder Finnland.«
Gregor trommelte mit den Fingern auf der Schreibtischplatte und sah aus dem Fenster. Dann schüttelte er den Kopf. »Wenn ihr jemanden umgebracht hättet, draußen, im Grunewald – was würdet ihr anschließend tun?«
»Du meinst, um nicht erwischt zu werden?«, fragte Hendrik.
Gregor nickte.
»Ich weiß nicht. Zusehen, dass ich von dort verschwinde, nehme ich an.«
»Ich würde vorher die Taschen des Opfers durchsuchen, ob er auch nichts bei sich trägt, das auf mich schließen lässt«, ergänzte Diana. »Jedenfalls, wenn ich nicht kopflos vor Panik wäre.«
»Und dann?«
»Abhauen. In eine andere Stadt ziehen.«
»Nein, im Gegenteil: mich so unauffällig wie möglich benehmen. Nach Hause fahren, Tee trinken, Zeitung lesen, einkaufen gehen.«
»Ihr würdet nicht auf den Gedanken kommen, die Leiche verschwinden zu lassen, damit man sie nicht so schnell findet?«
Hendrik grübelte. »Wenn ich einen Wagen in der Nähe hätte … Aber nein, dazu ist die Stelle zu abgelegen. Ich müsste die Leiche endlos durchs Gelände schleppen, dabei könnte mich jemand sehen.«
»Vielleicht war es Nacht.«
»Trotzdem. Es gibt immer späte Spaziergänger. Oder Zecher, die in den frühen Morgenstunden heimkehren. Zu riskant.«
»Und vergraben?«
Diana schüttelte den Kopf. »Mit bloßen Händen?«
»Vielleicht mit einem Messer. Aber das dauert ewig. Und jederzeit kann jemand vorbeikommen.«
Gregor nickte, als habe er etwas bestätigt bekommen. »Ein Loch auszuheben, wie das, in dem wir die Leiche fanden, braucht Zeit. Nur mit einem Spaten könnte man so etwas einigermaßen zügig bewerkstelligen. Aber würde der Täter nach Hause fahren, einen Spaten holen, und dann nach einer, zwei, drei Stunden zurückkehren, um sein Werk zu vollenden? In der Zwischenzeit hätte sonst wer über den Toten stolpern können.«
»Er hat es aber getan«, wandte Diana ein.
»Eben.«
»Was glaubst du?«, wollte Hendrik wissen.
»Ich glaube, er hatte den Spaten dabei. Oder vorher an der betreffenden Stelle versteckt. Weil es eben keine Tat im Affekt war. Weil er den Mord von Anfang an geplant hat.«
»Du meinst, das Opfer ist brav mitgegangen und hat nichts gemerkt?«
Gregor wurde einer Antwort enthoben, weil die Tür aufging und ein Kriminalbeamter hereinkam. »Wir haben die Vermisstenanzeigen durch.«
»Und?«
»Nichts.« Er legte einen Stapel Registerkarten auf den Tisch. »Die hier wiesen eine gewisse Übereinstimmung auf. Aber wir haben sie überprüft: Fehlanzeige.«
»Dann sucht zwei Monate vorher und nachher.«
»Zeitverschwendung. Der Mann wurde nicht als vermisst gemeldet. Und alle Spuren sind kalt. Das Ganze ist ein totgeborener Fall.«
»Sucht trotzdem. Wenn uns die Vermisstenmeldungen nicht weiterbringen, bleibt immer noch die öffentliche Leichenschau. Vielleicht kann man auch einen Aufruf in diesem Blatt vom Zahnärzteverband veröffentlichen und hoffen, dass der Zahnarzt, der die Gebissreparaturen vorgenommen hat, sich meldet. Dr. Pauly meint, die sind ungewöhnlich.«
Der Kriminalbeamte zuckte die Achseln und verließ das Büro.
»Wer war das?«, fragte Diana.
»Arthur Nebe. Ein ehemaliger Oberleutnant, der es jetzt bei der Polizei versucht. Ist durch die Kriminalkommissar-Anwärterprüfung gerasselt, aber er will sie unbedingt wiederholen. Ehrgeizig ist er ja.«
»Du magst ihn nicht?«
Gregor zuckte die Achseln. »Der wird nie ein guter Kriminalist. Wenn seine Schwester nicht im Innenministerium arbeiten würde …« Er betrachtete sinnend die Registerkarten.
»Was sind das für komische Laschen da am Rand?«, wollte Diana wissen.
»Die stehen für verschiedene Registermerkmale. Wenn sich eine Vermisstenanzeige nach vier Monaten nicht aufklärt, werden die Daten auf solche Karten übertragen und katalogisiert. Die Laschen dienen dem leichteren Auffinden, wenn man nach etwas Bestimmtem sucht.«
»Also: ›große Nase‹ oder ›Tätowierung‹ oder ›Warze am Daumen‹?«
»So ähnlich.« Gregor war mit seinen Gedanken nicht bei der Sache. »Totgeborener Fall!«, murmelte er. »Solange ich hier Kommissar bin, gibt es keine totgeborenen Fälle.«
4
Hendrik gab sich Mühe, seinen Triumph nicht allzu deutlich zu zeigen. Dass Gregor von sich aus zur Universität kam und ihn um Hilfe bat, hatte er vermutlich einer komplizierten Mischung aus Gewohnheit, Rivalität und Bequemlichkeit zu verdanken. Sein Bruder benahm sich in dieser Hinsicht äußerst widersprüchlich. Einerseits lehnte er »die Einmischung von Amateuren« ab, andererseits genoss er es, Hendrik als Vertrauten an seiner Seite zu haben, wenn er einen Fall entwirrte. Zudem glaubte er immer noch, ihm beweisen zu müssen, dass an der Polizeiarbeit nichts Anrüchiges war. Nicht zuletzt mangelte es an Hilfskräften. Das Polizeipräsidium stand Kopf, sämtliche Kriminalbeamte schoben Doppelschichten; was lag also näher, als auf Hilfe innerhalb der Familie zurückzugreifen?
»Hast du deinen Skizzenblock dabei?«
Hendrik nickte und überzeugte sich davon, dass er einen Stift in der Tasche trug.
»Was ist denn das für ein Stummel? Bist du so arm, dass du dir keinen neuen Bleistift leisten kannst?«
»Wieso? Der hier tut’s doch noch.«
Gregor schüttelte den Kopf, startete den Wagen und fuhr über die Friedrichstraße nach Tempelhof.
»Wer ist denn nun der Tote?«, wollte Hendrik wissen.
»Ein gewisser Hartmut Gensch. Ein junger Mann aus bürgerlichem Elternhaus, mehr weiß ich im Augenblick auch nicht.«
»Ihr habt doch wochenlang nichts über ihn in Erfahrung bringen können. Wodurch seid ihr weitergekommen?«
»Sein Zahnarzt hat sich auf unseren Aufruf in den Zahnärztlichen Mitteilungen gemeldet und seine Gebissarbeit wiedererkannt.«
»Und jetzt fahren wir zu seinen Eltern?«
»Zur Mutter, der Witwe eines Ministerialbeamten. Sie hat ihren Sohn bereits im Leichenschauhaus identifiziert.«
»Identifiziert? Aber er war doch …«
»Der Bestatter hat ihn vorher … bearbeitet.«
Hendrik wollte sich das lieber nicht vorstellen. Auch die beste Kosmetik konnte neun Monate im Waldboden und eine Obduktion nur bedingt kaschieren. »Wie hat sie den Anblick verkraftet?«
»Als würde sie so etwas jeden Tag machen. Die Frau ist aus Eisen.«
Am Hohenzollernkorso wohnten überwiegend gut situierte Mieter, das sah man nicht nur an der sauberen Straße, sondern auch an den verzierten Fassaden. Gregor stellte den Wagen ab und betrat mit Hendrik einen pompösen Hauseingang. Es roch nach Seife und Preußentum. An der Wand hing ein Schild: Musizieren streng verboten. Sie stiegen in den zweiten Stock und betätigten den Klingelzug.
Kürzlich hatte Hendrik ein Buch über ägyptische Mumien gelesen; die Frau, die ihnen öffnete und sie einließ, erinnerte ihn daran. Er hätte nicht zu sagen vermocht, woran das lag, denn ihre Haut war zwar bleich und faltig, aber nicht vertrocknet. Vielleicht hing es mit ihrem fehlenden Minenspiel und den geräuschlosen Bewegungen zusammen, die einem das Gefühl gaben, sich in einem Mausoleum zu befinden. Und mit den Augen, ja, eindeutig mit den Augen! Die hatten etwas Unheimliches an sich. Unterstützt wurde diese Wirkung noch durch ihre Art zu sprechen. »Das Mädchen hat Ausgang«, erklärte sie, und es klang wie das Rascheln von Laub.
Hendrik bezweifelte, dass es ein Mädchen gab. Nicht, wenn man den Staub auf Fensterbänken, Vasen, Bildern berücksichtigte. Frau Gensch sah nicht aus wie jemand, der seinen Bediensteten Schlampereien durchgehen lassen würde. Sie selbst war über und über mit Schmuck behängt: Ohrringe, Halsketten, Armreifen, Ringe an den Fingern. Hendrik kannte sich mit dergleichen nicht aus, aber er hätte gewettet, dass die Edelsteine falsch waren.
Die Wohnung bestätigte seinen Verdacht, dass hier mehr auf Schein als auf Sein Wert gelegt wurde. Zwar hing an der Garderobe ein Pelz, aber der hatte schon bessere Tage gesehen. Wieso überhaupt ein Pelz? Jetzt, Ende Mai? Um Besucher darauf hinzuweisen, dass Frau Gensch sich einen leisten konnte?
Der Salon, in den Hendrik und Gregor geführt wurden, sollte ebenfalls den Eindruck von Reichtum erwecken: Musselingardinen (abgegriffen), ein teures Sofa (mit abgerissenen Troddeln), eine antike Kommode (verschrammt). Die Teppiche waren an einigen Stellen so dünn, dass man den Boden durchschimmern sah. Die spanische Wand verdeckte eine schadhafte Stelle in der Tapete, wie Hendrik sich durch einen raschen Blick überzeugte, als Frau Gensch gerade nicht hersah. Die Sesselpolster waren geflickt, auch wenn eine darübergeworfene Decke diese Tatsache zu verbergen suchte. An einer Stelle der Wand zeichnete sich ein dunkles Rechteck ab; hier musste einmal ein Bild gehangen haben. Vielleicht war es verpfändet oder verkauft worden wie das fehlende Tafelsilber. Sogar die Kristallgehänge des Lüsters wiesen Lücken auf.
Auf einer Kommode standen drei Fotos. Eines zeigte eine jüngere Ausgabe der Frau mit einem steif wirkenden Herrn, vermutlich ihr Ehemann. Die beiden berührten sich nicht, nicht einmal mit den Fingerspitzen.
Daneben befand sich das Bild eines jungen Mannes in Uniform. Hendrik nahm es in die Hand. »Ist er das?«
Sie bewegte kaum den Kopf beim Nicken.
Die Aufnahme musste vor etlichen Jahren gemacht worden sein, denn die Person darauf war kaum älter als sechzehn oder siebzehn. Gewehr bei Fuß, Hacken zusammengeschlagen, ein siegessicheres Grinsen im Gesicht, so präsentierte sich Hartmut Gensch dem Betrachter. Hendrik dachte an seine eigene Zeit als Soldat. Auch von ihm existierte ein Foto aus jenen Tagen, aber darauf verriet jeder Muskel, wie unwohl er sich in der Uniform gefühlt hatte.
Das dritte Foto zeigte Hartmut Gensch zusammen mit zwei weiteren jungen Männern. Die Familienähnlichkeit war unverkennbar. »Ihre anderen Söhne?«
Wieder diese beinahe reglose Bestätigung.
»Wo sind sie jetzt?«, fragte Gregor.
»Gefallen.«
»Tut mir leid.«
Mit einer unwirschen Bewegung wischte sie die Bemerkung beiseite. »Früher waren sie meine Freude. Jetzt sind sie mein Stolz.«
Hendrik schauderte und stellte das Foto an seinen Platz zurück.
»Welches war das Zimmer Ihres Sohnes?«, wollte Gregor wissen.
Die Frau bewegte den Kopf zu einer der Türen.
Gregor drückte die Klinke. Die Tür ließ sich nur zur Hälfte öffnen, dann stieß sie gegen die Seitenkante eines Schreibtisches. An dessen Rückfront, in der Ecke des Zimmers, stand ein Kachelofen ohne Ofenrohr. In der Lücke zwischen Wand, Ofen und Schreibtisch, gleich hinter der Tür, stapelten sich Briketts.
Der Raum vermittelte einen merkwürdig zwiespältigen Eindruck von der Persönlichkeit seines Bewohners. Einerseits schien Hartmut Gensch besessen von rechten Winkeln. Geradezu zwanghaft hatte er Brieföffner, Tintenfass und Papiere an der Kante des Schreibtisches ausgerichtet und Stühle in Reih und Glied positioniert, wie Soldaten in Hab-Acht-Stellung. Andere Dinge zeugten von einer Nachlässigkeit, die nicht recht dazu passen wollte, angefangen bei der Tür, die man kaum aufbekam, bis zu den aufgehäuften Briketts.
Überhaupt enthielt der Raum wenig Persönliches, keine Briefe, keine Notizen, keine Erinnerungen, wenn man von einer Vitrine absah, in der Kriegssouvenirs ausgestellt waren: Abzeichen, Feldpostkarten, Uniformknöpfe, alle gewissenhaft beschriftet, daneben dreißig oder vierzig geschnitzte Figuren.
»Haben Sie hier viel verändert?«
»Ich hab‘ alles so gelassen«, sagte Frau Gensch tonlos. »Weil ich dachte, mein Junge kommt bald zurück.«
Das war unzweifelhaft die Wahrheit, denn es roch so muffig, als sei monatelang nicht gelüftet worden.
»Wie alt war er?«
»Einundzwanzig.«
Hendrik suchte auf dem überfüllten Schreibtisch vergeblich nach einer Möglichkeit, seine Skizzenmappe abzulegen. An der Wand war ein Regal angebracht, unpraktischerweise über jener Seite des Schreibtisches, an der man nicht sitzen konnte, weil die Schubfächer dort bis zum Boden reichten. Man musste aufstehen, wenn man etwas vom Regal holen oder darauf zurückstellen wollte. Hendrik lehnte seine Skizzenmappe gegen ein Bein des Schreibtisches und setzte sich auf den Stuhl. Nein, so ging das nicht. Er kehrte dem Zimmer ja den Rücken zu! Er drehte den Stuhl herum, legte seine Zeichenutensilien zurecht und fing an, den Raum zu skizzieren: Stühle, Schreibtisch, Vitrine.
Gregor nahm eine der geschnitzten Figuren in die Hand. »Von Ihrem Sohn?«, fragte er, um die alte Frau zum Reden zu bringen.
Sie nickte.
»Warum haben Sie keine Vermisstenanzeige aufgegeben?«
»Ich dachte, er kommt bald zurück«, wiederholte sie.
»Ist es öfter vorgekommen, dass er ohne Nachricht verschwand?«
»Ein- oder zweimal. Ich wusste dann, dass er wieder über die Stränge schlägt. Aber es hat nie lange gedauert.«
Hendrik konnte es nicht lassen, seinen karikaturistischen Neigungen nachzugeben, und zeichnete Frau Gensch als Mumie. Eine sonderbare Frau. Dass sie nicht zur Polizei gegangen war … Zwei Söhne gefallen, der dritte vermisst … Vielleicht war es ihre Art, die Wirklichkeit nicht wahrhaben zu wollen. Trotzdem blieb ihm ihre Haltung unbegreiflich.
»Hatte ihr Sohn Feinde?«
»Jeder, der ihn kannte, mochte ihn.«
»Und seine Freunde? Wer waren seine Freunde?«
»Ein Haufen Taugenichtse. Ich hab’s nicht gern gesehen, dass er sich mit denen ’rumtrieb. Früher war er auch mal so. Aber ich habe ihm Disziplin beigebracht. Ihn Respekt gelehrt. Der Krieg hat einen Mann aus ihm gemacht, auf den ich stolz sein konnte.«
»Wer waren seine Freunde?«, insistierte Gregor, während er die Figur zurückstellte.
Frau Gensch zählte ein halbes Dutzend Namen auf.
Neugierig ging Hendrik zur Vitrine, um sich die Figuren anzusehen. Sie waren gar nicht mal schlecht: grob gearbeitet, aber ausdrucksvoll. Vermutlich war es die Langeweile in den Feldlagern gewesen, die Hartmut Gensch dazu gebracht hatte, sich der Schnitzerei zuzuwenden. Schade, dass er kriegerische Motive bevorzugte: Soldaten, Wikinger, Landsknechte. Bäcker, Schornsteinfeger, Tänzer kamen in seiner Welt nicht vor. Geschweige denn Frauen, Kinder, Tiere. Halt, da gab es einen Schäferhund, der auf etwas zu lauschen schien. Und ein Fabelwesen mit Hörnern, Schwingen und einer dämonenhaften Fratze. Furcht einflößend, aber geschickt gearbeitet. Siegfrieds Drache?
»Ich weiß, wer es war«, sagte Frau Gensch plötzlich.
Überrascht sahen die Brüder Lilienthal sie an.
»Der Erwin war’s. Der Overbeck.«
»Was bringt Sie zu dieser Vermutung?«, fragte Gregor.
»Der war hinter der Ada her.«
»Wer ist Ada?«
»Hartmut und sie waren verlobt. Ich hab‘ ihn immer vor dem Flittchen gewarnt. Die ist nichts für dich, hab‘ ich gesagt. Aber er wollte ja nicht auf mich hören.«
»Ada – und wie weiter?«
»Bredow. Die Tochter von diesem Uhrmacher am Ende der Straße.«
»Wie lange kannten sich ihr Sohn und Fräulein Bredow?«
»Ein Jahr. Er hat sie bei so ‘nem Tanzvergnügen kennengelernt.« Sie schürzte abfällig die Lippen. »Wie die schon ’rumlief! Billig, das konnte man gleich sehen. Aber Hartmut … Er wollte nichts Schlechtes über sie hören. Ich hab‘ immer gewusst, dass sie sein Unglück ist.«
»Vielleicht hat sie ihn geliebt?«
»Ausgenutzt hat sie ihn. Sich von ihm ausführen und beschenken lassen. Und was ist der Dank? Seit Hartmut verschwunden ist, war sie kein einziges Mal hier, um sich nach ihm zu erkundigen. Die hat ihm keine Träne nachgeweint. Nicht mal vier Wochen hat es gedauert, da hat sie sich schon dem Erwin an den Hals geworfen.«
Während Gregor die Befragung fortsetzte, ging er im Raum umher, untersuchte die Vitrine, öffnete Schreibtischfächer und blätterte in den Papieren, die er dort fand. Es machte einen beiläufigen Eindruck, aber Hendrik wusste, dass sein Bruder das Zimmer systematisch untersuchte.
»Dieser Erwin Overbeck – waren er und Ihr Sohn miteinander bekannt?«
»Die haben ständig zusammengehangen, als seien sie dicke Freunde. Kannten sich von der Front. Aber sobald die Ada da war, hatte der Erwin nur noch Augen für sie. Wie der immer um sie ’rumscharwenzelt ist! Verhaften Sie den Erwin, Herr Kommissar! Der ist es gewesen.«
»Wir werden Ihrem Hinweis nachgehen.« Gregor machte sich Notizen. »Wann haben Sie Ihren Sohn zuletzt gesehen?«
»Am 1. September. Er hat den ganzen Tag versucht, Arbeit zu bekommen, und wollte abends noch … unter die Leute.«
Sich besaufen, übersetzte Hendrik in Gedanken.
»Mit dem Overbeck. Der hat es getan, wegen der Ada.«
»Erzählen Sie uns mehr über diesen Tag. Was genau hat Ihr Sohn gemacht? Wo hat er vorgesprochen?«
»Bei einer Reederei. Hat sich um eine Anstellung als Schreiber bemüht.« Ihre Miene nahm einen verbitterten Ausdruck an. »Um Arbeit angestanden, wie ein gewöhnlicher Proletarier. Wir, die wir seit Generationen in kaiserlichen Diensten standen!«
»Ihr Mann war Ministerialbeamter, wenn ich richtig informiert bin?«
»Im Finanzministerium. Ein treuer Diener des Kaisers. Der Kaiser hat ihn einmal selbst belobigt. Und plötzlich sind wir nichts mehr wert. Es gibt keinen Anstand mehr auf der Welt.«
»Ihr Sohn hat die Arbeit also nicht bekommen?«
»Natürlich nicht. Wer kein Jude oder Bolschewist ist, hat ja keine Chance. Die nehmen uns alle Arbeitsplätze weg. Heutzutage darf doch jeder Bergarbeitersohn studieren, wo kommen wir denn da hin? Aber was kann man schon erwarten, mit einem Sattler als Reichspräsident!«
»Nun, ich denke –«
»Die Genschs waren immer eine Stütze der Krone. Auf unseren Schultern ruhte die Verwaltung des Reiches. Jetzt hat man uns einfach vergessen. Auf die Müllhalde geworfen. Seit die Sozialisten an der Macht sind, geht es nur noch bergab. Die Arbeiter machen den ganzen Tag Revolution, und trotzdem geht's denen besser als unsereinem, ist das etwa gerecht?«
»Sie bekommen doch sicher eine Witwenrente.«
»Witwenrente, dass ich nicht lache! Kein Mensch kann davon standesgemäß leben. Mein Sohn hat versucht, eine Erhöhung durchzusetzen, aber er wurde nur höhnisch abgewiesen. Das hätte es unter dem Kaiser nicht gegeben. Als der Kaiser noch auf dem Thron saß, ging’s uns gut.«
»Mit Ihren finanziellen Verhältnissen steht es also nicht zum Besten?«
»Wie denn? Rücklagen verlieren an Wert, Sparkonten und Reichsanleihen werden von der Inflation aufgefressen. An allem sind nur der Rathenau und der Wirth Schuld.«
»Und ein kleines bisschen der verlorene Krieg.«
»Wenn uns die Juden und die Kommunisten nicht das Messer in den Rücken gestoßen hätten, würden wir jetzt als Sieger über die Champs-Élysées flanieren. Stattdessen verscherbelt der Rathenau unser Land an die Polen und sieht zu, wie polnische Verbrecherbanden ehrliche Deutsche terrorisieren.«
»Kommen wir zurück zu Ihrem Sohn. Wenn Ihre Familie keine nennenswerten Geldmittel besitzt und er selbst ohne Arbeit war, wie hat er dann die Geschenke für Fräulein Bredow finanziert? Mit Schulden?«
»So etwas würde er nie tun. Wir sind doch keine Bettler!«
»Irgendwo muss das Geld ja hergekommen sein.«
»Manchmal hat er für kurze Zeit Arbeit gehabt. Er war eben ein sparsamer Junge.«
Hendrik fand diese Antwort unbefriedigend, aber Gregor ritt nicht weiter darauf herum. Er stellte noch ein paar Fragen zu Hartmut Genschs Freunden und gab dann das Zeichen zum Aufbruch. Hendrik war frustriert. Sie waren jetzt noch ratloser als vor dem Gespräch mit Frau Gensch, fand er. Der Besuch hatte nichts erhellt, nicht einmal die Persönlichkeit des Toten.
»Stimmt«, gab Gregor zu, »der Mann ist nicht zu greifen. Was mich am meisten irritiert, ist, dass ich keine Briefe oder Notizen gefunden habe, keinerlei Schriftstücke. Ungewöhnlich. Normalerweise findet man immer etwas.«
»Vielleicht hat seine Mutter die persönlichen Dinge an sich genommen.«
»Möglich. Aber wenn du bedenkst, dass sie nicht einmal lüftet …« Gregor schüttelte den Kopf. »Hat keinen Zweck, lange darüber nachzugrübeln. Sehen wir lieber, ob Fräulein Bredow daheim ist.«
5
Auf den ersten Blick war Ada Bredow eine adrette Erscheinung. Hendrik wusste zuerst nicht, woran es lag, dass sie trotzdem aufdringlich wirkte. Erst beim zweiten Blick merkte er, dass sie kein Gespür für das rechte Maß besaß. Alles an ihr war eine Spur zu viel: zu viel Schmuck, zu viel Rouge, zu viel Blond.
»Polizei? Was gibt es denn?«
»Dürfen wir hereinkommen?«
»Ja, äh, natürlich.«
Die Wohnung war deutlich kleiner als die von Frau Gensch. Der Flur wurde von einem Wandspiegel dominiert, ein monströses, rostiges Ding. Am Kleiderhaken hingen Herrenjacken und -mützen, was darauf schließen ließ, dass Ada Bredow nicht allein lebte. Auf dem Herd in der Küche blubberte eine übel riechende Flüssigkeit vor sich hin.
»Was ist das?«, wollte Hendrik wissen.
»Nikotinbrühe. Gegen Blattläuse.«
»Das hilft?«, fragte Gregor interessiert.
»Bei mir jedenfalls.«
»Wie wird das gemacht? Einfach Kippenreste ins Wasser, und dann …?«
»Aufkochen. Aber machen Sie vorher das Papier ab.«
Hendrik verzog das Gesicht zu einer Grimasse. Er konnte sich lebhaft vorstellen, wie Gregor in den nächsten Tagen mit stinkenden Substanzen experimentieren würde. Er machte sich eine mentale Notiz, das Büro seines Bruders mindestens bis zum Wochenende zu meiden.
Fräulein Bredow stellte den Ofen aus und führte die beiden Männer ins Wohnzimmer, das einem Uhrenmuseum glich. Nicht nur standen, hingen oder lagen überall Taschenuhren, Standuhren und Wanduhren herum, nein, auf Tischen, Stühlen und sogar auf dem Boden waren darüber hinaus Zifferblätter und Zahnräder, Uhrengläser und Springdeckel, Drahtösen, Gewichte, Pendel, Zeiger, Schlagwerke und Schrauben in allen Größen ausgebreitet. Richtig, Ada Bredows Vater war ja Uhrmacher!
»Wie kann ich Ihnen helfen, Herr Kommissar?«
»Wir ermitteln im Fall Hartmut Gensch.«
»Gibt es etwas Neues von ihm?«
»Tut mir leid, aber … Er ist tot.«
»Tot? Nein!« Ada versuchte, sich betroffen zu zeigen, was ihr gründlich misslang. Der Griff ans Herz war zu gewollt, und ihre Stimme hatte eindeutig zu viel Tremolo, um echt zu sein. »War es … ein Unfall?«
»Mord. Deshalb sind wir hier.«
»Mord? Aber wer …?«
Hendrik entdeckte eine geschnitzte Figur auf der Kommode und hob sie hoch. »Von ihm?«
Ada nickte zerstreut.
Es handelte sich um einen Hund, der Männchen machte und eine Zeitung im Maul trug. Das linke Vorderbein war ein Stück zu kurz geraten und die Rasse nicht zu identifizieren, aber die Figur hatte unbestreitbar einen lebendigen Ausdruck.
Die Tür des Nebenzimmers ging auf, ein Mann kam herein. »Dachte ich mir doch, dass ich Stimmen gehört habe.«
»Das ist die Polizei«, erklärte Ada hastig. »Denk dir, Hartmut ist tot!«
Der Mann hatte offenbar keine Lust, ihr Spiel mitzuspielen, denn er zuckte nur die Achseln.
»Er wurde ermordet, sagt der Kommissar.«
Gregor machte einen Schritt auf ihn zu. »Darf ich fragen, wer Sie sind?«
»Erwin Overbeck.«
Hendrik hatte es bereits vermutet. Er sah sich den Mann, den Frau Gensch als Mörder ihres Sohnes bezeichnet hatte, genauer an. Er trug einen gebrauchten Anzug, einen Selbstbinder und Halbschuhe aus Leder. Die kleinen Risse darin waren notdürftig mit einer Art Politur kaschiert worden. Anscheinend konnte er sich kein Hemd leisten, stattdessen hatte er eine gestärkte Hemdbrust vorgeschnallt und ebensolche Manschettenröllchen unter die Ärmel seines Anzugs geschoben. Es machte ihn dennoch nicht zu einem Beamten. Erwin Overbeck war das Muster eines Soldaten: wachsame Augen, angespannte Muskeln, vorgebeugte Schultern – er sah aus, als stünde er unter Sperrfeuer.
Besitzergreifend legte er seinen rechten Arm um Adas Taille. Hendrik stellte fest, dass der Ringfinger verstümmelt war.
»Hab‘ ich aus‘m Krieg«, erklärte Erwin, als er den Blick bemerkte.
»Ich würde Ihnen gern ein paar Fragen stellen, Fräulein Bredow«, sagte Gregor.
»Sie hat nichts damit zu tun«, fuhr Erwin dazwischen.
Gregor ignorierte ihn. »Können wir uns irgendwo setzen?«
Mit rotem Kopf sammelte Ada Zugfedern, Räderwerke und Uhrengehäuse von den Sitzgelegenheiten, deutete auf die Sessel und ließ sich selbst auf dem Sofa nieder. Nach kurzem Zögern setzte Erwin sich so, dass er zwischen ihr und Gregor saß. Hendrik holte seinen Skizzenblock hervor und fing an, eine Karikatur der beiden als Kanarienvogel und Krebs anzufertigen und zwischendurch stichwortartig ihre Antworten mitzuschreiben.
»Arbeiten Sie?«
»Ich bin Verkäuferin bei Tietz.«
»Noch«, mischte sich Erwin ein.
Gregor ignorierte ihn auch diesmal. »Am Alexanderplatz?«
»Dönhoffplatz.«
»Schon lange?«
»Seit drei Jahren.«
»Mögen Sie die Arbeit?«
»In diesen Zeiten kann man froh sein, wenn man nicht auf der Straße sitzt. Natürlich will ich das nicht ewig machen. Sobald ich einen netten Mann kennenlerne …« Sie warf Erwin einen Blick zu und klimperte mit ihren Wimpern.
»Wird Zeit, dass du aufhörst«, maulte der.
»Es ist eine gute Arbeit.«
»Ich mag nicht, dass du für diesen Juden schuftest. Ein deutsches Mädchen sollte sich nicht so erniedrigen.«
»Wir brauchen das Geld, das weißt du genau. Außerdem geht’s mir da gut. Es gibt eine Pensionskasse und eine Leihbücherei, und als Mitarbeiter bekommt man günstige Darlehen.«
»Geld verleihen, typisch Jude!«
»Sind Sie dort auf der Lehrlingsschule?«, unterbrach Gregor.
»Ja. In Warenkunde und Rechnen bin ich gut, aber Buchführung fällt mir schwer.«