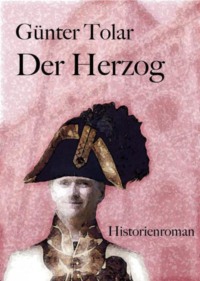Kitabı oku: «Der Herzog», sayfa 6
Mittlerweile hatte aber die als Ludmilla gerufene hinter ihren Felsen geschrien: „Karoline! Hermine!“, und dann noch was in ihrer Sprache.
Zwei weitere nackte Frauen tauchten auf. Während Ludmilla überall blond war, war die zweite, es wird wohl Karoline gewesen sein, sehr brünett oder schon braun, die dritte - bleibt nur noch Hermine - schwarz, oder so dunkelbraun, daß sie schwarz wirkte im Gegensatz zu ihrer recht hellen, so schien mir, bläulich durchwirkten Haut. Aber wir waren noch zu weit entfernt, um solche Details schon erkennen zu können.
„Komm“, deutete mir Ivo, nachdem die drei Grazien ebenfalls ein „Komm“ gewunken hatten, und wir kletterten die Felsen hinab, wo uns die Damen in einer Felsnische empfingen, die mit kurzhaarigen Fellen bequem ausgelegt war.
Sie lagerten sich malerisch hin und luden uns ein, uns neben sie oder besser zwischen sie zu lagern. Ivo aber lehnte dankend ab und wir setzten uns auf zwei Felsen ihnen gegenüber, was mir beim Sitzen ziemlich wehtat, weil der Fels sehr rau war und mein Hintern nur Gepolstertes gewöhnt ist.
„So bist du wenigstens sicher vor ihnen“, meinte Ivo auf deutsch.
„Du nicht?“, fragte ich.
„Mich kennen sie“, antwortete er, „und respektieren mich. Aber dich?“
Da wollte schon Zorn in mir aufkommen, weil ich mir das nicht mehr gefallen lassen wollte. Wenn er sagen würde, ich sei Graf, würden sie mich wohl genauso respektieren wie ihn, diese nackten Weiber.
„Sie unterhalten sich eben über dein Glied“, erklärte mir da der Ivo.
Mein Zorn geriet in Verwirrung, es blieb mir für den Augenblick nur eines zu fragen: „Und?“
„Sie finden es schön.“
Ich sah mein Glied an, fand es eigentlich auch recht schön, nickte den Damen erfreut zu, sie lachten und nickten fröhlich zurück.
„Verstehen die uns?“, fragte ich.
„Nein“, sagte er, „aber es gibt Themen, die versteht man auch ohne Worte. Und du hast eben recht stolz dein Männliches betrachtet.“
„Ja?“, sagte ich verwirrt und blickte wieder die drei Damen an.
Sie nickten eifrig: „Dobro!“, sagten sie, „Dobro, dobro!“
„Das heißt gut“, übersetzte Ivo trocken.
Ich sah mir jetzt ebenso unverschämt die drei Damen an, konnte aber nicht viel Unterschiedliches bemerken, als daß sie alle verschieden hängende Brüste haben, weiß, milchig und blau um die Warzen herum geädert, sehr buschige Schamhaare, jede in ihrer Farbe; nur bei der ganz Dunklen sah es um die Scham herum etwas anders aus; ihr wuchsen die Haare in kleinen Büschelchen, sodaß immer wieder die weiße Haut dazwischen hervorschimmerte. Als sie bemerkte, daß ich sie betrachtete, tat sie langsam ihre Beine auseinander, bis ich das vor mir hatte, was ich von meiner kleinen Cousine schon kannte. Genauso kindlich sah es bei der Hermine aus. Nur daß es bei der Hermine gemeiner wirkte. Gewöhnlicher. Vulgärer.
„Voriges Jahr“, murmelte Ivo. „sind sie noch so gelegen, daß man wenigstens das Geschlecht nicht sah, aber heute - äh...“ - er schloß mit einem Ausruf tiefen Ekels, der Hermine veranlaßte, ihre Scham wieder zu schließen. Eigenartig empfinde ich jetzt, daß das, wovor ich mich gefürchtet hatte, nicht aufgetreten war: ich war nicht erregt.
Ivo übrigens auch nicht.
Eine Zeitlang saßen wir stumm beieinander, dann meinte Ivo, wir könnten jetzt wohl gehen. Ich schloß mich seiner Meinung an, zumal man aus dem Felsenloch auch gar nichts von der Landschaft sehen konnte. Zudem bekam die Situation für meinen Be-griff etwas Abgeschmacktes.
Wir standen auf, die Damen streckten uns die Arme entgegen, worauf wir bei jeder niederknieten und sie schnell küßten. Dabei ließ es sich keine der drei entgehen, mir streichelnd auf mein ‚schönes’ Glied zu greifen.
Aber auch jetzt - leichter Kitzel, keine Erregung.
Selbstvergessen machte ich beim Verlassen eine höfliche Verbeugung, die bei den dreien großes Gelächter hervorrief.
Das Lachen klang uns immer noch nach, als ich schon weiter bergauf Ivos Hinterfront, die ich ja schon beschrieben habe, folgte. Als wir dann wieder um den Überraschungsfelsen - jetzt in die andere Richtung - herumgegangen waren, fragte ich beiläufig: „Noch irgendwelche Überraschungen?“
„Tu er nicht so abgefeimt“, meinte Ivo.
Ich aber blieb beharrend: „Ich habe nur gefragt, ob es heute noch irgendwelche Überraschungen gibt.“
Jetzt blieb Ivo stehen, stellte sich mir gegenüber auf, legte seine Hände an meine Hüften und sagte: „Joseph Moritz, ich weiß, wenn wir dann wieder hinüber kommen ans Land, dann bist du wieder der Graf und hast alles Anrecht auf meinen Respekt.“
Er hielt inne.
Ich nickte nur.
Also sprach er weiter: „Ich hoffe zu Gott, daß ich heute keinen Fehler gemacht habe. Der Tag heute war nur für dich und für mich bestimmt. Und für sonst niemand. Hörst du? Bitte hör’ es: niemand sonst!“
Ich habe ihn dann langsam ganz zu mir her gezogen, bis wir Körper an Körper waren, und flüsterte ihm ins Ohr: „Was soll ich denn verraten? Die drei Weiber? Oder das, was wir jetzt tun? Was denn?“
„Was tun wir denn?“, flüsterte er zurück, sich so fest an mich schmiegend, daß auch kein noch so kleiner Raum mehr zwischen uns war.
Das ist jetzt eine der Stellen in Joseph Moritz’ Tagebuch, an der wir einen kleinen Respektsabstand halten.
Aber der Tag war ja noch nicht zu Ende.
Beim Anlegen der Kleider halfen wir einander gegenseitig, was gleich noch einmal unsere Sinne gänzlich verwirrte.
Und ‚gleich noch einmal’ sei ein respektvoller Sprung gemacht.
Wir gingen dann wie demütige Büßer zum Kloster, wo Ivo eine kärgliche, aber recht köstlich schmeckende Mahlzeit für uns beide erstand. Wir aßen gleich neben der Pforte in einem steinernen Raum mit dunklen, schweren Holzmöbeln. Es hat mir sehr gemundet, ich hatte aber auch einen recht guten Hunger nach all den Erlebnissen.
Dann bat ich ihn, mir noch mehr von der Insel zu zeigen.
„Nicht die stillen Häuser. Aber ist da nicht auch noch ein Fort?“
Diese Frage hat dem Ivo die Laune gründlich verdorben: „Ja“, sagte er, „vor zwölf Jahren (1806) haben die Franzosen, als sie unsere Republik aufgelöst hatten, das Fort Royal gebaut. Royal, nach ihrem eigenen König. Und da steht es noch. Die Franzosen sind weg, jetzt haben wir die Österreicher.“
Auch er kam sofort zu dem Thema, zu dem man zumeist kam, wenn man über die Franzosen sprach: „Aber paßt nur gut auf in Wien, ihr habt ihn ja, den Burschen, den Napoleon so gerne zu seinem Nachfolger gemacht hätte.“
„Ein Kind“, antwortete ich, „sieben Jahre alt.“
„Er ist Napoleons Sohn“, beharrte Ivo wütend, „also ist er zu hassen, und er ist zu verhindern und zu...“
Hier unterbrach er sich selbst.
„Wolltest du töten sagen?“, fragte ich.
Er antwortete nicht direkt: „Kennst du ihn? Hast du ihn schon einmal gesehen, den Teufel?“
„Er ist kein Teufel“, rief ich, „er ist ein hübscher gescheiter Bub, der so etwas nie sagen würde, was du jetzt gesagt hast. Nie!“
„Er ist der Sohn Napoleons“, wollte Ivo abschließen.
Ich aber kämpfte diesmal um das letzte Wort: „Er konnte sich seinen Vater nicht aussuchen. Und seine Mutter auch nicht.“
Letzteres sagte ich wohl eingedenk der Bastarde von Parma.
Ivo schwieg.
Ich aber hatte noch ein letztes Wort: „Mein Vater ist übrigens sein Erzieher.“
Ivo nickte unsanft, als ob er schon genug hätte.
Ich aber setzte noch was drauf: „Und mein Vater ist kein Franzosenknecht, sondern Österreicher. Wie ich. Aber vielleicht ist dir das auch nicht mehr recht, jetzt?“
Der letzte Satz schmeckte mir selber recht bitter. Auch jetzt noch.
„Verzeih’ mir“, sagte da der Ivo, „wir haben beschlossen, wir sind Freunde.“
„Weil es nicht Liebe sein darf“, ergänzte ich.
Er nickte, nahm im Gehen meine Hand in die seine und küßte sie. Der Rest des Tages, Heimfahrt, Weg zum Palast, Verabschiedung, alles verlief so gut wie stumm.
Es war alles in der Ordnung, alles in der Harmonie. Diese Freundschaft, die nicht die Liebe sein durfte.
Damit endet das Kapitel von der Liebesinsel.
Wir haben vorhin Zweifel an der Geschichte mit den Frauen angemeldet. Wir haben sie noch. Die drei Namen, die sie tragen, Ludmilla, Karoline und Hermine sind keine Namen, wie sie die Damen von Ragusa damals getragen haben. Wir wissen aber, daß es drei Damen in Wien gibt, die diese Namen tragen und die in der Hierarchie als Heiratskandidatinnen für Joseph Moritz einmal in Frage kamen. Wir haben derzeit noch keinen Hinweis, daß Joseph Moritz mit der Situation einer Verheiratung schon konfrontiert war. Aber wir wissen, daß die drei Damen mit just den drei Namen schon demnächst auftauchen. Wir wissen es von Joseph Moritz selbst, aus seinem Tagebuch. Es wäre doch ein fataler Zufall, wenn drei Grazien in den Strandfelsen einer Insel vor Ragusa - es handelt sich übrigens um das heutige Lokrum - just diese drei Namen trügen.
Erhebt sich also die Frage, ob Joseph Moritz da nicht eine Art Front aufbaute, formulierte, träumte - und letztlich flunkerte.
Bemerkenswert ist aber auch, daß Joseph Moritz immer und überall auf den napoleonischen Buben stieß, gestoßen wurde.
In einem Satz wundert er sich selber:
Heut’ hab’ ich schon wieder den Napoleon-Buben verteidigt. Wie komm’ ich denn dazu?
Viel hat er nicht mehr berichtet aus Ragusa. Einmal schreibt er von einem Abendessen, bei dem es über einige höchst seltsame Menschen zu berichten gibt.
Der Rektor, so nennen sie hier ihren Bürgermeister noch immer, hat zu unserem Abschied ein Abendessen gegeben. Wir reisen zwar erst übermorgen, aber die verschiedenen Verabschiedungsgänge haben schon begonnen. Zu dem Abendessen waren neben den wichtigsten Potentaten der Stadt Ragusa auch alle wichtigen Gäste eingeladen, die sich derzeit in der Stadt befinden. Unter diesen Gästen gab es eigentlich nur Menschen. die einem Panoptikum Ehre gemacht hätten.
Ivo war auch da. Ich war darüber etwas erstaunt, da sonst nur die Väter, nicht aber die Angehörigen der Potentaten Ragusas anwesend waren.
Er erklärte mir seine Anwesenheit: „Es hat schon seine Vorteile, mit Joseph Moritz Graf Dietrichstein befreundet zu sein.“
Ich war unruhig: „Du hast es...?“
Er setzte nickend fort: „...allen erzählt, daß wir Freunde sind! Und jetzt bin ich sogar ein wenig wichtig.“
„Wichtig?“
„Ich könnte ja was wissen.“
„Und - was weißt du?“
„Nichts, was die anderen etwas angeht. Und schließlich hast du mich ja genauso in der Hand, nicht, Freund?“ Er sagte das fast kämpfend.
„Ja, Freund“, antwortete ich nachdenkend. Es machte mich unruhig, daß ich ein Geheimnis hatte, mit dessen Wissen man mich ‚in der Hand haben’ konnte.
Als mir alle Anwesenden vorgestellt wurden, offenbarte sich eine recht wunderbare Mischung: da war eine russische Gräfin, ein italienischer Conte, ein anglikanischer Bischof und ein Wiener Advokat.
Die vier merkte ich mir; außer denen, die ich ohnedies schon kannte. Als nach dem offiziellen Essen, das übrigens wieder so viel von diesem Knoblauch enthielt, daß ich selber und alle meine Kleider unter der Achsel schon nach purem Knoblauch stinken, als es also nach dieser Knoblauchration gesellig zu werden begann, angelte ich mir den Ivo; er sollte mir über die vier erzählen, was er wußte.
Und er wußte allerhand.
Die russische Gräfin war vermutlich gar keine solche, wurde aber von ihrer Begleitung so genannt. Mir war sie schon als zweifelhaft aufgefallen, weil sie als Ranggleiche mit mir den kleinen Knicks vor mir gemacht hat, was nicht nötig war. Sie ist aber unermeßlich reich und darum sehr beliebt. Ihre Begleitung besteht aus einem jungen Mädchen, das der ‚Gräfin’ recht ähnlich sieht und als ihre Tochter vorgestellt wurde. Die zwei Damen haben aber auch noch einen jungen Mann dabei.
„Der Zuchtbulle für die beiden“, beschrieb ihn Ivo. „Der Freund der alten. Aber wenn der nicht auch die junge...“
„...wär’ er schön blöd!“, ergänzte ich.
Wir nickten beide wie Männer, die sich über die Weiber wieder einmal geeinigt haben, was uns beiden diebischen Spaß machte.
„Der italienische Conte ist ein wirklicher solcher“, sagte Ivo. „Er hat allerdings eine englische Frau, und die hat das Geld.“
„Schon die zweite Frau, die das Geld hat“, stellte ich fest.
„Die Engländerin in Bier und die Russin in Geheimdienst.“
„Geheimdienst?“
Ich war sehr unsicher: „Geheimdienst?“, fragte ich noch einmal: „Was ist denn das für ein Gemeindienst, wenn es jeder weiß?“
„Das wissen wir auch nicht. Aber es kommen immer wieder russische Kuriere, denen sie was mitgibt. Und diese Kuriere dürfen auch zur Nachtzeit in die Stadt.“
„Das dürfen nicht einmal die unsrigen“, wunderte ich mich.
„Eure sind ja auch nicht geheim“, war da die eher dumme Antwort.
Was hat die falsche russische Gräfin denn nach Rußland so Geheimes zu berichten, fragte ich mich. Ich beschloß, das unserem Wachestab zu melden, mir scheint aber jetzt fast besser, es einfach wieder zu vergessen.
Der Conte hatte vier sehr junge, sehr hübsche Männer in seiner Begleitung.
„Seine Freunde“, sagte Ivo kurz.
„Freunde?"
„Ja. Er reist mit ihnen seit drei Jahren.“
Ich muß gestehen, ich weiß nicht, was ich davon denken soll.
Ivo hat meine Ratlosigkeit wohl bemerkt, denn er meinte: „Denk’ dir halt zur Abwechslung einmal gar nichts.“
Da gab der anglikanische Bischof schon mehr zu denken. Ein alter, schlanker, mittelgroßer, durchgeistigter Herr mit leicht kurzsichtigem Blick und schwarzweißem Habit.
Ich fragte ihn, ob der Habit denn in einem solch heißen Sommer nicht sehr warm sei.
Da antwortete er freundlich: „Ich trage darunter nichts!“
Ich wechselte das Thema und wendete mich den zwei jungen Herren zu, die augenscheinlich zum Herrn Bischof gehörten, weil sie immer in seiner Nähe herumschwänzelten, aber dauernd miteinander sprachen und dann immer lächelten. Beide hatten etwas von Künstlern an sich, vor allem die großen Maschen, die sie um den Hals trugen. Während der eine sein Haar ganz kurz geschoren trug, hatte der andere eine zart auf die Schultern fallende, kleine Mähne. Beiden stand ihre Haartracht passend; man hatte das Gefühl, genauso müsse sie sein.
Der Herr Bischof stellte mir die beiden vor. Ein Violinist und ein Maler.
„Musik und Malerei“, meinte er galant in seinem singenden Tonfall, „ein charmantes Pärchen, nicht?“
Ich nickte zustimmend und sah mir die beiden an, die ihrerseits mich anlächelten, weil sie soeben was zueinander gesagt hatten. Wirklich ein charmantes Pärchen.
Der Herr Bischof aber fuhr fort: „Sie reisen mit mir. Und sammeln Eindrücke für ihre Kunst. Das ist meine persönliche Art der Kunstförderung.“
Ich dachte mir mein Teil, Ivo tat wohl das gleiche, was ich seinem Blicke ganz klar anzusehen vermochte.
Da entdeckte ich hinter den beiden noch einen jungen Mann. Er war zwar nach der gleichen Art wie die beiden Künstler gekleidet, allerdings ohne die große Masche, sein Gesicht wies ihn aber als Mann aus dem allerfernsten Orient aus.
„Und dieser Herr?“, fragte ich. „Auch der Kunst zugetan?“
Während sich der exotische Herr charmant lächelnd zu Ivo und mir verbeugte, antwortete der Herr Bischof mit giftigem Beigeschmacke: „Chinese. Werdender Arzt. Studiert die Anatomie. Derzeit die männliche. Den haben die beiden Künstler erst unlängst auf der Reise kennengelernt.“
Aha, dachte ich bei mir, und ich denke es noch: mit der Geige, dem Pinsel und einem gehörigen Wissen von der Anatomie, da ließ sich schon manch vergnügliches aufstellen. Auch unter den gestrengen Augen der Kirche.
„Über den Bischof weiß ich alles“, erklärte ich dem Ivo. „Was aber hat es mit dem Advokaten auf sich?“
„Das weiß keiner“, antwortete er. „Er ist bei Kollegen hier zu Besuch und führt einen Schauspieler im Gepäck.“
„Eine offizielle Mission?“, fragte ich.
„Der Advokat? Nein. Da liegt nichts an. Eure Gesetze habt ihr uns ja ohne viel Fragen aufgesetzt.“
Ich ging darauf nicht ein. Ich mußte aber lächeln, weil der Ivo gesprochen hatte von einem „Schauspieler im Gepäck“.
„Und der Schauspieler?“, fragte ich also.
„Ja, den müßtest du schon kennen. Vom Hof-Burgtheater.“
Ich sah mir den kleinen, etwas dicklichen, beim reden fürchterlich rudernden Schauspieler näher an, kenne ihn aber nicht.
„Muß neu sein“, meinte ich, „außerdem wird er wohl nicht viel spielen, wenn er Advokaten begleitet.“
Ivo zuckte die Schultern und führte mich sehr schnell zu einem kleinen, grauhaarigen Herren, den er mir mit Namen vorstellte und den er als Dichter bezeichnete.
„Nachdichter, Übersetzer“, verbesserte der Dichter bescheiden.
Ivo aber sagte: „Gib ihm die Hand und du erfährst alles über dein künftiges Leben.“
„Molim“, sagte der Dichter und blickte mich kokett und hündisch gleichzeitig an.
„Er bittet dich“, übersetzte Ivo.
Ich gab dem Dichter die Hand, die er sehr fest drückte. Er ließ die Hand so lang nicht aus, daß mir schon unbehaglich wurde und ich befürchtete, daß wir bald beobachtet würden. Ivo jedenfalls beobachtete uns sehr aufmerksam.
Da löste der Dichter plötzlich den Händedruck, faltete meine Hand, die fast zur Wurst gequetscht war, auseinander und betrachtete aufmerksam meine blutleere Handfläche und die Linien drinnen.
Plötzlich zog er aus seinem Wams auch noch einen Federkiel, mit dem er die Linien ganz sachte nachzeichnete, sodaß es mich schrecklich kitzelte.
Dann seufzte er tief, beugte sich näher zu meiner Hand, schüttelte den Kopf, zeichnete die Linien jetzt kräftiger und fast kratzend nach, nahm sich schnell meine andere Hand, blickte auch hinein, wandte sich unsicher zu Ivo und sagte zu ihm etwas in ihrer Sprache.
Ivo lächelte, schüttelte sichtlich ungläubig den Kopf und wandte sich dann zu mir: „Er traut sich nicht, es zu sagen. Er sieht nicht viel mehr als eine lange Liebe und dann sofort sehr bald viel Tod.“
„Lange Liebe und bald viel Tod?“, versuchte ich zusammenzufassen.
„Ja.“
Auch der Dichter nickte betrübt.
Ich aber antwortete scherzhaft: „Da werd’ ich doch lieber bei einem anderen Handleser arbeiten lassen.“
Damit entfernte ich mich mit einer Verbeugung - und mit dem Ivo.
„Spinnen bei euch alle?“, fragte ich belustigt.
„Nur die Gäste“, sagte er keck. „Wir Ragusaner sind ganz normal.“
„Aha“, blieb mir da nur zu sagen.
Damit beschließt Joseph Moritz seinen Bericht aus Ragusa, versorgt mit einer Prophezeiung, die er selbstverständlich nicht ernst nimmt.
Die Rückreise ist mit keinem Wort beschrieben.
(Ü 25.7.2004 / 3.1.2006)
KAPITEL 7
Das erste, was ich erfuhr, nachdem ich von Ragusa mühevoll zurückgekehrt war, ist der Tod der Fanny Arnstein gewesen.
Am Tag nach meiner Abreise am 3. Juni, glaube ich, ist sie verstorben.
„Ja“, sinnierte mein Vater, als er mir, nachdem ich Bericht abgestattet hatte, nun seinerseits erzählte, „die alte Jüdin ist nicht mehr. Schad’!“
Franziska (Fanny) Freifrau von Arnstein wurde am 29. 11. 1758 in Berlin geboren und starb am 8. 6. 1818 Wien. Sie war, zumindest wurde sie von ihrer Umwelt so bezeichnet, eine Philanthropin. Ihr Salon bildete einen geistigen und gesellschaftlichen Mittelpunkt, besonders zur Zeit des Wiener Kongresses. Sie war auch Mitbegründerin der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Ihr Gatte war der jüdische Bankier Nathan von Arnstein.
„Schad’!“, fuhr Vater fort. „Dort hat man wenigstens hingehen können, ohne daß sich unsereins genieren muß!“
Und nach einer kleinen Pause fügte er hinbei: „Im Gegenteil, gut war’s, wenn unsereins hingegangen ist.“
Des Vaters Betonung von „unsereins“, die der Sohn hier ausdrücklich erwähnt, weist uns deutlich auf den Ursprung des Standesdünkels hin, mit dem auch Joseph Moritz in reichem Maße ausgestattet ist.
Aber warum war es „gut, wenn unsereins hingegangen ist“? Die gehobene Gesellschaft war zu der Zeit in den Wiener Salons zu Hause; diese Salons bildeten oft bedeutende kulturelle Mittelpunkte. Die alten Adels- und Beamtenkreise konnten hier mit der neuen bürgerlichen Oberschicht zusammentreffen, „ohne sich genieren zu müssen“. Dabei gerieten die exklusiven Zirkel des Hochadels gegenüber jenen Aristokraten in die Minderzahl, die gemeinsam mit Bürgertum und emanzipiertem Judentum ihre kulturellen Interessen pflegten. Die Bedeutung des glanzvollen Salons der jüngst verstorbenen Fanny Arnstein zeigt, dass alte Vorurteile immer mehr in den Hintergrund traten. Unter den im Arnstein-Salon zu findenden Literaten waren zumeist die katholischen Romantiker zu finden. Mag sein, dass es vor allem der künstlerische Aspekt war, der Vater Dietrichstein in den nun ja zu Ende gegangenen Salon der Fanny Arnstein geführt hat.
„Ob der Salon der Pichlerin das bringt?“, sprach Vater weiter mit mir, aber in Wirklichkeit sprach er vor sich hin, für sich. Als ob ich gar nicht da gewesen wäre.
„Immer in die Alservorstadt hinaus...“, wackelte er mit dem Kopfe. Und er wackelte noch immer, selbst als er gar nichts mehr sagte.
Der literarische Salon der Karoline Pichler war ja der international viel berühmtere. Allerdings vermochte dort der Adel so gar keine Rolle mehr zu spielen.
„Schaut aus, als wollte man sich anbiedern an die, die jetzt vielleicht mehr Bedeutung haben als unsereins!“
Ich horchte sehr genau auf das, was der Vater da vor sich hinbrummte. Ich wußte nämlich bis dato nicht, daß die Besuche im Salon der Fanny Arnstein für Vater auch noch eine andere Bedeutung hatten, als die der Unterhaltung, des halbwegs gescheiten Gespräches, der Zerstreuung und des „Halt-Einfach-Nicht Zu-Hause-Seins“. Nein, da war noch was. Dort traf der Vater offensichtlich Leute, die zu treffen man sich sonst „genieren“ mußte. So jedenfalls habe ich ihn verstanden.
Mir ging da ganz schnell durch den Kopf, wie mir der Vater meine Besuche beim Schneider ausgetrieben hat. Beim Schneiderhans. Und gerade ob meiner erlesenen Kleidung war ich denen in Ragusa so besonders aufgefallen und habe Lob und Beachtung dafür geerntet.
„Da fällt unsereiner ja schon deshalb auf, weil er gar nicht das richtige G’wand hat, das die dort zur Schau tragen.“
Er sprach vom Salon der Pichler. Ich erschrak, weil ich meine geheimsten Gedanken in den Worten meines Vaters zu entdecken vermeinte, beruhigte mich aber sofort wieder, weil Vater ja wohl nur die Meinung ausdrücken wollte, daß er, der nach Hof-Vorschriften gekleidet ist, in Künstlerkreisen wohl als phantasielos und alltagsgrau auffallen mochte. Und das schmeichelte seiner Eitelkeit wohl nicht so recht. Denn mein Vater ist eitel. Und im tiefsten ein Künstler, kein Hof- Schranze. Im tiefsten. Das er nie zeigt. Das er mir nie zeigt, mein Vater.
Dennoch beschließe ich hiemit, daß ich demnächst - wenn auch insgeheim - sowohl den Schneiderhans wieder aufsuchen werde, als auch - wohlweislich hoffend, daß der Vater nicht hingeht - versuchen, in den Salon der Pichlerin Eingang zu finden.
Joseph Moritz „beschließt“ also. Und er hat deutlich die Eitelkeit des Vaters geerbt.
Im Folgenden gibt sich Joseph Moritz’ Tagebuch in fast drastischer Kürze.
Dem (noch nicht) Herzog begegnen wir derzeit nur selten. Zurzeit sehen wir den Buben nur in der Funktion eines Kindes, das der kaiserliche Großvater gerne zu offiziellen und – des Kaisers Meinung nach - für einen Buben vielleicht interessanten Ereignissen mitnimmt. Selbstverständlich hatte das Auftreten von Napoleon II. aber auch zeremoniellen Charakter; doch eben das soll ja in diesem Jahr noch eine gewaltige Umgestaltung erfahren.
Heute ist Vater später als sonst nach Hause gekommen.
„Heute“, wie so oft undatiert, muss am, wahrscheinlich aber ein paar Tage nach dem 22. Juli 1818 sein. Denn am 22. Juli hat Franz I. das unterschrieben, das der Vater jetzt eben als Neuigkeit nach Hause bringt.
Mutter war mit Migräne zurückgezogen. Der Hermann -
- der Kammerdiener, oder einer von ihnen -
- wollte das Abendmahl auftragen lassen. Der Vater hat aber nur „Laß er mich mit dem Zeug in Ruh!“ gerufen und hat sich in seine Gemächer zurückgezogen.
„Es ist heute sehr heiß draußen“, brummte der Hermann, als wollte er den Herren entschuldigen. „Der Herr ist sicher unpäßlich.“
Ich dachte zuerst auch so und las im kleinen Salon einige Gedichte von Collin. Das Licht, das noch durch das Fenster fiel, reichte vollkommen aus.
Da kam Vater langsam herein, setzte sich in den Fauteuil mir gegenüber und strahlte mir einen solchen Zwang aus, daß ich das Lesen unterbrach und ihn fragte, was denn sei, oder wie ihm denn sei.
„Seine königliche Hoheit“, sagte er dumpf.
Sein Zögling also.
„Was ist mit dem Buben?“, fragte ich erschrocken.
„Bub?“, fuhr er auf. „Du sprichst von dem Sohne Napoleons!“
Da ich ja nun wußte, woher der Wind wehte, versuchte ich einzulenken: „Verzeih’ er mir, Herr Vater. Aber was ist denn mit Seiner königlichen Hoheit?“
„Nichts!“, sagte er. Und etwas lauter noch einmal: „Nichts!“
Und als ob er sich selber verbessern wollte, sagte er mit korrigierend erhobenem Zeigefinger: „Nichts mehr!“
Ich aber schwieg, weil ich mich nicht auskannte. Tot war der Bub ja wohl nicht, da hätte der Vater nicht so herumgeredet. Also wartete ich.
Und dann sprach er es aus: „Seine Majestät hat vorgestern -“
Sic! Vorgestern, das war der 22. Juli 1818, also haben wir „heute“ den 24. Juli.
„- die Papiere unterschrieben. Er mußte die Verbündeten Österreichs beschwichtigen. Ein Opfer, das eine Idee ruiniert.“
Vater hielt bewegt inne, sprach aber dann entschlossen weiter: „Parma wird nach dem Tod Marie Louises den Bourbonen zurückgegeben. Keine kaiserliche Hoheit mehr, und keine königliche Hoheit auch nicht...“
Den für Vater höchst unüblichen und seine Bewegung verratenden Sprachfehler überhörend, fragte ich zaghaft: „Und? Was ist er jetzt? - Der Herr Bub?“
Ich getraute mich, jetzt, wo er keine Hoheit mehr ist. Vater ließ es auch durch; er antwortete nur: „Durchlaucht.“
Naja, dachte ich, fragte aber: „Herzog?“ Vater nickte: „Von Reichstadt oder wo.“
„Wo ist denn Reichstadt?“
„Irgendwo in Böhmen.“
„Und von dort ist er jetzt - Durchlaucht?“
„Ja.“
Unwille war in Vaters Stimme.
„Herzog.“
Noch mehr Unwille.
„Herzog von Reichstadt.“
Das hatte schon fast geklungen, als wollte Vater erbrechen.
Oder weinen.
Der Ex-König von Rom, Ex-Napoleon II., Ex-Prinz von Parma wurde damit zum ersten Untertan - hinter allen Erzherzögen des Kaisertums Österreich.
Ich aber erlaubte mir, das alles nicht so schlimm zu finden.
Im Gegenteil: „Soll er doch froh sein, der Bub, daß er den Napoleon los ist!“, rief ich, eingedenk der vielen Anfeindungen, die er hatte erfahren müssen, nur weil er Napoleon II. ist - oder vielmehr war.
Vater aber belehrte mich schreiend eines Besseren, des seiner Meinung nach Richtigen: „Schweig’ er still! Der Knabe ist ein geborener Kaiser. Und kein Herzog. Kaiser der Franzosen! Und nicht der Herzog von irgendeinem böhmischen Kaff!“
Wir wissen, dass es der oftmals formulierte „glühende Wunsch“ des Grafen Dietrichstein war, seinen Zögling auf den französischen Thron vorbildlich vorzubereiten, um ihn dann einmal auf diesem Thron zu sehen. Das war nun alles entschwunden, der Politik geopfert, der Kaiser Franz I. zu folgen hatte.
Was blieb, war die Person des Sohnes des - noch lebenden - Napoleon, der der Obhut des österreichischen Kaiserhofes mehr oder minder freiwillig - von beiden Seiten gesehen - anvertraut war, und der, wie auch immer, vom Grafen Dietrichstein und seinem Stab erzogen werden musste.
Was aber noch auffällt, ist die fast dramatische Form der Dialognotiz, die Joseph Moritz hier gewählt hat. Er datiert nicht, er schreibt. Gewissenhaft und möglichst geformt. Er schreibt ein Tagebuch. Aber wenn er dann einmal schreibt, dann ist er kein einfacher Chronist mehr mehr, dann ist er ein Dichter. Dann schreibt er ein Buch. Einen Roman? Über sich. Er schreibt schonungslos alle seine Schwächen hinein. Weiß er so genau um seine Schwächen? Ist er so raffiniert, sie absichtlich hineinzuschreiben? Seine schwule Immer-Wieder Sexualität zum Beispiel, die ihn ja auch letztendlich dem Herzog - nun dürfen wir ihn ja endlich so nennen – nahe führt, die ihn in den Wirbel treibt, den der Herzog bei seinem Untergang erzeugt, und der ihn dann mitreißen wird. Wir wissen so vieles aus der Geschichte, wir wissen heute über die großen Zusammenhänge mehr, als Joseph Moritz damals wissen konnte. Aber spielt das denn eine Rolle?
Was wir nämlich sicher wissen, ist, dass Joseph Moritz gerne ein Dichter gewesen wäre und unglücklich war, dass er sich als solcher so gar nicht fühlte dass er sich nicht glaubte.
Mag sein, dass wir darüber einmal Klarheit finden werden. Aber niemand anderer hat jemals auch nur ei Wort über Joseph Moritz berichtet. Er ist selbst der einzige, der über sich schrieb. Die Quelle ist also höchst subjektiv.
War heute wieder auf der Bastei. Es ist die Luft dort einfach besser. Herrlicher Rundblick auf die Vorstädte. Man muß hin und wieder hinauf auf die Basteien, damit einen die Leut’ sehen.
Habe auch die witzige Bemerkung vernommen: „Auf welchem Ei tritt ganz Wien herum, ohne es zu zertreten? - Auf der Bast-Ei!“
Es gibt Leut’, die lachen jetzt.
Sie haben heute auch den Herzog ausgeführt. Ausgeführt, ja. Vier Wachen um ihn herum und hinter ihm - ich glaube, es war der Collin. Mißmutig sah er aus, der Collin, wenn er’s war.
Nicht aber so der Herzog, dem schien es Spaß zu machen, daß sie alle zusammenschraken, wenn sie ihn erblickten und sich dann hinter seinem Rücken, wenn er vorbei, oder wenn man vorbei war, zuflüsterte, schau, das ist doch der... Manchmal drehte er sich, wenn die Leut’ vorbei waren, schnell um und freute sich, wenn er sah, wie sie die eben zusammengesteckten Köpfe wieder auseinanderrissen.
Einen Augenblick lang war ich unaufmerksam, da hörte ich die Stimme ganz nahe bei mir: „Wenn er das seinem Vater erzählt, wird er mir wegen unziemlicher Ungezogenheit eine Strafe erteilen.“