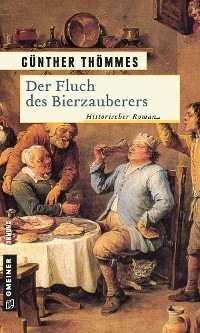Kitabı oku: «Der Fluch des Bierzauberers», sayfa 5
10.
Tagelang hockten sie in der Brauerei, die Köpfe in den Büchern vergraben. Sie diskutierten, machten Vorschläge und verwarfen viele ebenso schnell wieder.
»Nachdem die Hopfengärten vernichtet sind, müssen wir uns andere Würzmittel suchen«, schlug Knoll gleich am Anfang vor.
»Dann werden unsere Weiber aber kein Bier mehr trinken.«
Knoll nickte verständnisvoll. Schließlich war Hopfen seit jeher als äußerst empfängnisfördernd betrachtet worden.
»Hopfen macht die harte, verschlossene Mutter wieder weich«, zitierte Flügel ein gängiges Sprichwort.
»Und Bier, das nicht gehopft ist, macht Winde und wird bald sauer«, fügte Knoll eine weitere Volksweisheit hinzu. »Obwohl das auf den Broyhan weniger zutrifft. Aber es scheint, als müssen wir alles an uns und unseren Weibern ausprobieren, bevor wir neues Bier unter die Leut’ bringen.«
»Aber auch die Gerste als wichtigster Rohstoff sollte nicht in Stein gemeißelt sein«, war Flügel weiteren schmerzhaften Änderungen nicht abgeneigt.
Als neue Rohstoffe, neben den Getreidesorten Hafer, Weizen, Emmer, Hirse und Roggen, erwogen sie auch die Verwendung von Runkelrüben, Apfel- und anderem Obstsaft sowie Honig. Sogar Bier aus Kohl wurde erörtert.
»In Knaustens Buch ist die Herstellung eines Honigbiers genau beschrieben«, bewies Knoll seine Lateinkenntnisse.
»Im Krieg ist der aber auch knapp und wertvoll.« Flügel kannte die wirtschaftlichen Verhältnisse in Bitburg besser.
»Wir werden Bier brauen mit dem, was wir bekommen«, war Knoll aber nicht unterzukriegen.
Flügel zeigte Knoll eine Pflanze, die dieser noch nie gesehen hatte. Länglich, dick wie ein Unterarm, voll mit speckigen, grünen Blättern. »Der Seefahrer Kolumbus hat diese Pflanze in Amerika entdeckt, die Spanier haben diese Frucht mit zu uns gebracht. Sie soll essbar sein, wir wissen aber nicht, wie.«
Knoll schälte die Blätter ab und enthüllte einen gelben Kolben, vollbesetzt mit Körnerreihen. Er biss herzhaft hinein und verzog das Gesicht. »Sauer und schmeckt wie Gras.« Der Geschmack erinnerte ihn an die harten Zeiten unterwegs, als sie Gras essen mussten, um zu überleben.
»Wie nennt man diese Frucht?«
»Die Spanier nennen sie Mais, die Habsburger Kukuruz.«
»Vielleicht kann das Vieh sich davon ernähren. Dann frisst es uns den Hafer nicht mehr weg.«
Gewürze als Hopfenersatz zu beschaffen, das würde einfacher sein. In allen Büchern wurde beschrieben, wie in alten Zeiten, vor der Einführung des Hopfens, das Bier gewürzt worden war. Die Liste wurde länger und länger: Tannenzapfen, Holunder, Wermut, Fichtensprossen, Ingwer, Wacholder, Gurkensamen, Nelken, Pfeffer …
Vieles wuchs einfach in den Wäldern und Wiesen um Bitburg. Manches war durch den Krieg unerschwinglich geworden, wie Pfeffer und andere Handelsgewürze. Besonders interessant war der Biberklee.
Biberklee wuchs in den Flussauen von Kyll, Nims und Prüm, den drei Flüssen im näheren Umkreis Bitburgs. Die dreiteiligen Blätter und die Wurzeln, viel größer als die gewöhnlichen Klees, enthielten einen starken Bitterstoff – einen der stärksten in der Natur überhaupt, der seit langer Zeit zur Behandlung von Koliken und Blähungen, aber auch bei Erschlaffung der Organe und des Darms verwendet wurde. Auch zur Fiebersenkung, bei Ohrenfluss, Hautausschlägen, sogar bei Traurigkeit, Schluckauf, Bleichsucht, Gicht, Wassersucht und Hysterie wurde Biberklee seit jeher empfohlen.
»Das wäre doch mal einen Versuch wert«, schlug Knoll vor. »Das macht uns vielleicht den Verlust unseres geliebten Hopfens mehr als wett.« So schickten sie ein paar Jungen auf die Suche, den Biberklee zu finden und zu ernten.
Unter den Jungen befand sich neben Ulrich Knoll auch Flügels gleichaltriger Sohn Johann. Ulrich hatte schnell in die Gruppe hineingefunden, die tagsüber die kleine Stadt unsicher machte. Johann, der unter den Jüngeren der Wortführer war, hatte ihm den Einstieg erleichtert. Die beiden Jungen hatten einander, wie ihre Väter auch, gleich gemocht. Tagaus, tagein strolchten sie nun durch die Gegend, machten sich einen Spaß daraus, trotz der Ermahnungen der Eltern heimlich aus der Stadt zu verschwinden und später am Tag, bei ihrer Rückkehr, die Stadtwache anzuflehen, sie nicht zu verraten. Die kleineren Buben waren draußen fast keinerlei Gefahren ausgesetzt, aber sobald sie älter als zwölf Jahre waren, konnte es gefährlich werden. Vorbeiziehende Truppen ergriffen gelegentlich die Heranwachsenden, entführten sie, um sie als Dienstboten zu missbrauchen, oder rekrutierten sie sogar zwangsweise als Soldaten. Daher hatten alle Eltern ein wachsames Auge darauf, dass ihre älteren Kinder in der Stadt blieben.
Auch Flügel hatte noch eine Tochter: Sophia, die ein Jahr älter war als Knolls Tochter. Beide waren zu jung, um zur Biberkleeernte mitzukommen. Also versuchten hier die Mütter, Freundschaft zwischen den beiden Mädchen zu stiften. Doch die beiden verstanden sich nicht auf Anhieb so gut wie ihre Brüder. Das lag zum großen Teil daran, dass Sophia Angst hatte vor der zerbrechlichen, feengleichen Gestalt Lisbeths. Das Mädchen, das seine ersten Lebensjahre in der Kakushöhle verbracht und dementsprechend wenig Sonnenlicht gesehen hatte, war nicht nur für Sophia wie ein Wesen aus einer anderen Welt. Hellblonde, fast weiße Haare, die zu ihrer hellen, fast durchsichtig schimmernden Haut überhaupt keinen Kontrast bildeten, umrahmten ein zierliches Engelsgesicht, dessen dünner Hals auf einem ebenso mageren, zerbrechlich wirkenden Körper saß. Ihr bisheriges Leben war geprägt gewesen von Hunger, Elend und endlosen Wanderungen durch zerstörte Landschaften. Sie hatte es bald nach ihrer Geburt schon aufgegeben, sich über Mangel an Nahrung oder Wärme schreiend zu beklagen. Instinktiv hatte der Säugling gemerkt, dass seine Mutter ihm alles gab, wozu sie fähig war. Weshalb sollte das Mädchen dann noch etwas fordern, wenn nichts mehr da war? Obwohl es zurzeit wieder aufwärts ging, blieb Lisbeth Magdalena schweigsam und bescheiden. Sie fragte nicht nach, sie nahm sich einfach, was sie brauchte, sofern sie es mit ihren spindeldürren Beinchen, auf denen sie staksend daherkam, erreichen konnte. Ansonsten saß sie meist auf dem Fußboden, spielte mit Steinen und Stöckchen, die sie aufgelesen hatte oder sang Kinderlieder vor sich hin, die auch hier im Habsburgerland im Krieg entstanden waren, wie das beliebte ›Schwedenlied‹: »Die Schweden sind gekommen, haben alles mitgenommen, haben’s Fenster eingeschlagen, haben’s Blei davongetragen, haben Kugeln draus gegossen, und die Bauern totgeschossen.« Während sie das Liedchen vor sich hinträllerte, liefen Magdalena Tränen die Wangen hinunter.
11.
Die Männer unterbrachen ihr Bücherstudium gelegentlich, um einander aus ihrem Leben zu erzählen. Knoll berichtete wehmütig vom Untergang Magdeburgs; Flügel steuerte neben seiner eigenen Familiensaga auch Anekdoten aus der bewegten Bitburger Biergeschichte bei. Er erwähnte Niklas von Hahnfurt, der im Jahr 1276 die Brauerei gegründet hatte, in der Flügels Urahn einst als Lehrling eingestellt worden war und sie anschließend übernommen hatte.
»Aber Niklas war nicht der erste Brauer in Bitburg. Die de Foros waren schon länger Bierbrauer. Obwohl, ich bin mir nicht sicher, ob man deren Gebräu Bier nennen konnte«, lachte er los. »Und vor den de Foros waren es Benediktinermönche in St. Maximin, die zuerst in Bitburg Bier brauten, wenn auch überwiegend, um den eigenen Durst zu stillen.«
Er holte zwei Krüge des letzten Biers, setzte sich Knoll gegenüber und begann zu erzählen. »Die älteste Geschichte, die es in Bitburg über Bier gibt, stammt von diesen Benediktinermönchen. Die brauten wohl ein wahrhaft gutes Bier, das weit und breit gerühmt wurde. Aber eines Tages starb ihr Abt und ein neuer wurde bestimmt. Dieser hieß Vincenz von Urtingen und kam irgendwo aus dem Süden des Landes zu uns in die Eifel. Er war ein strenger Ordensmann, der den Mönchen das Bierbrauen zwar weiterhin erlaubte, ihnen aber verbot, es selbst zu trinken. Diese Verordnung nahmen die Brüder nur äußerst schweren Herzens hin, weil sie doch jeden Abend in der Braustube zusammenkamen, um nach der Andacht und dem Nachtessen bis um Mitternacht dem guten Bitburger Bier zuzusprechen.« Flügel und Knoll stießen mit den Krügen an, dass das Bier herausschwappte. Der Bitburger Brauherr fuhr fort: »Der neue Abt achtete sehr auf Einhaltung seiner neuen Anordnung und so herrschte schnell schlechte Stimmung im Kloster. Die Brüder beratschlagten, wie man diese Anordnung umgehen könnte. Sie dachten dabei an die Mönche des Klosters Himmerod, die der Abt aus ähnlichen Gründen um ihren allabendlichen Weinschoppen gebracht hatte. Bald darauf starb einer nach dem anderen, bis ein berühmter Arzt aus Frankreich feststellte, dass es keine Seuche war, sondern eine Infektion, die durch unsaubere, vernachlässigte Weinfässer verbreitet wurde. So einfach lag der Fall hier aber nicht. Die Mönche sannen auf eine List, um die Absichten ihres Oberen zu durchkreuzen. Ihnen fiel aber absolut nichts ein, bis ihnen der Zufall zuhilfe kam. Während im Kloster noch tiefe Enttäuschung herrschte, und die Mönche die Köpfe hängen ließen wie Blumen, denen man Licht und Wasser entzogen hatte, erschien plötzlich der Trierer Bischof zu Besuch. Er wunderte sich sehr über die düstere Stimmung im Kloster und fragte den Abt nach dem Grund dieser Veränderung. Er kannte die Klosterbrüder von früheren Besuchen als Männer, die bei aller Pflicht einigen irdischen Freuden durchaus nicht abgeneigt gewesen waren. Der Abt konnte die Frage jedoch nicht beantworten. Während das Essen serviert wurde, ließ der Bischof zur Feier des Tages Bier auftragen. Als die Krüge auf die Tische gestellt wurden, erstrahlten die Gesichter der Mönche, die beinahe vergaßen zu essen und sich wünschten, der Bischof möge dem Kloster am besten jede Woche einen Besuch abstatten. Der Gast trank einen Schluck aus seinem Krug und verzog dabei das Gesicht, als ob er Essig getrunken hätte, sprang auf und verlangte ein Glas Wasser, da, wie er es formulierte, das Bier nach faulem Käse schmecke. Der Abt war verzweifelt und rief den Bruder Braumeister zu sich, der seinen und den Tadel des Bischof übernehmen sollte. Dieser aber bewahrte Ruhe und parierte den Vorwurf, er habe sein Amt vernachlässigt und das Bier schlecht werden lassen, mit den Worten: ›Woher, werter Bischof, soll ich wissen, dass mein Bier nach faulem Käse schmeckt, da unser hochwürdigster Abt mir und allen Brüdern verboten hat, es zu trinken? Früher war es Pflicht und Ehrensache, in einmütiger Runde die Erzeugnisse des Klosters zu verkosten, damit sein Ruf erhalten bleibt.‹ Nachdem er sich so verteidigt hatte, verschwand der Braumeister mit schnellen Schritten. Der Abt errötete und erblasste abwechselnd, als der Bischof ihn daraufhin ansprach, ob es mit den Worten des Braumeisters seine Richtigkeit habe. Der Klostervorsteher musste es wohl oder übel zugeben. Daraufhin schüttelte der Bischof den Kopf und sagte: ›Brüder des Herrn! Es freut mich zu hören, dass Ihr Eure Pflichten nicht vernachlässigt habt und die mindere Qualität des Bieres lediglich auf den Übereifer unseres verehrten Abts zurückzuführen ist. Ich lege ihm daher nahe, sich ein anderes Kloster zu suchen, in dem kein Bier gebraut wird!‹« Knoll lachte laut los, Flügel stimmte ein, bevor er prustend fortfuhr: »Der Abt fiel auf die Knie, küsste den Saum des bischöflichen Gewands und bat, Bitburg auf der Stelle verlassen zu dürfen. Er wolle zu Fuß durch das Land wandern und seine Schuld büßen.«
»So ein Narr«, meldete sich der Magdeburger zu Wort. »Bier war doch sicher das Beste, was es damals zu trinken gab. Ich hoffe, er hat ein Kloster gefunden, in dem nur Wasser getrunken wurde.«
»Nein, natürlich nicht«, schloss Flügel die Geschichte ab. »Die Sage geht so, dass der arme Vincenz für den Rest seines Lebens umhergeirrt sei, bis ihn der Tod gnädig erlöste, denn ein Kloster ohne die ehrbare Braukunst habe er nicht gefunden.«
Beide prosteten sich wieder lachend zu und leerten die Krüge. »Was geschah mit dem Kloster?«, fragte Knoll.
»Das Stift St. Maximin gibt es noch, es liegt außerhalb der alten Stadtmauern, gleich beim südlichen, dem Trierer Stadttor. Aber gebraut wird dort nicht mehr.«
»Wie ist dein Bruder dann durch die ersten Kriegsjahre gekommen?«, führte Knoll das Gespräch zurück in die Gegenwart.
»Ach, zuerst war es nicht schlimm. Mühsam wurde es erst, als die Wipper und Kipper das Kommando über die Münze übernahmen. Da konnte unsereins kein Geld mehr verdienen mit dem Bier. Also haben wir den Ausschank gegen leichte Münze verweigert, und nur noch Silber angenommen oder gleichwertiges. Das hat uns das Geschäft gerettet. Aber gleich nach der Münzreform, kam aus Luxemburg ein Erlass, dass wir das Bier wieder gegen klingende Münze ausschenken müssten. Seither ging es so, bis mein Bruder plötzlich gestorben ist.« Flügel holte tief Luft, zeigte, dass ihm dieses Thema unangenehm war und er das Gespräch hier beenden wollte. Beide wandten sich wieder ihren Büchern zu, denn sie hofften inständig, endlich mal wieder einen Sud einmaischen zu können.
12.
In den nächsten Wochen erhielt die Stadt Bitburg noch weiteren Zuwachs. Auch andere Familien hatten sich auf ihrer Flucht durch das gebrandschatzte Deutschland hierher durchgeschlagen. Ein Ehepaar mit drei Kindern namens Zangerle stammte aus Tirol, eines mit Namen Häberle, deren Kinder unterwegs gestorben waren, aus der Nähe von Donaueschingen und Paul Röhr, ein Bulle von einem Mann, dessen Trauer darüber, dass er in diesem Krieg seine gesamte Familie verloren hatte, tiefe Furchen in sein Gesicht gegraben hatte, war den weiten Weg von Schlesien gekommen. Alle Neulinge wurden in die Häuser für die Zugezogenen einquartiert und somit Knolls Nachbarn, und alle wiederum berichteten grauenhafte Geschichten aus dem Krieg, als sie abends beisammen saßen. Der schlimmste Bericht kam von Röhr, der über zwei Jahre lang auf der Flucht gewesen war.
»Ich stamme aus der Stadt Goldberg und war dort Stellmacher. Viel Geld habe ich verdient, weil ich für unsere Bauern Räder, Wagen und Pflüge gebaut habe. Und solide Karren für die Händler. Ein schönes Haus besaß ich, hatte ein treues Weib und drei Kinder. Bis im Oktober 1633 spanische Soldaten von Wallensteins Truppe unsere verschlossenen Stadttore mit Äxten einschlugen. Niemand setzte sich zur Wehr, wir ergaben uns und beteten, die Weiber schrien und weinten. Doch die verdammte Soldatenbrut, die tobte wie der Teufel! Jedes Haus wurde aufgebrochen, geplündert und ausgeraubt, die rasenden Bestien haben alles niedergeschossen und erstochen, wie es ihnen beliebte. Sie hatten sich eigens Hämmer angefertigt, mit denen sie den Bürgern gegen die Köpfe schlugen, wie ein Fleischhauer einen Ochsen tötet. Sie traten mit ihren Füßen alles und jeden, bis das Blut nur so herumspritzte.« Alle schüttelten sich vor Grausen. »Die Offiziere aber, diese gottlosen und verruchten Bösewichter, die waren die grausamsten Ungeheuer. Sie fesselten die Ratsherren und zwangen sie, ihre Pferde zu halten, während sie in die Herrenhäuser eindrangen und alle Frauen schändeten, ob alt oder jung, Magd oder Hausherrin. Sie machten auch vor Kindern und älteren Menschen keinen Halt. Schließlich begannen sie, die Bürger zu martern, um Verstecke von Gold, Geld und anderen Gütern zu erfahren. Man legte ihnen Stricke um den Hals und zog sie nackt durch die Gassen, schlug mit Hämmern auf Knochen und Schädel, rieb raue Steine gegen die Stirnen, bis diese blutig waren, oder zog knotige Stricke um die Köpfe, dass die Augen aus den Höhlen heraustraten, und Blut aus Mund und Nase strömte. Auch mit Feuer, brennenden Kienspänen und heißen Schwefeltropfen auf nackter Haut hantierten diese Ungeheuer.«
Magdalena geriet bei den grausamen Schilderungen regelrecht in Seelenangst und umklammerte totenbleich den Griff ihrer Stuhllehne. Die Erinnerung, selbst an diesen Massakern teilgenommen zu haben – wenn sie auch nur geplündert hatte, erschien ihr im Nachhinein wie ein böser Traum. Und auch Knoll konnte sich nur schwer vorstellen, wie diese Männer, wenn sie mit ihren Untaten fertiggeworden waren, sich nach ihrer Rückkehr zu Hause von ihren frommen Gattinnen lieblich umarmen und verhätscheln ließen.
»Und wie bist du davongekommen?«, fragte er Paul.
»Ich war für einige Tage außerhalb der Stadt, um ein paar Achsen und Werkzeuge auszuliefern. Als ich zurückkam, brannte Goldberg. Ich wartete drei Tage lang vor den Stadttoren. Danach fand ich meine toten Kinder und meine erschlagene Frau und begrub sie. Mein Haus war teilweise abgebrannt und alles von Wert geraubt worden. Also bin ich fort gegangen.« Alle fühlten ähnlich, alle Mitglieder ihrer kleinen Gruppe einte ein vergleichbares Schicksal. Und Paul hatte Glück im Unglück: Ein Stellmacher lebte in Bitburg derzeit nicht.
Tatsächlich ergab sich gegen Ende des ersten Winters, den die Familie Knoll in Bitburg verbrachte, die Gelegenheit zu einigen Biersuden. Oetz in seiner Funktion als Stadtrichter, war Mitglied der Städtekammer und fuhr daher zweimal jährlich zum Ständetag nach Luxemburg. Dort hatte er über die Zeit einige gute Geschäftsbeziehungen aufgebaut, die er nun zum Nutzen der Brauer einsetzen wollte. Ein ihm bestens bekannter Händler bot sich an, eine ausreichende Menge Gerste aus Luxemburg zu beschaffen. Der hatte auch vom Hopfenmangel erfahren und zeigte sich in der Kenntnis des Brauens versiert genug, um den Brauern eine kleinere Menge Quassiaholz anzubieten.
»Das Holz kommt aus Südamerika und enthält wundervolle, würzige Bitterstoffe. Man muss es nur auskochen und danach den wässrigen Absud abfüllen«, wusste der Händler.
Weder Knoll noch Flügel hatten von diesem Holz jemals gehört, bestellten es aber dennoch. Damit die kostbare Fracht ohne Zwischenfall ihr Ziel erreichte, beantragte Oetz bei der Heeresleitung einen Geleitbrief zur Sicherheit, der ihn vor den eigenen, plündernden Soldaten schützen sollte.
»Ob das was nützen wird?« Die Brauer stellten das Papier zu Recht infrage.
Allerdings wurde es nicht benötigt. Die Gerste wie auch das Quassiaholz kamen wohlbehalten an. Die Brauer verarbeiteten ihre Ware so schnell wie möglich und gingen voller Elan ans Werk.
Auch etwas Honig, ein paar Pfund Rübenschnitzel und drei Eimer runzlige, vertrocknete Äpfel, die zu nichts sonst zu gebrauchen waren, wurden bereitgestellt. Dazu wurde der Biberklee gehäckselt, aufgekocht und dieser Extrakt in eine Blechkanne gefüllt. Die gleiche Prozedur wurde anschließend für das bittere Holz wiederholt. Der Extrakt des Quassiaholzes roch extrem scharf und bitter, sodass die Brauer sicher waren, ein ausgezeichnetes Würzmittel an der Hand zu haben. Seit Monaten hatten sich weder Soldaten noch Staatische blicken lassen, fast schien es, als herrsche endlich Frieden. Allerdings erwies sich dieser Eindruck als trügerisch. Denn alle Heerhaufen befanden sich lediglich im Winterlager und erwarteten ungeduldig das Frühjahr, auf dass die Gefechte wieder losgehen konnten.
»Weißt du«, sagte Knoll zu Flügel eingedenk dieser Tatsache, während beide im Maischbottich rührten. »Eigentlich passen die Brauerei und der Krieg gut zusammen: Das Bierbrauen findet in der kalten Jahreszeit statt, genau dann, wenn der Krieg Pause macht.«
»Wir sollten schauen, dass das ganze Bier zu Beginn der warmen Jahreszeit bereits getrunken ist, sonst wird es doch nur von den saufenden Soldaten requiriert«, fügte Flügel an. »Vielleicht vergeht ihnen dann die Lust aufs Kämpfen.«
»Meinst du, der Krieg wäre schon vorbei oder hätte niemals begonnen, wenn es kein Bier gäbe? Dann müssten wir aber Wein saufen.« Flügel schüttelte sich demonstrativ bei Knolls Worten. Jetzt saß beiden Brauern eindeutig der Schalk im Nacken.
Die ersten Sude nach den neuen Kriegsrezepturen stießen auf höchst gemischte Resonanz. Die beiden Brauer schlossen sich selbstkritisch den eher negativen Meinungen an und veränderten die Rezeptur dementsprechend. Sie klärten es mit frischem Ei und Asche, fügten etwas Salz und Wein hinzu sowie, als sie immer noch nicht zufrieden waren, Leinsamenöl. Damit gelang der Durchbruch, das Bier war genießbar und sie verkauften ihren ganzen Bestand. Sie gewannen eine wichtige Erkenntnis, und zwar, dass der Biberklee nicht wirklich schlechter war als das viel gepriesene Quassiaholz und dazu einen bedeutenderen Vorteil besaß: Er wuchs auf den Wiesen vor der Stadt und war somit umsonst. Deshalb beschlossen sie, nachdem sie ihre Lieferung aufgebraucht hatten, kein weiteres Bitterholz mehr zu bestellen.
Im Frühjahr begannen die Kämpfe erneut. Und auch wenn Bitburg nicht zu einer der streitenden Parteien gehörte, so befand sich die Stadt doch immer irgendwie mittendrin, umringt vom immerwährenden Krieg. Trier zog wieder mal gegen Luxemburg, dann auch noch gegen die Herren von Hamm. Bei einer Fehde zwischen dem Burgherrn zu Schloss Hamm und der Stadt Trier wurde Hamm belagert, wobei Bitburger Bürger Schaden erlitten, darunter auch die Schöffen Oetz und von Esch, deren Saat von den Pferden und vorbeiziehenden Truppen zertrampelt wurde. Doch es trat etwas ein, was in den Kriegszeiten Seltenheit hatte: Die Stadt Trier erstattete den Geschädigten tatsächlich Regress. Dieses wundersame Ereignis wurde dementsprechend gefeiert, mit dem letzten Bier aus Flügels Keller. Weniger entgegenkommend waren zwei Monate danach die Staatischen, die bei einem Angriff auf die Stadt, der abgewehrt werden konnte, Brandpfeile in die Unterstadt abfeuerten, sodass dreiundzwanzig Häuser Opfer der Flammen wurden. Tote gab es zum Glück nicht zu beklagen.
Zum Ende des kriegerischen Sommers versuchten die Luxemburger aufs Neue, Trier einzunehmen. Als dies wieder nicht gelang, wendeten sie die allseits bekannte, verheerende Taktik der verbrannten Erde an. Alle Weinberge und Keltern wurden zerstört. Die luxemburgischen Pferde durften sich an den Getreidesaaten satt fressen.
Die bösen Vorahnungen teilten die Brauer mit den anderen Bürgern von Bitburg. Sie zweifelten, dass das, was die Staatlichen übrig gelassen hatten, ihnen über den Winter reichen würde.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.