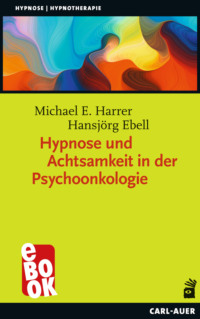Kitabı oku: «Hypnose und Achtsamkeit in der Psychoonkologie», sayfa 7
5.3.3Teilemodelle, Ambiguitätstoleranz und weitere Bedürfnisse im Kontext des klinischen Dialogs
Im Ursprung ist die Sehnsucht von Menschen, mit allen ihren Anteilen gesehen, gehört, verstanden und angenommen zu werden, wohl dem Bindungsbedürfnis zuzuordnen. So besteht die Kunst der Kommunikation oft darin, die unterschiedlichsten und naturgemäß widersprüchlichen Anteile der Patienten wahrzunehmen und zu würdigen: Das sind jene Anteile, die funktionieren, die Fassade aufrechterhalten und um jeden Preis als normal angesehen werden wollen. Das sind aber auch jene, für die nichts mehr normal ist, die sich als im Chaos versinkend erleben und in großer existenzieller Not sind. Und das sind nicht zuletzt jene Anteile, die den Alltag bewältigen können und wollen und möglichst konkrete Unterstützung bei dessen Neuorganisation brauchen. Wie in dieser Formulierung angedeutet, bieten sich Teilemodelle wie Ego-States oder das Modell des inneren Teams an, um der ständig wechselnden inneren Vielfalt gerecht zu werden. Die Übersetzung von Widersprüchlichkeiten, inneren Konflikten und Bedürfnissen in ein Teilemodell gehört zu den wesentlichen in diesem Buch vermittelten Grundkonzepten. Sie wird uns immer wieder begegnen, da sie sich in vielen Fällen als hilfreich erwiesen hat, innere Widersprüche zu ordnen und zu integrieren (Abschn. 8.5).
Die Konfrontation mit einer onkologischen Erkrankung bringt es mit sich, dass viele Sicherheiten und Eindeutigkeiten verloren gehen. So stellt sich die Aufgabe, mit Unsicherheit und Vieldeutigkeit bezüglich der eigenen Identität bzw. mit den »Teilidentitäten« umzugehen und damit möglichst gut zu leben. Um diese Aufgabe zu bewältigen und Unberechenbarkeit und Vieldeutigkeit gut auszuhalten, bedarf es eines hohen Ausmaßes an einer Fähigkeit, die als Ambiguitätstoleranz bezeichnet wird. Dabei kann sich unterstützend auswirken, sich einerseits auf den schlimmsten Fall vorzubereiten und alle Möglichkeiten seiner Handhabung zu durchdenken, andererseits auf das Beste zu hoffen. Im Pendeln zwischen den beiden Extremen gilt es, Schritt für Schritt und dem Lernprozess angepasst, das Gute zu sehen und anzunehmen und Zuversicht zu entwickeln. »Nicht länger warten« kann dabei eine hilfreiche Devise sein. Hierbei hilft die Achtsamkeit mit der erlernbaren Fähigkeit, den Fokus flexibel zu steuern.
Ungewissheit lässt sich aushalten, wenn das Bedürfnis nach Bindung erfüllt ist und das Gefühl vorherrscht, nicht allein zu sein, was immer auch kommen mag. Sie lässt sich aushalten, wenn das Bedürfnis nach Autonomie erfüllt ist oder der Patient zumindest ein Stück weit mitentscheiden und mitgestalten kann. Ambiguität ist auszuhalten, wenn das Bedürfnis nach Kompetenz erfüllt ist und Zuversicht besteht, handhaben zu können, was immer auch kommen mag. Sie ist auszuhalten mit einem Gefühl, dass es sich lohnt und Sinn macht, sich den Herausforderungen zu stellen. Mit dem Konzept der vier emotionalen Grundbedürfnisse im Hintergrund finden sich immer Möglichkeiten, die Ambiguitätstoleranz zu stärken.
In einem klinischen Dialog, der von einer wertschätzenden Beziehung getragen ist, werden weitere wesentliche Patientenbedürfnisse erfüllt (Engel 1992):
•etwas zu erkennen und, komplementär dazu, selbst erkannt zu werden
•etwas zu verstehen, selbst verstanden zu werden und sich verstanden zu fühlen
•sich selbst etwas erklären zu können, etwas zu wissen und etwas erklärt zu bekommen.
Die Erfüllung dieser Bedürfnisse stärkt Gefühle von Sicherheit, Vertrauen und Zugehörigkeit. Das Bedürfnis, zu verstehen und alles mit der Krankheit Zusammenhängende erklärt zu bekommen, wird am besten erfüllt von einem Arzt bzw. jenem Anteil eines Arztes, der die disziplinierte Neugier wissenschaftlichen Denkens verkörpert. Auf der Basis eines Vertrauensverhältnisses können Patienten oft darauf verzichten, alles genau bis ins Detail wissen zu wollen. Das Bedürfnis, auch in seiner Not gesehen, verstanden und ernst genommen zu werden, würde ein Behandler verkörpern, der sich dem Patienten aus einer Haltung mitmenschlicher Professionalität mitfühlend zuwendet. Bedenkenswert ist dabei die Unterscheidung zwischen verstehen (»understand«) und wissen (»know«). Sie begründet, warum sich ein Patient unverstanden fühlen kann, obwohl der Arzt mit Recht davon überzeugt ist, dass er ihm alles genau erklärt hat.
In diesem Dialog stellt sich in Zeiten der Digitalisierung bei vielen Patienten die Aufgabe, jene Informationen auf eine konstruktive Weise zu nutzen, die sie aufgrund umfangreicher Recherchen von »Dr. Google« aus dem Internet erhalten haben. In der Entscheidungsphase gilt es, die von den Patienten kommenden Impulse im Sinne ihrer Autonomie aufzugreifen und auf Augenhöhe zu diskutieren, andererseits die Patienten bei der Gewichtung der Informationen zu unterstützen und inmitten oft großer Verunsicherung wieder Orientierung zu ermöglichen.
5.4Biopsychosoziospirituell orientierte klinische Praxis
Onkologische Erkrankungen betreffen den ganzen Menschen und sein Umfeld. Bei der nahezu unendlichen Fülle von Informationen über den Betroffenen und seinen Kontext bedarf es der Orientierung, worauf der einzelne Behandler seine Aufmerksamkeit richten soll. Auf der biomedizinischen Ebene sind die Maßnahmen zur Diagnostik in der Regel recht klar. Beim Blick auf die Person wird – zumindest in der Theorie – das biopsychosoziale Modell mit seinen drei Ebenen zitiert (Engel 1992).
Für das notwendige kultursensible Vorgehen ist als vierte Ebene auch der soziokulturelle Hintergrund des Betroffenen und seines Umfelds zu berücksichtigen. Im Falle existenzieller Bedrohung muss in diesem Modell darüber hinaus die Sinndimension bzw. eine fünfte sogenannte spirituell-religiöse Ebene ergänzt werden – insbesondere als Ressource (Harrer 2001; Sulmasy 2002; Abschn. 9.2.1).
Exkurs: Miss Marple und das biopsychosoziale Modell
Der Schweizer Psychosomatiker Rolf Adler (2009) veranschaulicht das biopsychosoziale Modell anhand eines englischen Kriminalfilms. Der Film Der Wachsblumenstrauß – beruht auf einem Roman von Agatha Christie. Miss Marple und ihr Freund – der Bibliothekar Mister Stringer – ziehen durch die Straßen, um Geld für einen wohltätigen Zweck zu sammeln. Dabei kommen sie auch zur Türe des Herrenhauses des schwerreichen Mister Enderby. Sie öffnen die Haustüre und rufen nach dem Hausherren. Er erscheint im ersten Stock, fasst sich an die Brust, bricht zusammen, fällt die Treppe hinunter und landet vor den Füßen der beiden Bittsteller. Miss Marple muss erkennen, dass Mister Enderby tot ist. Sie steigt die Treppe hinauf, um zu klären, was genau passiert ist. Auf der Galerie öffnet sie eine Tür, woraufhin eine wilde, hässliche Katze über ihre Schulter springt und wieder verschwindet.
Miss Marple ist sofort klar: Es war Mord. Mister Enderby litt an einer chronischen Herzerkrankung (biologische Ebene) und hatte bekanntermaßen einen pathologischen Horror vor Katzen (psychische Ebene). Er wurde von einer Katze zu Tode erschreckt, die ein Besucher (soziale Ebene), wahrscheinlich einer der vier gierigen Erben, in böser Absicht in das Haus geschmuggelt hatte. Als Miss Marple den Todesfall auf der Polizeistation meldet und den zuständigen Inspektor über ihren Verdacht informiert, macht dieser sich über sie lustig. Er bleibt bei seiner festen Überzeugung, der Tod sei durch Herzversagen bedingt. So hatte es der Arzt diagnostiziert. Der Inspektor zeigt auch keinerlei Absicht, diesen Fall weiterzuverfolgen. (Er gibt sich mit der körperlichen Ebene zufrieden und sieht davon ab, psychische und soziale Informationen zu berücksichtigen.) Erst als es zu einem zweiten offensichtlichen Mord kommt, schaltet er sich – immer noch verärgert über Miss Marples Einmischung – in die Ermittlungen ein. (Das Ergebnis der Jagd nach dem Mörder soll hier nicht verraten werden.)
Miss Marple beharrt auf dem biopsychosozialen Modell im Sinne einer Top-down-Regulation (vom Gehirn gesteuerter körperlicher Reaktionsmuster): Mister Enderby war aufgrund seiner pathologischen Angst vor Katzen nicht dazu in der Lage, angemessen auf die unerwartete Begegnung zu reagieren. Der dadurch ausgelöste Stress aktivierte die Kampf-Flucht-Reaktion und das Selbstbewahrungs- bzw. Rückzugsmuster mit fatalen Auswirkungen auf sein Herz-Kreislauf-System. Auf der Organ- und Gewebeebene führte das über eine Durchblutungsstörung der Herzkranzgefäße und Sauerstoffmangel zu einer elektrischen Instabilität und schlussendlich zu Kammerflimmern und damit zum Tod.
Viele Ärzte erleben die Umsetzung des biopsychosozialen Modells mit seinen drei Ebenen bereits als Überforderung. Sie fragen nach der klinischen Relevanz und den praktischen Konsequenzen des Sammelns der Unzahl an Informationen, die sich in einem Patientengespräch gewinnen lassen und weitere Gespräche nach sich ziehen können. Vielfach geben sie den erhöhten Zeitbedarf beim Erheben auch von als relevant eingeschätzten psychosozialen Daten als Hindernis an.
In der Onkologie ist zumindest die Forderung nach einer mehrdimensionalen Diagnostik inzwischen allerdings unumstritten. Dabei geht es auch darum, nach sogenannten Komorbiditäten (Begleiterkrankungen) auf der psychischen Ebene zu fahnden, um beispielsweise eine Depression zu diagnostizieren und einer Behandlung zuzuführen. Man zieht dazu einen Psychoonkologen oder Psychiater hinzu und gegebenenfalls auch einen Sozialarbeiter. Vielleicht wird noch ein Seelsorger gerufen – in der Sterbephase. Der zuständige Arzt – wenn es einen solchen gibt – würde dann im optimalen Fall die Konsiliarbefunde dieser Fachleute lesen. Es stellt sich allerdings die Frage, inwieweit sich der Patient als ganze Person wahrgenommen fühlt, wenn das biopsychosoziale Modell auf diese Weise interpretiert und seine Umsetzung auf viele Personen verteilt wird.
In einer integrierten – und nicht fragmentierenden – Form der biopsychosozialen Medizin und einer resonanzbasierten Onkologie würde umgesetzt, was Wolfgang Wesiack (von Uexküll u. Wesiack 1991), ein Pionier der psychosomatischen Medizin, als diagnostischtherapeutischen Zirkel beschrieben hat. Diese Sichtweise widerspricht dem, was normalerweise in der Medizin als Dogma gilt – man müsse zuerst eine Diagnose stellen, erst dann könne man eine Therapie verordnen: Vielmehr entfaltet schon allein die gemeinsame Suche danach, was bei einer Krebserkrankung besonders belastet, eine therapeutische Wirkung. Die gemeinsame Anstrengung trägt dazu bei, dass der Patient sich selbst besser versteht, Worte findet, um sein Leiden auszudrücken, und dann auch noch erlebt, verstanden zu werden (vgl. Maio 2020). Werden das gemeinsame Verständnis und die zugehörigen Schlussfolgerungen zudem in der Behandlungsplanung berücksichtigt, entspricht das der Praxis einer patientenzentrierten und resonanzbasierten Medizin.
Auch wenn es nicht sehr viel mehr Zeit kosten und langfristig sogar Zeit sparen würde, bestimmte Fragen zu stellen, verstreicht die Zeit der Abklärung diesbezüglich leider meist ungenutzt. Denn kommen wesentliche Vorinformationen schon vor der Diagnosemitteilung zur Sprache, kann in diesem Zeitraum die therapeutische Beziehung aufgebaut und gestärkt werden. In dieser frühen Phase könnte eine diesbezügliche Einstiegsfrage lauten: »Wir wissen es ja noch nicht. Aber falls eine Behandlung notwendig ist, was sollte ich von Ihnen als Person wissen, damit wir Sie gut behandeln können?«
5.4.1Erweiterung des biopsychosozialen zum biopsychosoziospirituellen Modell
In einer biopsychosoziospirituellen Praxis stellt sich die Herausforderung, aus der Fülle der Faktoren, die in komplexen Wechselwirkungen stehen, jene Informationen herauszufinden und ihnen Platz zu geben, die im Einzelfall von Bedeutung sind. Der Behandler kann von sich aus zunächst nicht wissen, welche das sind. Aber er kann beispielsweise die zuvor genannte oder andere Fragen stellen. Er kann auf Hinweise hören, die der Patient ihm gibt, sie aufgreifen und vertiefend nachfragen. Das hilft dabei, auszuwählen und zu fokussieren.
Biopsychosoziale Medizin bedeutet auch, den Menschen auf dem Hintergrund seinerBiografie zu verstehen. Wenn sich etwa starke Gefühle oder schwer nachvollziehbare Reaktionen zeigen, gilt es nachzufragen. Dazu bieten sich möglichst einfache Fragen an, wie z. B:
•Was macht es Ihnen so schwer, die Chemotherapie zu akzeptieren?
•Haben Sie schon Erfahrungen mit Operationen?
•Kennen Sie jemanden mit einer ähnlichen Erkrankung?
•Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit Ärzten und anderem medizinischen Personal gemacht?
Im Kontext existenzieller Bedrohung und potenzieller Todesnähe stellen sich Sinnfragen und Fragen danach, was nach dem Tod kommt. Damit werden Fragen von Glauben, Spiritualität und Religion zum Thema. Viele Menschen beziehen aus diesem Bereich Kraft. So erscheint insbesondere im Bereich der Onkologie und der Palliativmedizin eine Erweiterung des biopsychosozialen Modells zu einem biopsychosoziospirituellen Modell notwendig (Abschn. 9.2.1).
Zur Klärung der Frage, auf welche Weise die verschiedenen Ebenen des biopsychosozialen Modells interagieren, haben die Stressforschung und die Psychoneuroimmunologie sehr viel beigetragen. Forschende aus diesem Gebiet fordern, die psychosoziale Ebene selbst dann zu berücksichtigen, wenn die Therapie nur auf die Beeinflussung des Krebswachstums abzielen würde (Ott et al. 2017). Aufgrund neuer Forschungsmethoden, die sich auf Prozess- und Einzelfallforschung beziehen, mehren sich die Hinweise, dass psychosoziale Faktoren – entgegen einer lange vertretenen Überzeugung – sehr wohl wesentlichen Einfluss auf den Krankheitsverlauf haben können.
5.4.2Pendeln zwischen Problemen und Ressourcen
Eine Dimension des Perspektivenwechsels in der therapeutisch wirksamen Kommunikation besteht darin, in Gesprächen zwischen der Problemperspektive und der Ressourcenperspektive zu pendeln, um Probleme möglichst frühzeitig mit Ressourcen zu verknüpfen. Vor dem Hintergrund des biopsychosoziospirituellen Modells kann man sich sowohl beim Blick auf die Probleme als auch bei dem auf die Ressourcen auf alle vier Ebenen beziehen. Beidäugiges diagnostischtherapeutisches Sehen (Fürstenau 2002) würde dann bedeuten, die Patienten durch eine »quadrofokale Gleitsichtbrille« zu betrachten (Abb. 3).

Abb. 3: Quadrofokale Brille zum beidäugigen Sehen
5.4.3Ökologie und Resonanz
Die Ärztin, Psychotherapeutin und Musiktherapeutin Monika Glawischnig-Goschnik (2019, S. 284) bezieht auch noch die ökologische Ebene mit ein:
»In einer Resonance Based Medicine wird den verschiedensten Ebenen des biopsychosozioökospirituellen Modells gleichwertige und gleich gültige Bedeutung zuerkannt. Die Wahl der spezifischen und passenden Intervention wird vor allem von der Dringlichkeit einer Behandlungsoption abhängen und von den intersubjektiven Resonanz- und Entscheidungsprozessen zwischen Behandlerin und Patientin, also von den Subjekten der therapeutischen Beziehung. Im Laufe dieses Resonanzprozesses erschließt sich zunehmend die Komplexität, kann formuliert und nachgefragt werden, und anhand von Leitlinien, persönlicher Expertise und unerwarteten Resonanzen und Einfällen können von den Subjekten brauchbare Interventionsmöglichkeiten entwickelt werden.«
Glawischnig-Goschnik erinnert daran, dass wir als menschliche Wesen Teil des Ökosystems unserer Erde sind, eingebettet in die Natur mit ihren natürlichen Rhythmen. Sie betont die Kostbarkeit der Liebe zur Natur, zu unserer Welt und zur Freude am Lebendigen. Resonanzerfahrungen mit der Natur stehen auch in schweren Zeiten als wertvolle Ressource zur Verfügung, an die zu erinnern sich immer wieder lohnt.
Der sogenannte Metatherapeut (S. 182) wäre aus der Beobachterperspektive dafür zuständig, die auftauchenden Resonanzen wahrzunehmen und gemeinsam mit dem Patienten zu gewichten. Dabei achtet er auf eine angemesseneBalance zwischen dem Blick mit beiden Augen auf die vier Ebenen.
5.5Erste Pyramidenstufe – Diagnostik: Abholen, informieren und Halt geben
Das Medizinsystem stellt sich traditionell primär die Aufgabe, Ursachen und Erklärungen für das Leiden zu finden, aus denen sich Optionen zu dessen Heilung oder Linderung ergeben. Darum findet sich auf der ersten Stufe der Kommunikationspyramide Abklärung und Aufklärung. Ärzte suchen nach Krankheitsbildern, die sich mit den Symptomen und Befunden des Patienten in Einklang bringen lassen. Sie geben den Patienten jene Informationen, die diese brauchen, um sich auch selbst ein Bild von ihrer Krankheit machen und orientieren zu können. Der Prozess von Abklärung und Aufklärung verläuft in unserem Modell im Rahmen einer Halt gebenden therapeutischen Beziehung, die von therapeutisch wirksamer Kommunikation und Resonanz geprägt ist (Abb. 4).

Abb. 4: Pyramidenmodell mit den Stufen einer therapeutisch wirksamen Kommunikation – die erste Stufe
Unabhängig davon, auf welchem Wege sich der Verdacht auf eine Krebserkrankung ergibt, stellt sich den Ärzten die Aufgabe einer angemessenen Diagnostik. Die Befunde und Symptome eines Patienten müssen mit diagnostischen Kategorien in Einklang gebracht werden. Auch wenn das in der Praxis derzeit wohl nur selten berücksichtigt wird, sollte aus unserer Sicht schon das diagnostische Vorgehen patientenzentriert schrittweise erfolgen. Dass das Einverständnis von Patienten auch für die Diagnostik notwendig und sinnvoll ist, wird bei genetischen Untersuchungen offensichtlich. Der Nutzen einer routinemäßigen Erhebung von Tumormarkern ohne Verdachtsmomente wird kontrovers diskutiert, z. B. beim prostataspezifischen Antigen (PSA).
In einer Medizin, in der es darum geht, Krankheiten zu behandeln, erscheint es logisch, dass diese diagnostiziert werden müssen. Aus einer patientenzentrierten Handlungslogik, mit deren Hilfe das subjektive Leiden von Menschen verringert werden soll, steht im Gegensatz zu einer krankheitszentrierten Logik die Frage nach den Auswirkungen und Konsequenzen jeder einzelnen diagnostischen Maßnahme auf dieses Leiden im Vordergrund. Zumindest wenn die Auswirkungen der einzelnen Schritte nicht eindeutig klar und als günstig zu bewerten sind, müssten sie hinterfragt und mit dem Patienten abgestimmt werden. Wenn etwa frühzeitig klar ist, dass jemand keinesfalls dazu bereit ist, sich einer indizierten Therapie zu unterziehen, stellt sich dringend die Frage, welche diagnostischen Erkenntnisse unbedingt erforderlich sind und ob sie den Betreffenden eher glücklich oder unglücklich machen.
Ob sich Menschen diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen unterziehen, hängt wesentlich von ihrem subjektiven Krankheitskonzept, vom Vertrauen in die Medizin und von der Beziehung zu ihren behandelnden Ärzten ab. Sowohl die von den Ärzten gegebenen Informationen als auch die zwischen den Zeilen vermittelte ärztliche Sicht beeinflusst alle drei Faktoren.
Versteht man Abklärung und Aufklärung als Prozess, gibt es immer wieder Möglichkeiten für Rückkopplungsschleifen im Sinne des diagnostisch-therapeutischen Zirkels. Die Reaktionen des Patienten auf erste Verdachtsmomente oder Befunde werden diagnostisch genutzt. Zugleich wirkt ein verständnisvoller, respektvoller und einfühlsamer Umgang mit diesen Reaktionen bereits therapeutisch.
Im Krankheitsverlauf ergibt sich immer wieder die Notwendigkeit, Nachrichten zu übermitteln: schlechte, manchmal weniger schlechte, manchmal auch gute. Ihre Vermittlung kann auf eine Weise erfolgen, die im besten Sinne gleichzeitig therapeutisch wirkt und diagnostisch in dem Sinn ist, dass sie neue Erkenntnisse über den Patienten und sein Umfeld bringt.