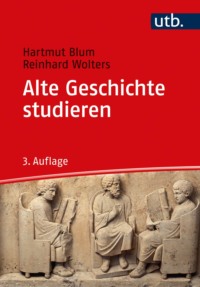Kitabı oku: «Alte Geschichte studieren», sayfa 6
2.2.7 QuellenkritikQuellenkritik und ‚Quellenforschung‘
Diese Beobachtung wirft eine weitere Kardinalfrage der QuellenkritikQuellenkritik auf: Woher konnte der Autor überhaupt das wissen, was er uns berichtet? Im Idealfall führt diese Frage zu älteren, den geschilderten Ereignissen näherstehenden Historikern, am Ende vielleicht gar zu Zeitzeugen des Geschehens. Solche Werke sind jedoch oft nicht mehr – oder zumindest nicht mehr vollständig – erhalten: Zum Beispiel wurde das monumentale Werk des Titus LiviusLivius (59 v. Chr.–17 n. Chr.), in dem er die Geschichte Roms von der Gründung der Stadt bis in das Jahr 9 v. Chr. behandelte, so stilbildend und erfolgreich, dass ein Großteil der von ihm verarbeiteten älteren römischen Geschichtsschreibung verloren ging. Hier gilt es nun, die Zuverlässigkeit der jeweiligen Gewährsmänner abzuschätzen, und zwar ebenfalls auf der Grundlage dessen, was man über Leben und Werk der betreffenden Personen in Erfahrung bringen kann. Allerdings sollte diese Art von Quellenforschung nicht zu schematisch vonstatten gehen. Es ist nämlich oft nicht klar, wie viel ein späterer Autor an einer bestimmten Stelle von einem älteren Werk unverändert übernommen hat, und in welchem Ausmaß eigene Umarbeitung vorliegt. Gerade bei Livius hatte eine auf die Spitze getriebene Suche nach den ‚Quellen der QuelleQuelle‘ in der Vergangenheit sogar zur Folge, dass die wesentlichen Fragen aus dem Blick zu geraten drohten: „Allzu oft konzentrierte sich das Bemühen darauf, einzelne Passagen (…) einer bestimmten Vorlage zuzuweisen, wobei das Ergebnis wegen der Schattenhaftigkeit der Vorgänger des Livius in vielen Fällen eine bloße Etikettierung war, ohne ersichtliche Relevanz für die Erforschung der geschichtlichen Ereignisse“ (J. v. Ungern-Sternberg).
Quellenforschung als Selbstzweck, das zeigt sich an diesemBeispiel, führt die Geschichtswissenschaft also eher in eine Sackgasse. Dabei kann die Antwort auf die Frage, ob unsere Quellen wirklich wissen, was sie zu wissen vorgeben, durchaus auch negativ ausfallen. Insbesondere die Berichte über die frühe römische Geschichte bis etwa 350/300 v. Chr. stehen unter dem Generalverdacht, fast völlig frei erfunden zu sein. Ein deutlicher Hinweis auf derartige Geschichtskonstruktionen sind so genannte Doubletten, d.h. beinahe identische Schilderungen verschiedener Ereignisse, sei es in ein und demselben Werk, sei es in verschiedenen Geschichtswerken. Es ist kein Zufall, dass Doubletten gerade in der frührömischen Geschichte häufig vorkommen. Schon LiviusLivius selbst konnte es seinen Vorlagen nicht glauben, dass sowohl die Latiner 340 v. Chr., als auch die Campaner 216 v. Chr. von den Römern angeblich gefordert haben, in Zukunft einen der beiden Konsuln stellen zu dürfen. Er hielt freilich die spätere Forderung für die Imitation der früheren (Livius 23,6,6–8; vgl. Livius 8,5,5), eine Annahme, die nicht unbedingt der historischen Wahrscheinlichkeit entspricht: Man wird bei der Beurteilung der Historizität von Doubletten vielmehr entweder das Erzählmuster insgesamt für eine Fiktion halten oder davon ausgehen, dass eher das ältere Ereignis einem realen jüngeren nachgebildet wurde als umgekehrt. Denn im Grundsatz ging es den römischen Geschichtsschreibern natürlich darum, Wissenslücken in der Frühzeit mit Material aus der besser belegten späteren Periode zu stopfen.
2.2.8 Die antike Biographie
Vergleichbar mit der Geschichtsschreibung im engeren Sinne, und als Quellengattung dementsprechend fast so wichtig wie diese, ist die antike BIOGRAPHIE. Auch Lebensbeschreibungen informieren nämlich, der Natur der Sache folgend, über Ereigniszusammenhänge, und selbstredend sind auch hier die oben erwähnten quellenkritischen Überlegungen anzustellen. Es gibt aber ebenso Unterschiede zwischen Historiographie und Biographie: In antiken Lebensbeschreibungen geht es in erster Linie um Charaktereigenschaften der skizzierten Person, d.h. vor allem um deren Tugenden und deren Laster. Tugenden und Laster offenbaren sich jedoch nach antiker Meinung seltener in geschichtlich bedeutsamen Ereignissen, sondern zumeist in scheinbar unwichtigen Situationen. Beinahe programmatisch formuliert hat dies PlutarchPlutarch von Chaironeia (ca. 46–120 n. Chr.), der wohl berühmteste Biograph des Altertums, der auch heute noch bekannt ist durch seine fast vollständig erhalten gebliebenen Parallelbiographien, in denen er große Griechen und Römer miteinander verglichen hat (wir besitzen noch elf von ursprünglich zwölf Biographiepaaren).
Quelle
Im ersten Kapitel seiner Alexandervita äußert sich PlutarchPlutarch zu seiner Arbeitsweise:
„Wenn ich in diesem Buch das Leben des Königs Alexander und das des Caesar, von dem Pompeius bezwungen wurde, darzustellen unternehme, so will ich wegen der Fülle des vorliegenden Tatsachenmaterials vorweg nichts anderes bemerken als die Leser bitten, wenn ich nicht alles und nicht jede der vielgerühmten Taten in aller Ausführlichkeit erzähle, sondern das meiste kurz zusammenfasse, mir deswegen keinen Vorwurf zu machen. Denn ich schreibe nicht Geschichte, sondern zeichne Lebensbilder, und hervorragende Tüchtigkeit und Verworfenheit offenbart sich nicht durchaus in den aufsehenerregendsten Taten, sondern oft wirft ein geringfügiger Vorgang, ein Wort oder ein Scherz ein bezeichnenderes Licht auf einen Charakter als Schlachten mit Tausenden von Toten und die größten Heeresaufgebote und Belagerungen von Städten.“ (PlutarchPlutarch, Alexander 1,1f.; Übersetzung K. Ziegler).
Das aber heißt nun, dass in antiken Biographien manches, das dem historisch Forschenden relevant erschienen wäre, unter Umständen gar nicht oder aber nicht gebührend berücksichtigt wird. Hinzu kommt, dass die Orientierung am Charakter bisweilen auch die Gliederung von Lebensbeschreibungen bestimmt, was dazu führen kann, dass der behandelte Stoff nicht immer streng chronologisch angeordnet ist. Dies ist beispielsweise der Fall bei SuetonSueton (mit vollem Namen: Gaius Suetonius Tranquillus, etwa 75–150 n. Chr.), der die Viten der römischen Herrscher von Caesar bis DomitianDomitian darstellte (100 v. Chr.–96 n. Chr.). Trotzdem bieten sowohl Sueton als auch PlutarchPlutarch einen im Grundsatz verlässlichen Faktenrahmen, und ihre Werke – wie auch andere Biographien – erweisen sich darüber hinaus immer wieder als unschätzbare Fundgrube für Informationen zu fast allen antiken Lebensbereichen.
2.2.9 Andere Literaturgattungen: Fachschriften, DichtungDichtung, Reden und Briefe
In diesem Sinne liefern noch zahlreiche andere antike Schriften eine unentbehrliche Ergänzung zur reinen EreignisgeschichteEreignisgeschichte, so zum Beispiel die einschlägige Fachliteratur aus vielerlei Wissensgebieten. Zu denken ist hierbei nicht nur an die großen Philosophen wie PlatonPlaton (427–347 v. Chr.) und AristotelesAristoteles (384–322 v. Chr.), oder an medizinische Schriften wie das so genannte Corpus HippocraticumCorpus Hippocraticum (4. Jh. v. Chr.). Von großem historischem Interesse sind auch geographische oder – im weitesten Sinne – naturwissenschaftliche Werke wie die Erdbeschreibung Strabons (ca. 63 v.–19 n. Chr.) oder die „Naturgeschichte“ des älteren Plinius (Gaius Plinius Secundus, 23–79 n. Chr.). Speziell für die WirtschaftsgeschichteWirtschaftsgeschichte wichtig sind etwa die Werke der Agrarschriftsteller CatoCato der Ältere (Marcus Porcius Cato, ca. 234–149 v. Chr.) und ColumellaColumella (Lucius Iunius Moderatus Columella, 1. Jh. n. Chr.), und in den Bereich der Völkerkunde fällt die berühmte Germania des kaiserzeitlichen Historikers TacitusTacitus (Cornelius Tacitus, um 55–120 n. Chr.), die vielleicht nicht so sehr über GermanienGermanien selbst Aufschluss gibt als vielmehr über die ETHNOGRAPHISCHEN Vorstellungen der Römer. Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang schließlich die juristische Fachliteratur, die wertvolle Einblicke in die gesellschaftliche Realität des Imperium Romanum besonders im 2. und 3. nachchristlichen Jahrhundert gewährt (Gaius, 2. Jh. n. Chr.; Papinian und Ulpian, beide um 200 n. Chr.).
Man sieht, dass es die Fragestellungen sind, die eine bestimmte Literaturgattung auskunftsfreudig erscheinen lassen. Nicht zuletzt gilt dies für die antike DichtungDichtung. Von der Bedeutung der homerischen Epen (8. Jh. v. Chr.) für die Kenntnis der frühgriechischen Gesellschaftsstrukturen war oben bereits die Rede; ähnliches trifft zu für die „Werke und Tage“ des HesiodHesiod von Askra in Böotien (um 700 v. Chr.), ein längeres Gedicht, in dem er seinen harten Alltag als kleiner Bauer schildert, der stets am Rande der Not lebt. Wieder andere Aspekte des täglichen Lebens werden in Komödien wie denen des AristophanesAristophanes beleuchtet (446–388 v. Chr.), und selbst den Tragödien, die üblicherweise eher ‚zeitlose‘ Probleme im mythologischen Gewand behandeln, kann eine gewisse ‚Aktualität‘ nicht abgesprochen werden: Immerhin haben Dramatiker wie AischylosAischylos (ca. 525–456 v. Chr.), SophoklesSophokles (496–406 v. Chr.) und EuripidesEuripides (480–406 v. Chr.) ihre Stücke für Wettbewerbe gedichtet, und es ist daher gewiss nicht übertrieben anzunehmen, dass sie damit einen ‚Zeitgeschmack‘ berühren wollten. Vor diesem Hintergrund aber lässt sich auch kürzeren Gedichten noch manches abgewinnen, denn auch sie repräsentieren zweifellos einen historischen Diskurs, ob man nun an die frühgriechische LyrikLyrik eines TyrtaiosTyrtaios (650 v. Chr.?), AlkaiosAlkaios (ca. 630 v. Chr.) oder SolonSolon (um 640–560 v. Chr.) denkt, oder an die kaiserzeitlichen Satiren eines JuvenalJuvenal (Decimus Iunius Iuvenalis, 58–130 n. Chr.).
 Abb. 9
Abb. 9
Marcus Tullius CiceroCicero, römische Porträtbüste, Florenz, Uffizien
Ein letzter großer Bereich antiker Literatur sind schließlich die Reden, Flugschriften und Briefe. Teilweise gehören diese Texte zu dem, was Hermann BengtsonBengtson, Hermann als „primäres Material“ bezeichnet hat (→S.44f.). Manches war freilich von vorneherein zur Veröffentlichung gedacht, so etwa die Briefe des jüngeren Plinius (Gaius Plinius Caecilius Secundus, ca. 61–112 n. Chr.), und auch die eine oder andere Rede ist ein reines literarisches Kunstprodukt und nie tatsächlich gehalten worden. Bei den übrigen Reden darf man wohl davon ausgehen, dass sie zumindest nicht in der Form vorgetragen wurden, in der sie überliefert sind. In der Regel besitzen wir nur eine spätere, für die Publikation überarbeitete Version, und diese kann vom Original natürlich erheblich abweichen. All dies gilt es zu berücksichtigen im Umgang mit solchen Erzeugnissen der antiken RHETORIKRhetorik. Gleichwohl liefern sie häufig Informationen aus erster Hand. Gerade die Zeitnähe vieler Reden und Briefe kann allerdings zur Folge haben, dass ihr Inhalt parteiisch und absichtlich subjektiv ist – dies zeigt sich beispielsweise bei den beiden berühmten Athenern IsokratesIsokrates (436–338 v. Chr.) und DemosthenesDemosthenes (384–322 v. Chr.), die uneins waren über die Frage, wie man es mit Philipp II. von MakedonienPhilippII. von Makedonien halten solle. Dies zeigt sich auch in aller Deutlichkeit in vielen Briefen und Reden Ciceros (Marcus Tullius CiceroCicero, 106–43 v. Chr.), die ein beredtes Zeugnis darüber ablegen, wie dieser in der turbulenten Endphase der römischen Republik gleich mehrmals die politischen Seiten gewechselt hat.
2.2.10 Einzelstelle und gesamtes Werk
Reden und Briefe, aber auch DichtungDichtung oder Fachschriften sind also in vielerlei Hinsicht als Quellen fruchtbar zu machen. Freilich werden Althistoriker auf den Ereigniszusammenhang, den narrative Texte – und das heißt hauptsächlich Historiographie und Biographie – stiften, nicht ganz verzichten können. Abschließend sei in diesem Zusammenhang noch auf Folgendes hingewiesen: Wichtig im Umgang mit antiker Literatur jedweder Art ist – und dies sollten die vorstehenden Darlegungen klar gemacht haben –, dass man stets den Autor einer Quellenstelle und das gesamte Werk im Blick behält, selbst wenn man eine Fragestellung bearbeitet, für die bloß ein kleiner Abschnitt daraus interessant ist. Nur wer sich an diese Vorsichtsmaßregel hält, vermeidet es, Darstellungsabsichten oder topische Bezüge zu übersehen und dadurch die Stimmigkeit der eigenen Interpretation zu gefährden.
Literatur
Einführungen:
M. Landfester (Hg.), Geschichte der antiken Texte: Autoren- und Werklexikon (= DNP Suppl. 2), Stuttgart 2007.
J. Bernays, Geschichte der klassischen PhilologiePhilologie, Hildesheim/Zürich 2008.
H.-G. Nesselrath (Hg.), Einleitung in die griechische PhilologiePhilologie, Stuttgart/Leipzig 1997.
F. Graf (Hg.), Einleitung in die lateinische PhilologiePhilologie, Stuttgart/Leipzig 1997.
P. Riemer/M. Weißenberger/B. Zimmermann, Einführung in das Studium der Gräzistik, München 2000.
P. Riemer/M. Weißenberger/B. Zimmermann, Einführung in das Studium der Latinistik, München 1998.
E. Pöhlmann, Einführung in die Überlieferungsgeschichte und in die Textkritik der antiken Literatur, 2 Bde., Darmstadt 1994/2003.
Literaturgeschichte, griechisch und römisch:
A. Dihle, Griechische Literaturgeschichte, 2. Aufl., Darmstadt 1991.
B. Zimmermann/A. Schlichtmann (Hgg.), Handbuch der griechischen Literatur der Antike, Bd.1: Archaische und klassische Zeit, HdA VII 1, München 2011.
B. Zimmermann/A. Rengakos (Hgg.), Handbuch der griechischen Literatur der Antike, Bd.2: Die Literatur der klassischen und hellenistischen Zeit, HdA VII 2, München 2014.
A. Dihle, Die griechische und lateinische Literatur der Kaiserzeit, München 1989.
R. Herzog/P.L. Schmidt (Hgg.), Handbuch der lateinischen Literatur der Antike, HdA VIII 1, 4, 5, 6.1/6.2, München 1989 – 2002.
M. v. Albrecht, Geschichte der römischen Literatur, 2 Bde., 3. Aufl., München 2012.
M. Fuhrmann, Geschichte der römischen Literatur, Stuttgart 1999.
Geschichtsschreibung:
B. Näf, Antike Geschichtsschreibung: Form – Leistung – Wirkung, Stuttgart 2010.
A. Feldherr/G. Hardy (Hgg.), The Oxford History of historical Writing, Bd.1: Beginnings to AD 600, Oxford 2012.
O. Lendle, Einführung in die griechische Geschichtsschreibung: Von Hekataios bis Zosimos, Darmstadt 1992.
D. Flach, Römische Geschichtsschreibung, 4. Aufl., Darmstadt 2013.
J. Rüpke, Römische Geschichtsschreibung: eine Einführung in das historische Erzählen und seine Veröffentlichungsformen im antiken RomRom, 2. Aufl., Marburg 2015.
Andere Literaturgattungen:
H. Sonnabend, Geschichte der antiken Biographie: Von IsokratesIsokrates bis zur Historia Augusta, Stuttgart/Weimar 2002.
K. De Temmermann (Hg.), The Oxford Handbook of Ancient Biography, Oxford 2020.
Ch. Mueller-Goldingen, DichtungDichtung und Philosophie bei den Griechen, Darmstadt 2008.
M. Fuhrmann, Die Dichtungstheorie der Antike, 2. Aufl., Darmstadt 1992.
W. Eisenhut, Einführung in die antike Rhetorik und ihre Geschichte, 5. Aufl., Darmstadt 1994.
W. Stroh, Die Macht der Rede: eine kleine Geschichte der RhetorikRhetorik im alten Griechenland und Rom, Berlin 2009.
S. Döpp u.a. (Hgg.), Lexikon der antiken christlichen Literatur, 3. Aufl., Freiburg u.a. 2002.
Zu wichtigen Editionen und Übersetzungen antiker Autoren → Kap.3.2.5
Zur EDV-gestützten Recherche → Kap.3.2.1
Exkurs: Quellentext befragt
Auf den ersten Seiten seines 24. Buches, das die Ereignisse des Jahres 215 v. Chr. behandelt, bringt LiviusLivius die Haltung der italischen Bundesgenossen Roms nach der katastrophalen römischen Niederlage gegen HannibalHannibal bei CannaeCannae (216 v. Chr.) in einem einzigen Satz auf den Punkt:
„Unus velut morbus invaserat omnes Italiae civitates, ut plebes ab optimatibus dissentirent, senatus Romanis faveret, plebs ad Poenos rem traheret“ (LiviusLivius 24,2,8). In der deutschen Übersetzung von Josef FeixFeix, Josef (1977) lautet die Stelle: „Eine einzige Krankheit hatte gleichsam alle Staaten Italiens befallen, dass das Volk anders dachte als der Adel, dass der Senat den Römern zugetan war, die Bürgerschaft sich aber zu den Puniern hingezogen fühlte.“
Derartige Aussagen sind, das kann nun nicht oft genug betont werden, extrem verdächtig! Sie pauschalisieren in einer Weise, die geradezu danach riecht, dass hier ein Gemeinplatz oder aber eine bestimmte darstellerische Absicht Pate gestanden haben für eine Verdrehung, Übertreibung oder zumindest eine grobe Vereinfachung der Tatsachen.Was ist zu tun? Der nahe liegende Ansatz besteht darin, die generalisierende Behauptung am Einzelfall zu überprüfen, und zwar zunächst in der livianischen Schilderung selbst. Wer dies unternimmt, der muss die Bücher 23–30 bei LiviusLivius durchmustern, in denen der Zweite Punische Krieg von der Schlacht bei CannaeCannae bis zum Friedensschluss 201 v. Chr. dargestellt wird. Dazu ist etwas Zeit erforderlich, aber das Ergebnis lohnt die Mühe. Die Gegenprobe bei Livius zeigt nämlich, wie kaum anders zu erwarten war, ein durchaus vielschichtiges Bild. Der in 24,2,8 erwähnte Gegensatz zwischen Adel und Volk findet sich nur an einigen wenigen Stellen wieder: So sollen in der campanischen Stadt NolaNola die (adeligen) Ratsherren die Römer unter Marcus Claudius MarcellusClaudius Marcellus, Marcus zu Hilfe gerufen haben, weil das Volk zu HannibalHannibal habe übergehen wollen. Diese Geschichte wird aber gleich dreimal für drei aufeinander folgende Jahre erzählt (für 216: Livius 23,14,7–17,3; für 215: Livius 23,39,7–8; 23,41,13–46,7; für 214: Livius 24,13,8–11; 24,17), es handelt sich also sogar um mehr als um eine Doublette. Damit nicht genug: An einer Stelle wird der Anführer der prokarthagischen Partei in Nola, ein Mann namens Lucius BantiusBantius, Lucius, ganz zweifelsfrei als Adliger identifiziert, denn es heißt von ihm, er sei „zu der Zeit unter den Bundesgenossen [der Römer] beinahe der vornehmste Ritter“ gewesen (Livius 23,15,8: „erat … sociorum ea tempestate prope nobilissimus eques“). Man wird daher berechtigte Bedenken tragen dürfen, ob Livius die Lage in Nola wirklich zutreffend beschrieben hat. Ähnliches gilt nun auch für die einzigen beiden anderen Fälle, die wenigstens halbwegs und auf den ersten Blick der angeblichen ‚Zweiteilung‘ Italiens in einen romfreundlichen Adel und ein karthagerfreundliches Volk zu entsprechen scheinen. Es sind dies die unteritalischen Griechenstädte Kroton und Locri, deren in Livius 24,1–3 berichtetes Schicksal im Übrigen überhaupt erst den erzählerischen Rahmen für die fragliche Pauschalaussage abgegeben hat. Ausführlich wird dort dargestellt, wie es in beiden Städten eben das Volk gewesen sei, das gegen den Widerstand der Adligen den Wechsel auf die Seite der Punier (und der mit diesen verbündeten Bruttier) durchgesetzt habe.
In Buch 23 nimmt LiviusLivius den Verlust der beiden Städte jedoch kurz vorweg (23,30,6–8), und hier heißt es, Kroton sei aus militärischer Schwäche an die KarthagerKarthager gefallen, während es in Locri das Volk gewesen sei, das vom Adel betrogen wurde, und nicht umgekehrt: „Et Locrenses descivere ad Bruttios Poenosque prodita multitudine a principibus“ („Auch die Locrer gingen zu den Bruttiern und den Puniern über, weil die [Volks]menge von den Adligen verraten wurde“). Normalerweise würde man in diesem Zusammenhang die umfangreichere Schilderung in Buch 24 der stark verkürzten Angabe in Buch 23 vorziehen. Gerade die Beobachtung aber, dass in die längere Fassung, gewissermaßen als Fazit, die Aussage 24,2,8 eingebettet wurde, spricht hingegen dafür, dass Livius oder seine Vorlage an dieser Stelle die Faktentreue zugunsten eines pointierten Bonmots vernachlässigt haben.
Alle übrigen aus LiviusLivius gewonnenen Informationen zum Verhalten der italischen Völkerschaften nach CannaeCannae stützen diese Annahme: Nirgends ist von Meinungsverschiedenheiten zwischen Adel und Volk die Rede; mehr noch, das Volk spielt zumeist keine erkennbare Rolle in den politischen Entscheidungsprozessen. Diese finden vielmehr fast ausschließlich innerhalb der Oberschicht statt. Es ist also der Adel, oder, im Konfliktfall, die jeweils stärkere Adelspartei, die bestimmt, ob man bei RomRom bleibt oder sich den Karthagern anschließt. Dies ist in CapuaCapua so (Livius 23,2–10), in EtrurienEtrurien (Livius 27,24; 29,36,10–12; 30,26,12) und auch in Süditalien (Compsa: Livius 23,1,1–3; Tarent: Livius 24,13,1–4; 25,8,3–10; Arpi: Livius 24,47,6; Salapia [Salpia]: Livius 26,38,6–14).
Die Parallelüberlieferung zu LiviusLivius – es handelt sich hauptsächlich um Abschnitte aus PolybiosPolybios, PlutarchPlutarch und Cassius Dio– enthält nichts, das diesen Quellenbefund wesentlich verändern würde: Die Aussage in Livius 24,2,8 ist als unzutreffend entlarvt!
Handelt es sich hierbei nun um einen ToposTopos, oder steckt eine anders geartete Darstellungsabsicht dahinter? Und: Hat LiviusLivius selbst hier die Tatsachen ‚frisiert‘, oder hat er die tendenziöse Beurteilung von einem seiner Gewährsmänner übernommen?
Diese Fragen sind nicht mehr mit letzter Gewissheit zu beantworten. Eine im weitesten Sinne ‚antidemokratische‘ Haltung, die man an dieser Stelle für eine stereotype Verzerrung verantwortlich machen könnte, ist sowohl in Griechenland als auch in RomRom gerade in den gebildeten Kreisen zu fast allen Zeiten weit verbreitet gewesen. Trotzdem kommt man vielleicht noch ein bisschen weiter. Ein Fingerzeig auf eine ganz konkrete Konfliktsituation, die hinter der Äußerung LiviusLivius 24,2,8 stehen könnte, liefert der genaue Wortlaut der Stelle, denn sie spricht von den optimates einerseits und (weniger charakteristisch) der plebs andererseits. Diese Begriffswahl lenkt freilich den Blick auf die berühmte ‚Krise der späten römischen Republik‘, auf die Turbulenzen der Gracchenzeit ab 133 v. Chr., und besonders auf die daraus erwachsene Frontstellung zwischen POPULARENPopularen und OPTIMATENOptimaten. Angesichts der Tatsache, dass sich Livius in seiner Darstellung des Zweiten Punischen Krieges nicht zuletzt auf – nicht mehr erhaltene – römische Historiker aus dieser Krisenzeit stützte, auf Schriftsteller wie Coelius AntipaterCoelius Antipater und Valerius AntiasValerius Antias (um 100 v. Chr.?), wird es wahrscheinlich, die Pauschalaussage auf einen dieser Autoren zurückzuführen und als tagespolitische optimatische Propaganda zu verstehen, die das ‚Volk‘ – und damit vor allem diejenigen, die vorgaben, die Sache des Volkes zu vertreten, mithin die Popularen – als ‚Vaterlandsverräter‘ diffamieren wollte.
 Abb. 10
Abb. 10
Rom und Italien in der Auseinandersetzung mit Karthago
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.