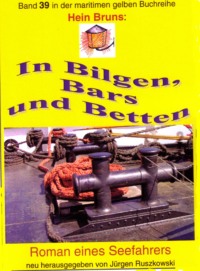Kitabı oku: «Hein Bruns: In Bilgen, Bars und Betten», sayfa 6
Meiler hatte niemand an Land, kein Mädchen. Seine Eltern wohnten binnenlands, und sonst hatte er auch keine Bindungen an Land, nur ein kleines Zimmer. Dieses Zimmer war doch sein Heim. Dorthin konnte er doch gehen und sich ausruhen, konnte einmal wieder richtig schlafen, ohne dass er durch das Dröhnen und Stampfen und Heulen der Motoren gestört wurde. Das wollte er erst einmal wieder. Und wollte auch wie ein Landmensch in der kleinen Kneipe unten an der Straßenecke sitzen und mit Bürgern, mit normalen Wirtschaftswunderkindern, sich unterhalten, Skat spielen, Bier trinken. Wollte auch einmal für einen Bürger gehalten werden und die Seefahrt und die Motoren und Maschinen und Pumpen und Separatoren, Turbinen und den ganzen Scheiß einmal vergessen. Wollte nur Mensch unter Menschen sein. Wenn er auch ihre Alltagssprache und Wochenendgedanken nicht verstand, wenn sie von Campings und Reisen, von Autos und Waschmaschinen und Parties sprachen, so saß er doch bei ihnen und fühlte sich doch zum mindesten zugehörig. Konnte sich mit ihnen auch besaufen, mit dem Bäckermeister Volkers und dem Handelsvertreter Knox in Knorr und dem Frauenarzt Dr. Sieger. Heute heißt es nicht mehr, was bist du, sondern was verdienst du. Das waren natürlich alles Gespinste und Illusionen - das mit dem Skatspielen und so -‚ denn er musste ja Kolben ziehen und auch die Buchsen. Das in einem deutschen Hafen und in einer deutschen Werft. Am Biertisch saßen die Bürger und spielten auch ohne ihn Skat. Hier werden Kolben gezogen und auch die Buchsen. Ritsch - ratsch, die Kette vom Flaschenzug! Zieh hoch den Vogel ... hieven! Die Kette läuft nur ritsch-ritsch, wenn jemand dran zieht. Läuft auch im deutschen Hafen und in einer deutschen Werft nur ritsch-ritsch, wenn jemand dran zieht. Hieven! Dann passierte es! Gott, es muss ja mal was passieren. Als die Kette brach und der Kolben von oben kam, wurde geschrieen, und sie sprangen alle beiseite. Alle sprangen beiseite, bis auf den Chief, Wüstenfuchs genannt, der stand nämlich oben. Und Meiler sprang auch nicht beiseite, er stand nämlich unten, und das Kolbenhemd streifte ihn, nur so eben, nur so eben am Rande, so eben am Kopf, und das war nicht gut und wiederum doch gut. Nicht gut war es, dass Meilers Kopf ein bisschen angekratzt wurde, und das nennt man Schädelbruch. Gut war es, dass Meiler nun doch keine Kolben mehr zu ziehen brauchte. Gut war es auch, dass Meiler nun an Land kam, schnell, schleunigst, er brauchte sich gar nicht erst umzuziehen, nicht zu rasieren und auch nicht zu waschen. Nicht gut aber war es, dass er nun doch nicht am Biertisch sitzen durfte und so auch nicht Skat spielen konnte. So sah Meiler Melchior das Mädchen Mira! Mira Vignaud, die Krankenschwester mit den langen schwarzen Haaren, die aber unter der weißen Haube verborgen lagen. Und Mira Vignaud verband ihn täglich, behandelte ihn, verpflegte und pflegte ihn. Täglich spürte er die braun getönten, schlanken Hände an seinem Kopf und an seinem Körper. Schwarz und dreckig war seine Welt gewesen, jetzt war sie weiß und sauber. Laut und rau war seine Welt gewesen, jetzt war sie leise und zart. Sonst stank es nach Schweröl, nun roch es nach Karbol. Die Putzlappen waren wohl weiß, die im Maschinenraum gebraucht wurden, aber noch weißer waren die Binden um seinen Kopf. Schwester Mira! Oft saß sie an seinem Bettrand und sprach mit ihm. Worüber sie sprachen? Worüber sprechen junge Menschen wohl? Über Leben und Lachen, über Welt und Weiten. Über Gewesenes, Gegenwärtiges und nur wenig über Kommendes. Wieso, was sollte da auch wohl kommen? Hier ist eine Krankenschwester, zu deren Beruf es gehört, dem Patienten auch seelische Medizintropfen einzuflößen. Dieser Patient hätte genau so gut eine alte Frau oder ein alter Mann sein können. Dass dieser Patient nun ein junger Mann ist, mit festen grauen Augen und eigenwilligem Gebaren und Sicherheit versprechenden Händen, das ist nun mal dem Würfelspiel des Geschicks zuzuschreiben und auch dem Kolbenziehen in einem deutschen Hafen auf einer deutschen Werft. Als die Heilung fortschritt, sah Meiler in Mira das Weib, sah das Weib, aber ohne Erotik. Sah ihre unter der Schwesterntracht verhüllten Brüste, sah ihre geraden langen Beine, sah ihren biegsamen Körper, sah es, aber ohne Erotik.
Kapitel 10
Meiler war um Punkt halb acht Uhr an Bord, so konnte er ja noch frühstücken. Er ging an der Kombüse vorbei und fragte den Bäcker, Koch sah er nicht, was es denn zum Frühstück gäbe. „Eier!“ Schön, Eier. Eier! Hatten wir allerdings gestern Morgen auch, aber immerhin Eier! Meiler ging in die Offiziersmesse, setzte sich, zum Teil kannte er die Herren noch nicht und machte sich bekannt. Für ihn waren es, bis auf die Kugel und den II. Offizier Linke, alles neue Gesichter. Der Messesteward holte das Frühstück für ihn. Es ging ziemlich schweigsam zu, aber das ist an Bord meistens so, man kennt sich noch nicht und beriecht und beschnüffelt sich erst einmal. Man peilt sich auch an und macht sich seine Gedanken. Wer das wohl ist, wie der wohl ist? Die Kugel war nüchtern und schweigsam und blass. Die Kugel und die anderen Herren, die sich doch schon länger kannten, sahen sich nicht an. Hier ist doch irgendetwas los… die Stimmung ist wirklich komisch. Sollte es das sein, dass Meiler in der vergangenen Nacht nicht an Bord gewesen ist? Das war ja nun schließlich seine Sache und seine Privatangelegenheit. Meiler fragte auch nicht, und es ging ihn auch nichts an, was hier los ist oder los gewesen war. Nee, mit ihm hatte das sicher nichts zu tun, und wenn, wäre es ihm auch egal gewesen. Der Kleine dort, älter schon, hatte sich als Hiller, als Funker, vorgestellt. Der Funker macht meistens an Bord die Verwaltung, verwaltet den Proviant, zahlt in den verschiedenen Häfen Vorschuss aus, macht die Abrechnungen und auf See seinen Funkdienst. Der Funker wandte sich an die Kugel und sagte: „Ja, Herr Prochnow, wo kriegen wir denn jetzt wieder einen Koch her?“ Dabei hatte er vor einer halben Stunde ein Telex aufgegeben mit folgendem Wortlaut:
- reederei b. bollage - angekommener koch im krankenhaus - senden sie bitte umgehend neuen koch - ausführlicher bericht folgt - ms mistral kapitän rischer –
Kapitel 11
Herbst 1945. Der raue Herbststurm, und der kam von der Nordsee, jagt weseraufwärts, peitscht die Bäume des Weserufers und reißt die letzten toten Blätter von den Ästen. Verfängt sich in den Gassen und Winkeln und Häuserecken, heult und schreit und pfeift in den Schornsteinen der kleinen Stromstädte und fegt weiter über das norddeutsche Land. Fällt dann mit unbändiger Wut in Bremens Überseehafen ein wie eine ungezähmte Bestie. Wirbelt das Hafenwasser auf und stemmt sich gegen die Aufbauten der wenigen im Hafen festgemachten Schiffe. Große Schiffe, meistens „Amerikaner“. Der Sturm rüttelt an Wanten und Stagen, an Antennen und Flaggenleinen. Will die Kräne stürzen! Kräne, die auch jetzt stakig ihre Pflicht tun. Und jetzt möchte er seinen Zorn an dem kleinen Hafenschlepper PAIRPLAY 3 auslassen. Aber dieses kleine energische Schiff ist gut vertäut und festgemacht. Ein Zöllner mit hochgeschlagenem Kragen und ohne Pistole, hungrig, weil auch Normalverbraucher, stelzt unlustig, frierend und bestimmt nazibelastet am Kai entlang. Was gibt es hier wohl noch zu schmuggeln? Wenn schon, dann nur Halbe-Halbe! Der Zöllner stapft weiter, bleibt noch kurz und lustlos bei dem „Ami“ stehen, der lichtprahlerisch nahrhafte Fracht aus USA mit asthmatischen Bremer Kränen löscht. Seine, des Zollbeamten Ronde, ist gleich zu Ende, und im Zollhaus ist es leidlich warm. Feuerung ist auch nicht ganz „ehrlich“ besorgt. Aber was macht es? Deutschland ist durcheinander! Und es ist 20 Uhr und noch kein Anbiet.
Auf dem kleinen Schlepper FAIRPLAY 3, der im Heckschatten des großen Amerikaners CITY OF BALTIMORE liegt, als suche er Schutz vor dem Sturm, tickert nur die kleine Lichtmaschine. An Bord ist es gemütlich warm, denn deutsche Kohle bewilligt der Ami, wohl nicht für Heizung, aber immerhin doch für die Kessel der Schlepper, die seine Schiffe bugsieren. Dort und dort an Bord brennt eine kleide Lampe. Es schlafen der Heizer und auch der Kapitän. An den Festmacherleinen beißt sich der Herbststurm die Zähne aus. Im halbrunden „Salon“ des Schleppers sitzen drei Besatzungsmitglieder und spielen Skat. Einpfennigsskat! Es war doch Reichsmark-Zeit. Geld reichlich, nur man konnte dafür nichts kaufen. Goldene Zeit, schöne Zeit, nahrhafte Zeit, aber nur für den, der an der Quelle saß oder im Hafen. Derweil kroch der Hunger durch das deutsche Land wie ein Reptil. Der Grand mit vieren ging restlos in die Binsen, war rum wie Arrak. Der Pik aus der Hand und auch noch mit Spitze hatte auch verloren gehen müssen, aber der Maschinist passte wieder mal nicht auf. Denn, wäre die erste Karte, die auf die Back kam, eine Karo-Neun gewesen... ja dann…, ja dann..., dann wäre alles ganz und gar und ganz anders gekommen. Der Herbstwind tobt! Der Ami löscht! Und der Zöllner hat sich verkrochen! Es ist zwanzig Uhr zehn und immer noch kein Anbiet! Auf dem Ami rattern die Winden, schwingen Kranhälse, wird gelöscht. Gefrorene Schweine, halbiert und in Sacktuch eingenäht. Rinderviertel. Mehl und Mais und Zucker, Schokolade und Zigaretten. Butter und Speck und Eier und Käse. Eine Besatzungsarmee frisst was weg. Jede Hieve, die sich da an Land schwingt, wird von den Bremer Hafenarbeitern sehnsüchtig verlangend und doch trauernd nachgesehen. Einen Bruchteil der Hieve nur zu Hause haben, einen Bruchteil nur, und die Frau hätte wieder ein strahlendes Gesicht und die Freude würde ihre verhärmten Züge wieder glätten. Einen Bruchteil der Hieve zu Hause haben, und die Kinder wären einmal wieder satt und würden wieder Kinder und fröhlich sein. Jede Hieve aber, die sich da an Land schwingt, wird auch von scharfen Militärpolizistenaugen verfolgt, bis die Hieve im Schuppen verschwunden ist, gewogen, notiert. Im Schuppen sind wieder andere Bewacher. In Luke 4 auf Steuerbordseite liegt ein breiter, untersetzter Hafenarbeiter im Dunkeln auf dem Bauch. Der Schein der Decksbeleuchtung und das Licht des Maststrahlers können ihn nicht fassen, und der Blick der amerikanischen Lukenwache kann ihn auch hier nicht greifen. Er ist rührig und schnell und hastig in seinen Bewegungen, und es sind vor allem die Hände, die sich bewegen. In einen alten Kartoffelsack hinein schiebt der Hafenarbeiter Schokolade. Tafel auf Tafel und Block um Block. Nuss. Bitter. Halbbitter. Zartbitter. Block um Block, ganz egal, wie sie kommen. Er schiebt sie hinein in den Sack, schnell, hastig, und wirft immer wieder einen ängstlichen Blick auf die Leiter und den Lichthof der Luke. Mut, Mut gehört dazu, hier auf einem amerikanischen Frachter Schokolade in einen Kartoffelsack zu schieben. Hinter all den Tafeln lauern fünf bis zwölf Monate Gefängnis. Hinter all den Tafeln stehen Gitter und Stahl. Hinter all den Tafeln liegen Zellen und Wärter und Schlüsselrasseln, liegen auch Hunger, Kälte und Entbehrung. Es ist zwanzig Uhr zwanzig... und... Anbiet. Die Hafenarbeiter klettern aus den Luken, verlassen das Schiff und eilen zu ihren Anbiethallen, um in ihre kargen Margarinestullen zu beißen und ihren dünnen Malzkaffee zu trinken. So ist die Luft auf dem Ami rein, und auch die Pier ist sauber. Der amerikanische Wachoffizier sitzt in seiner Kammer bei Whisky oder liegt auf seinem deutschen „Frollein“. Der Zollbeamte stakt schon längst die nächste Ronde ab, und unter dem Heck des amerikanischen Frachters reißt und zerrt FAIRPLAY 3 an seinen Festmacherdrähten. Der Hafenarbeiter wuchtet den vollen Kartoffelsack an Deck und zieht ihn keuchend hinter sich her und schafft ihn ganz zum Hinterschiff. Hier ist es dunkel. Um den fast einen Zentner wiegenden schweren Sack bindet er eine Wurfleine. Rüber mit dem Sack über die Reling... und bums fällt der Sack mit der Schokolade und der Leine an Deck des Schleppers FAIRPLAY 3. Von der Pier aus war das nicht einzusehen, sollte doch auch bei Anbiet ein Militärpolizistenaugenpaar freiwillige Runden machen. Der Hafenarbeiter schlendert nun über Deck und geht von Bord und verschwindet in der Anbiethalle. Seiner Beute ist er gewiss, ab jetzt ist er unschuldig. Was jetzt kommt, macht der andere. Und Schokolade ist Währung!
Der Herbststurm schwingt seine Peitschen ohne Unterlass. Das Hafenwasser ist kabbelig, und die wenigen Frachter stöhnen in ihren Fesseln. Hunger und Kälte marschieren vereint durch die kahlen, ausgebrannten und ausgebombten Straßen. Hier und dort ein Haus, das vom Feuer und von den Bomben verschont geblieben ist. Hier ist es ein Keller und bei dem Haus ein Dachgeschoß, notdürftig hergerichtet, wo Menschen eine Behausung fanden. Im Dachzimmer eines halben Wohnhauses, die andere Hälfte fegten die Bomben weg, wo rohe Kistenbretter das Fensterglas ersetzen, sitzt eine junge, verhärmte Frau und raspelt einen Zuckersack auf. Zu ihren Füßen spielt ein dreijähriger Junge mit Garnrollen. Sie haben diese Behausung nach einer Bombennacht gefunden und waren froh, ein Dach zu haben. Sie und ihr Mann und das Kind. Es ist kalt und es zieht hier oben, aber es ist leidlich trocken. Die Einrichtung ist mager. Der Tisch gehörte einst der großdeutschen Wehrmacht und stand in der Stube einer Kaserne und darauf wurde gegessen und darauf wurden Karabiner Modell 98 gereinigt. Das Spind gehörte ebenfalls der Wehrmacht, darin hingen einst großdeutsche Uniformen, standen gewichste Knobelbecher, hingen die Bilder von BDM-Mädchen und Arbeitsmaiden. Heute nimmt das Spind die dünne Habe der ausgebombten Familie Prochnow auf. Zwei Luftschutzbetten tragen noch die Angst und die Hoffnungslosigkeit der Bombennächte in Bretter und Matratzen. Ein eiserner Ofen, ein Waschtisch mit blindem Spiegel, das ist alles in der „guten Stube“ der Familie Prochnow, wenn man vom Hunger und der Kälte und von der Sorge absieht. Bruno Prochnow, der ehemalige Marinesoldat bei der „Reederei Raeder“ hat jetzt Arbeit als Maschinist auf dem Schlepper FAIRPLAY 3 gefunden. Der kleine Junge wirft die Garnrollen durcheinander und beiseite und hebt den Kopf und greint: „Mutti, ich Hunger haben!“ Die Frau überprüft in Gedanken rasch ihre Essensvorräte: nur noch ein Kanten Brot, noch etwas Margarine und ein kleines Stück Schwartenwurst. Das muss der Vater morgen mit an Bord nehmen. „Warte mein Junge, ich koche dir rasch eine Suppe!“ Die Grütze mit Wasser dampft auf dem Gewehrtisch, ein Teelöffel voll Steckrübenmarmelade ersetzt den Zucker. Das Kind isst, und mit wehem Herzen sieht die Frau zu. „Mutti, mehr haben!“ „Kind, ich habe nichts mehr!“ Und der Herbstwind heult um die ausgebrannten Häuser und rüttelt an Kistenholzfenstern.
Durch die nachtdunklen Straßen, an schaurigen Ruinen und Trümmergelände vorüber, schleicht sich ein Mann mit einer schweren Last auf dem Rücken. Der Maschinist Bruno Prochnow. Hinter ihm, immer gut Abstand haltend, eine untersetzte Gestalt, ein Mann, der sich im Dunkeln hält, der die Häuserecken ausnützt, um nicht gesehen zu werden. Der Maschinist Bruno Prochnow weiß von diesem Schatten, seinem Schatten, nichts und keucht weiter durch die Nacht und durch die tote Gegend. Hier hat er nichts zu befürchten, hier fürchten sich sogar die Polizisten. Trotzdem Sitzt ihm der Schweiß und die Angst im Nacken… aber gleich ist es geschafft. Feiner Macker, der Walter, astreiner Macker, alles was recht ist. Halbe-Halbe mit der Schokolade. War früher ganz anders, als sie vor dem Krieg beim Lloyd fuhren. Mensch, Halbe-Halbe mit der Schokolade, bald fünfzig Pfund für mich. Na, will vorsichtig sein, aber dreißig Pfund sind es bestimmt. Gute, fette Amischokolade! Haha, waren sicher nicht für deutsche Mäuler und Mägen gedacht! Nee, alles was recht ist, feiner Macker, der Walter. Mensch, dreißig Pfund, das sind, wenn man die Tafel mit hundert Gramm ansetzt, hundertundfünfzig Tafeln. Bist ein feiner Kerl, Walter, hätte ich gar nicht von dir gedacht. Die Frau kriegt einen Wintermantel, das ganz bestimmt. Der Junge muss Schuhe haben und vor allen Dingen was zu essen. Und Kohlen für den Winter brauchen wir auch. Kann man alles für Schokolade eintauschen. Schokolade ist Währung, harte Währung, haha, weiche Schokolade, aber harte Währung. Prochnow nähert sich seiner Wohnung! Linst noch mal straßauf, straßab, ob alles klar ist, und verschwindet im dunklen Hauseingang. Die verschwommene Gestalt drückt sich in eine Mauernische und lässt den Herbstwind vorüberfegen.
„Frau, Schokolade, einen ganzen Sack, sieh her, davon gehört uns die Hälfte. Da staunst du, was? Nun geht es uns auch bald besser!“ Und der Maschinist Bruno Prochnow spricht von einem Wintermantel und von Schuhen und von Essen und Kohlen, und die Frau hat Tränen in den Augen. „Ich muss gleich wieder los, weißt, ich habe Nachtdienst. Auf Wiedersehen, bis morgen früh!“
„Was ist da drin, Mutti? Was hat Papi da mittebingt?“ „Ach, Junge, sei still, morgen. Morgen wirst du auch satt!“ Und die Frau sieht auf die mageren Armchen und Beinchen des Kindes und sieht in die übernatürlich großen Augen, als seien es die Augen eines Heiligen. Es klopft! Es klopft nochmals. Die Frau erschrickt. Das Kind bekommt angsterfüllte Augen. Rasch überdeckt die Frau den Sack mit einer Wolldecke, schnell tut sie das. „Herein!“ sagt die Frau zaghaft. „Ach, Sie sind das, Herr Tide, ich dachte schon...!“ — „Guten Abend, Frau Prochnow! War Ihr Mann schon hier?“ Und seine Augen, die verschlagenen, suchen den Sack. „Ja, mein Mann ist gerade wieder gegangen, er hat doch Nachtdienst, Sie müssten ihm eigentlich noch begegnet sein!“ — „Dann geben Sie mir man schnell den Sack, Frau Prochnow!“ — „Ja und?“ fragte die Frau. „Ach, das mache ich morgen alles mit Ihrem Mann in Ordnung und geht auch in Ordnung. So haben Ihr Mann und ich das abgesprochen. Es ist auch zu gefährlich, dass der Sack bei Ihnen in der Wohnung bleibt.“ Schultert den Sack und geht. Keine Tafel Schokolade für das hungernde Kind! Kein Wintermantel für die frierende Frau. Keine Schuhe für den Jungen. Die Frau lebt noch und auch der Maschinist Bruno Prochnow, aber das Kind lebt nicht mehr. Es ist damit nicht gesagt, dass das Kind noch leben würde, wenn es 1945 im Herbst Schokolade bekommen hätte oder neue Schuhe, nein, das ist beileibe nicht gesagt. Aber gesagt ist, dass der Koch Walter Tide, bestimmt für Motorschiff MISTRAL, seinerzeit Hafenarbeiter im Bremer Hafen, gestern nach London beordert von der Reederei Balduin Bollage, seit heute morgen sechs Uhr und fünfzehn Minuten Greenwicher Zeit mit schweren Kopfverletzungen ins Hospital in der Nähe des Surraydocks; zu London eingeliefert wurde. Und auch der Hafenarbeiter Walter Tide lebt noch. So leben sie alle, bis auf das Kind. „Herr Hiller“, so antwortete der II. Ingenieur, die Kugel, auf die Frage des Funkers, woher sie denn nun einen neuen Koch kriegen sollten, am Frühstückstisch, morgens um sieben Uhr dreißig im Londoner Hafen, „woher Sie oder wir einen neuen Koch kriegen, das ist mir scheißegal. Ich habe lediglich nur eine alte Rechnung beglichen… voll beglichen und damit basta. Was die Reederei oder das Gericht oder das Seemannsamt jetzt unternimmt, das rührt mich nicht. Haben Sie mich verstanden, Herr Hiller?“
Und das trug sich am Morgen zu. Der II. Ingenieur Prochnow hatte seit gestern Abend Bordwache, und unter seiner Aufsicht setzte der Assi, der die Nachtwache ging, für die Winden an Deck, die elektrisch betrieben werden, einen Dieselgenerator zu. Prochnow kam aus dem Maschinenraum, wischte sich mit einem Putzlappen die Hände und ging zur Kombüse, wegen Kaffee und so. Und der Zweite sah einen Koch, ganz in Weiß. Sah ihn, erkannte ihn, den ehemaligen Bäcker vom Norddeutschen Lloyd, den Hafenarbeiter Walter Tide. Schokolade, Schokolade. Ein totes Kind! Rollte sich in die Kombüse und rollte den Kollegen und Weißling ab. Und rollte auch dessen Kopf über die Kante und auf die Kante der Kartoffelschälmaschine. Rollte und stieß den Kopf so lange, bis das Emaillebecken, das die geschälten Kartoffeln aufnimmt, blutig war und der Walter Tide ohne Besinnung. Das war alles! Genügt ja auch!
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.