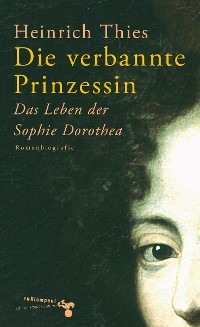Kitabı oku: «Die verbannte Prinzessin», sayfa 3
Und die begnügte sich nicht mit dem Einfluss auf den Fürsten, sie bezog auch dessen ältesten Sohn Georg Ludwig in ihre Ränke ein. So war ihr das Kunststück gelungen, den verschlossenen jungen Mann mit ihrer jüngeren Schwester Katharina Maria zu verkuppeln.
Dennoch war die Macht der Platen nicht unbegrenzt. Wenn sie auch auf die Prinzessin aus Celle herabblickte, so hatte sie doch allen Grund, die junge Dame im Leineschloss ernst zu nehmen. Denn mit dem Einzug Sophie Dorotheas kündigte sich für die Mätresse etwas an, das zu einer ernsthaften Gefahr werden konnte. Die demütigende Behandlung, die bereits ihrer Schwester Maria widerfuhr, war ein Alarmsignal. Es wehte ganz offenkundig ein neuer Wind. Sophie, die bisher so abgeklärt und gnädig die Augen vor dem Schattenreich ihrer Nebenbuhlerin verschlossen hatte, schien aufgewacht zu sein – aufgeweckt von Eleonore d’Olbreuse, die im Interesse ihrer Tochter Anstoß an den Zuständen in Hannover nahm. Und Klara Elisabeth von Platen konnte sich neuerdings nicht einmal mehr ihres Geliebten sicher sein. Mit Argwohn beobachtete sie, dass Ernst August von seiner schönen Schwiegertochter schwärmte und dieser Sophie Dorothea allerlei Aufmerksamkeiten zuteil werden ließ. In solchen Momenten spürte sie schmerzlich, dass sie älter wurde. Ihre Schönheit war nur noch durch zeitaufwändige Schminkkünste aufrecht zu erhalten.
Ihr gesamtes Renommee war bedroht. Emsig spielte sie daher die Rolle der »Wohltäterin«. Dabei gab sie es als »Wohltätigkeit« aus, die Milch, in der sie zuvor ihre Schönheitsbäder genommen hatte, an die Armen zu verschenken. Doch es war unübersehbar: Vieles war im Wandel begriffen. Knisternde Nervosität breitete sich aus in den Luxusgemächern von »Monplaisir«.
Im Korsett der Etikette
Große Schneeflocken schwebten hinterm Schlossfenster zur Erde herab. Es schneite ohne Unterlass. Die Laute, die von außen in das Gemach der Prinzessin drangen, klangen gedämpft: das Gebell der Hunde, die Rufe der Wachen, das Rollen der Kutschen. Nur die Kirchglocken durchbrachen machtvoll die weiße Stille.
Sophie Dorothea war es, als käme das Läuten aus einer anderen Welt. Das Kerzenlicht der Kandelaber verbreitete ein schummriges Licht in ihrem Schlafgemach. Es hätte die passende Stimmung zum Träumen sein können, aber die Prinzessin langweilte sich nur, weit entfernt, sich von dem Schneien verzaubern zu lassen. Sie wusste, dass die großen, schweren Flocken bald tauten und Schlamm und Schmutz hinterließen. Schlamm und Schmutz.
Es ging bereits auf elf Uhr zu. Sophie Dorothea lag immer noch auf ihrem Bett. Sie gähnte, unschlüssig, was sie mit diesem Februartag anfangen sollte. Eleonore hatte ihr vor einer halben Stunde den neuesten Gesellschaftsklatsch aus dem »Mercure galant« vorgelesen. Das war amüsant, aber nichts, was sie wirklich interessierte.
Anfangs hatte sie sich noch die Freiheit genommen, mit ihrem Edelfräulein durch die Stadt zu flanieren. Aber das sah die Fürstin nicht gern. Die Etikette, die sich am Wiener Vorbild orientierte, gestattete nur Ausfahrten in der vergoldeten, von sechs Pferden gezogenen Staatskarosse. Und solche Kutschfahrten ermüdeten sie. Leer und niedergeschlagen kehrte sie daraufhin immer ins Schloss zurück. So verzichtete sie lieber ganz darauf.
Ein lähmendes Gefühl der Sinnlosigkeit beschlich sie. Wozu aufstehen? Irgendwann würde sie sich ankleiden, pudern und parfümieren lassen, durch die endlosen Gänge schlendern, vorbei an den Porträts der glotzäugigen Vorfahren. Vielleicht einen Brief an ihre Mutter schreiben und sich dann auf das abendliche Essen vorbereiten, das sich mit viel Wein und Bier und schweren Speisen allabendlich stundenlang hinzog und mit langweiligem Kartenspiel ausklang. Sollte das ihr Leben sein? Sie kam sich vor wie eine Mastgans in einem goldenen Käfig.
Bei aller Langeweile war sie immerhin froh, dass sie derzeit in der Nacht von ihrem Mann verschont blieb. Georg Ludwig war ja im Krieg, befehligte die hannoverschen Truppen im Kampf um Wien. Hin und wieder traf sie mit den jüngeren Brüdern ihres Mannes zusammen, die gern mit ihr schäkerten und manchmal auch ein wenig zudringlich wurden. Aber egal. Sie brachten wenigstens ein wenig Frohsinn in diese Welt der strengen Sitten. Am liebsten hatte sie Karl Philipp, der drei Jahre jünger war als sie und sich stets galant verhielt.
Georg Ludwig hatte fünf Brüder und eine Schwester namens Sophie Charlotte. Die pummelige Prinzessin bewunderte ihre zwei Jahre ältere Schwägerin, und Sophie Dorothea genoss die Verehrung.
Auch mit ihrem Schwiegervater verstand sie sich gut. »Warte nur ab, mein Töchterlein«, pflegte der sie zu trösten, wenn er ihren trübsinnigen Gesichtsausdruck bemerkte. »Die grauen Wintertage sind bald vorüber. Dann werden wir einen wunderbaren Sommer in Herrenhausen verbringen und in den Gärten Verstecken spielen. Und wenn du magst, dann kommst du mit mir nach Venedig.«
Venedig – dieses Wort war Sophie Dorothea schon am Celler Hof wie eine Zauberformel für Glück und erfülltes Leben erschienen.
Immer hatte Ernst August ein freundliches Wort für Sophie Dorothea, stets bedachte er sie mit kleinen Geschenken. Ja, der Herzog schätzte die ungezwungene Art seiner schönen Schwiegertochter – ganz im Gegensatz zu seiner Frau.
Sophie verwandte unterdessen große Mühe darauf, die richtigen Ehepartner für ihre Kinder zu finden. Und »richtig« bedeutete »Erfolg versprechend«. Jetzt ging es um Sophie Charlotte, die sie im Einvernehmen mit ihrem Gemahl ganz bewusst konfessionslos erzogen hatte. So war zumindest die »falsche« Konfession einer interessanten Verbindung nicht hinderlich. In etlichen Briefen hatte Sophie ihre Tochter bereits als Braut des bayerischen Kurfürsten Max Emanuel ins Spiel gebracht. Aber dann hatte sich der Kaiser in Wien eingeschaltet und die Pläne platzen lassen.
Neue Hoffnungen leiteten sich im Sommer des Jahres 1683 aus zwei spektakulären Todesfällen ab. Am 7. Juli verstarb Elisabeth Henriette, Kurfürstin von Brandenburg, im Alter von 21 Jahren an den Pocken. Sie hinterließ eine dreijährige Tochter und einen tief betrübten Ehemann: Friedrich von Brandenburg, Sohn und Erbe des Großen Kurfürsten.
Und nur wenige Tage später starb völlig unerwartet in Versailles Maria Theresia, die Frau des französischen Königs Ludwig XIV.
Sophie war entschlossen, die Gunst der Stunde zu nutzen. Am liebsten hätte sie ihre fünfzehnjährige Tochter mit dem 49 Jahre alten König von Frankreich vermählt, dem mächtigsten Monarchen des Abendlandes. Doch ihre Nichte Liselotte, die bereits mit einem Bruder Ludwigs XIV. verheiratet war, machte ihr keine großen Hoffnungen. Mit Anspielung auf die mollige Figur Charlottes schrieb sie der Tante, es habe den Anschein, »westfälischer Schinken sei nicht das geeignete Fleisch für Leckermäuler«.
So konzentrierte Sophie ihre Bemühungen auf den Witwer in Brandenburg. Schon in ihrem Kondolenzschreiben lud sie Friedrich nach Hannover ein und deutete an, dass er »hier etwas finden könnte, um sich damit zu trösten«.
Doch mehr als ein Jahr ging ins Land, bis alle Bedenken ausgeräumt waren. Am 8. Oktober 1684 schließlich fand die prunkvolle Hochzeit in Herrenhausen statt – wenig später bereitete der Große Kurfürst seiner Schwiegertochter einen triumphalen Empfang in Berlin.
Große Sorgen dagegen machte der Herzogin Sophie ein familiärer Konflikt um das Erbrecht. Herzog Ernst August nämlich hatte seinen erstgeborenen Sohn Georg Ludwig als Universalerben für das gesamte Herzogtum eingesetzt, und der zweitälteste Sohn Friedrich August sah sich um seine Rechte betrogen. »Gustchen«, wie seine Mutter ihn nannte, rebellierte gegen den Vater. Der seinerseits reagierte mit Strenge. Der Herzog, der als jüngerer Bruder einst selbst nur durch den Verzicht Georg Wilhelms nach oben gelangt war, verwies den ungehorsamen Knaben des Landes und forderte ihn auf, künftig allein für seinen Unterhalt zu sorgen. Friedrich August trat daraufhin in die Dienste der kaiserlichen Armee.
Sophie war tief bekümmert. Sie liebte Friedrich August mehr als den Erstgeborenen und litt unter der Unnachgiebigkeit ihres Mannes. Einem Vertrauten schrieb sie: »Arm Gustchen wird ganz verstoßen. Sein Vater will ihm gar keinen Unterhalt mehr geben. Wenn ich tagsüber auch lache, so muss ich in den Nächten doch viel weinen. Denn ein Kind ist mir ebenso lieb als das andere; ich habe sie alle unter meinem Herzen getragen, und die unglücklich sind, jammern einen am meisten.«
Doch Sophie, Nachfahrin Maria Stuarts, hatte gelernt, dass es sinnlos war, gegen das Unvermeidliche aufzubegehren. Sie wusste, dass wahre Größe darin bestand, auch die Unannehmlichkeiten des Lebens mit Fassung zu tragen, insbesondere, wenn es um die machtpolitischen Interessen des Fürstenhauses ging.
Diese Haltung versuchte sie auch Sophie Dorothea nahe zu bringen. Während langer Spaziergänge durch die Herrenhäuser Gärten schärfte sie ihrer Schwiegertochter ein, dass man sich der Rolle zu fügen habe, die einem durch die göttliche Vorsehung bestimmt war. Dabei wurde sie nicht müde, Sophie Dorothea endlose Vorträge über die Geschichte des englischen Königshauses zu halten. Über das große Unrecht, das vor hundert Jahren ihrer Urgroßmutter Maria Stuart widerfahren war. Über die heilige Verpflichtung, diese Schmach zu sühnen.
Zwischendurch pflegte sich die Fürstin bisweilen selbst zu unterbrechen, um auf den Gesang der Nachtigall oder ein Froschkonzert hinzuweisen. Und dann konnte es geschehen, dass sie jenseits aller Vernunft ihrer Begeisterung freien Lauf ließ. »Hör nur. Ist das nicht wunderschön, mein Kind?«
»Oh gewiss.«
Die Erwiderung der jungen Begleiterin fiel nie viel wortreicher aus – auch dann nicht, wenn die kluge Schwiegermutter ihr von der geplanten Umgestaltung des Großen Gartens erzählte. Nein, Sophie Dorothea hasste diese langen wie langweiligen Spaziergänge, vorbei an den kantigen Buchsbaumhecken und gestutzten Sträuchern und Bäumen, die starr wie Gardesoldaten in Reih und Glied standen. Sie hörte gar nicht hin, wenn der bunte Kies unter ihren Füßen knirschte und die Fürstin unaufhörlich auf sie einredete. Was interessierte sie denn auch das alles? Die Geschichte. Die Gartenkunst. Die hohe Politik. Am allermeisten langweilte sie die Philosophie dieses oberschlauen Herrn Leibniz, mit dem sich ihre Schwiegermutter so gern traf. Diese Lehre von den Monaden, in denen sich angeblich das Universum spiegelte, lief doch immer nur darauf hinaus, dass jeder Einzelne stets das Große und Ganze vor Augen haben müsse, dessen Teil er sei. Nein, das alles kam ihr so unmenschlich vor. Wenn sie das Wort »Monaden« hörte, musste sie immer an Maden denken.
Sie unterhielt sich lieber mit ihrer Kammerzofe Eleonore über die alten Zeiten in Celle und über den neuesten Hofklatsch, scherzte mit ihren Schwagern und lenkte ihre Aufmerksamkeit auf das, was sich in ihrem Bauch tat. Ja, bald schon würde es so weit sein, bald würde sie Mutter werden – und bald schon würde der Vater ihres Kindes heimgekehrt sein aus dem Krieg. Doch ihre Wiedersehensfreude hielt sich in Grenzen.
Mutterglück
Am 9. November 1683 brachte Sophie Dorothea ihr erstes Kind zur Welt. Acht Stunden kämpfte sie im Kindbett mit den Wehen. Vor großem Publikum. Neben zwei Hebammen und einem Leibarzt waren ihre Schwiegermutter, zwei Minister sowie mehrere Hofdamen, darunter ihr Edelfräulein Eleonore, zugegen. Die Geburt eines Kindes war zu jener Zeit an den Höfen Europas ein öffentlicher Vorgang. Denn unter allen Umständen sollte verhindert werden, dass einer Prinzessin oder Königin das Neugeborene geraubt und das Kind einer anderen Frau untergeschoben wurde.
Unter den teils besorgten, teils kritischen Blicken der Herbeigeeilten brachte Sophie Dorothea einen kräftigen Knaben zur Welt, der kurz vor Weihnachten auf den Namen Georg August getauft wurde und so die Namen beider Großväter erhielt.
Mit der Geburt des Stammhalters vollzog sich ein fast wunderbarer Wandel im Verhältnis zu ihrem Ehemann. Georg Ludwig, soeben heimgekehrt als Kriegsheld aus der siegreichen Schlacht gegen die Türken am Kahlenberg vor Wien, schwebte auf einer Wolke des Stolzes. In dieser Stimmung sah der Erbprinz jetzt auch seine Gemahlin in einem anderen Licht. Sie war nicht mehr der verwöhnte Bastard aus Celle, nicht mehr das Püppchen, sondern die Mutter seines Sohnes, und plötzlich begriff er, warum alle so von ihr schwärmten: Sophie Dorothea war eine schöne Frau. Und er verwöhnte sie mit Geschenken und Gunstbezeugungen, die ihm niemand zugetraut hätte. Es war, als habe ihn ein geheimer Zauber aus seiner hölzernen Schale befreit und den wahren Kern freigelegt.
Möglicherweise lag das jedoch nicht nur an der Geburt seines Sohnes. Seine Mätresse Maria, der er noch kurz zuvor ewige Treue zugesichert hatte, war nämlich mittlerweile aus seinem Gesichtskreis entfernt worden. Seine Mutter hatte dafür gesorgt, dass sie auch »Monplaisir«, das Lustschlösschen in Linden, räumen musste.
Auch die Fürstin verhielt sich Sophie Dorothea gegenüber rücksichtsvoller. Mochte ihre Abstammung noch so zweifelhaft, ihr Geblüt noch so fragwürdig sein: Jetzt war Sophie Dorothea die Gattin des Erbprinzen und die Mutter eines Sohnes. Alles andere hatte dahinter zurückzustehen.
Die Geburt des kleinen Prinzen wurde auch in Celle begeistert kommentiert. Viel häufiger als zuvor machten sich jetzt Herzog Georg Wilhelm und seine Frau Eleonore auf den Weg nach Hannover, um ihre Tochter und den kleinen Stammhalter zu besuchen.
Sophie Dorothea war selig: stolz auf ihren Sohn, erleichtert, von ihrem Mann endlich mit Wertschätzung bedacht zu werden, und glücklich, ihre Eltern wieder häufiger zu sehen.
Doch dieses Glück währte nicht lange. Ihr kleiner Sohn wurde, der Etikette entsprechend, unter der Regie der Schwiegermutter in die Obhut einer Amme gegeben. Sophie Dorothea sah ihn nur noch selten. Georg Ludwig kehrte zurück ins Feldlager und übernahm erneut Führungsaufgaben im Krieg gegen die Türken. Und auch die Besuche der Herzogin von Celle wurden bald wieder seltener. Die hohe Politik war dafür verantwortlich.
Der französische König Ludwig XIV. hatte am 18. Oktober 1685 das Edikt von Nantes aufgehoben, das seinen Untertanen bis dahin noch eine gewisse Religionsfreiheit gewährte. Unter der Parole »Ein König, ein Glaube, ein Gesetz« hatte man die Hugenotten zwar zuvor schon gedrängt, zur katholischen Kirche überzutreten. Doch nun verbot der König den Reformierten die Gottesdienste, ordnete die Zerstörung ihrer Kirchen an und untersagte die Auswanderung. Wer auf der Flucht ergriffen wurde, musste fürchten, sein Leben als Sträfling auf einer Galeere zu beschließen.
In Celle bangte Eleonore d’Olbreuse um ihren Bruder und die übrigen Familienangehörigen, die noch in Frankreich geblieben waren, um hugenottischen Flüchtlingen auf ihrem Schloss in Poitou Unterschlupf zu gewähren. Unterdessen strömten immer mehr Hugenotten, die aus Frankreich geflüchtet waren, in das gastfreundliche Herzogtum Celle. Die Schlossherrin stand im Zentrum der Hilfsaktionen und konnte sich daher nicht mehr so viel Zeit für ihre Tochter nehmen.
So fühlte sich Sophie Dorothea bisweilen einsam im Leineschloss. Die langen Spaziergänge, auf denen sie ihre Schwiegermutter in den Gärten von Herrenhausen begleiten musste, waren für sie kein Ersatz für die Plaudereien mit ihrer Mutter. Sie schämte sich für ihre Unwissenheit, wenn die Fürstin ihr Vorträge über die Lehren ihres Freundes Leibniz hielt. Dabei erschien auch ihr manches einleuchtend und klug – vor allem die Wiedervereinigung der christlichen Kirchen, die Leibniz propagierte. Doch sie konnte kaum mehr dazu sagen als »Oh, gewiss«. Und im Grunde genommen wusste sie auch gar nicht, wozu sie sich anstrengen sollte. Denn die hannoversche Herzogin, so war sie überzeugt, interessierte sich sowieso nicht für ihre Meinung.
Zu ihrem Leidwesen musste Sophie Dorothea auch auf die aufmunternden Sprüche und vergnüglichen Einladungen ihres Schutzpatrons verzichten. Ernst August war oft für längere Zeit außer Landes – allein im Jahre 1685 weilte er acht Monate in Venedig. Wie gern wäre sie mitgefahren. Venedig – dieses Paradies an der Adria, von dem ihr Vater einst schon geschwärmt hatte, wurde für sie zum Inbegriff der Sehnsucht.
Zu Beginn des Jahres 1686 aber erfüllte Herzog Ernst August ihr endlich den Traum, die Lagunenstadt mit eigenen Sinnen zu erleben.
Karneval in Venedig
Dunstschleier hingen über dem Canal Grande. Die Rufe der Gondolieri klangen gedämpft, ein lauwarmer Wind trug an diesem späten Vormittag Gesang und Gelächter über das Wasser, an dessen Ufern sich prächtige Paläste erhoben: Palazzo Pisani, Palazzo Dandolo, Palazzo Grassi, Palazzo degli Orfei, Palazzo Balbi, Palazzo Giustinian … Die Namen klangen Sophie Dorothea wie Musik in den Ohren, sie schwirrten ihr im Kopf herum wie Liedfetzen, die sich zu einem chaotischen Choral verbanden. Und unermüdlich nannte ihr Schwiegervater die Namen weiterer Paläste, zeigte auf die prunkvollen Fensterfronten und Portale, die sich zittrig im Wasser spiegelten. Zu jedem Haus erzählte er eine Geschichte – von Bällen und Soupers, von schönen Damen, von Kaufleuten, die ein Vermögen mit dem Handel von Seide oder Gewürzen gemacht hatten, von den mächtigen Dogen, von Nobili, die Tausende von Dukaten in einer Nacht verspielten …
Sophie Dorothea meinte zu träumen, während sie mit dem alten Fürsten und ihrer Hofdame Eleonore in der schwarz lackierten Gondel durch die Kanäle fuhr. Tag und Nacht schienen ineinander überzufließen. Kreischende Möwen, gurrende Tauben. Aus anderen Booten winkten Menschen herüber, die gerade erst von einem Ball zu kommen schienen, der bis zum Morgen gedauert hatte, allesamt märchenhaft verkleidet – als Sultane und Haremsdamen aus dem Orient, als königliche Hoheiten mit Gewändern in Purpur und golddurchwirktem Brokat, als Harlekine mit weißen Porzellangesichtern, als Abenteurer und Kavaliere mit Degen und schwarzen Augenmasken aus Samt. Und bisweilen konnte es auch geschehen, dass einem unter dem schwarzen Umhang eines Bootspassagiers der Tod angrinste. Aber wenn schon!
Es war Karnevalszeit in Venedig. Und wenn die Lagunenstadt seine Besucher schon in normalen Zeiten verwirrte, so war sie im Karneval noch viel verwirrender. Wie sollte man wissen, wer sich unter den Masken verbarg? Der Mummenschanz zog auch zwielichtige Gestalten auf die Lagune: Betrüger, leichte Damen, Schwerverbrecher mit Dreispitz und Schnallenschuh, die aus der Zeit der fröhlichen Verwirrung Kapital zu schlagen hofften. Vorsicht war geboten. Ernst August ermahnte seine Schwiegertochter immer wieder, auf Schmuck und Geld zu achten, den Komplimenten der Nobili zu misstrauen. Doch hatte sie sich mit ihm erst in den Trubel einer Maskerade gestürzt, erwiesen sich solche Ermahnungen als sinnlos, dann lösten sich alle Ratschläge auf in Wein und Musik, verflüchtigten sich bei Geplauder und Tanz. Sophie Dorothea genoss es, wenn diese Märchengestalten sie anhimmelten. »Dem Himmel sei Dank, dass er uns ein göttergleiches Wesen wie Euch geschickt hat, meine allergnädigste Verehrung, die Dame …« So tönten sie, so schwärmten sie. Was sollte man dazu sagen? Lange, allzu lange hatte sie auf solch unbeschwerte Vergnügen verzichten müssen, die sie als junges Mädchen in Celle erlebt hatte. Die strenge Etikette am hannoverschen Hof reglementierte ja selbst noch die Verkleidung beim Karneval.
In Venedig war alles anders. Hier zählten Witz, Charme und Schönheit mehr als Rang und Etikette. Der Fürst verwöhnte Sophie Dorothea, wo es nur ging. An diesem späten Vormittag hatte er sie zu einem kleinen Ausflug auf dem Canal Grande eingeladen. Die Gondel stand zu seiner dauerhaften Verfügung, Gondoliere inklusive. Das einem eingebogenen Palmenblatt gleichende Gefährt war denn auch mit einem schwarzen Tuch ausgeschlagen, dem das hannoversche Wappen eingeprägt war.
Musik scholl aus einem der Paläste am Ufer, feierliche Geigen-, Oboen- und Flötenklänge. Nicht weit davon entfernt wurde aber auch gearbeitet. Am Fondaco dei Turchi legte ein Frachtschiff an, Segel wurden eingezogen, Rufe kündeten von geschäftigem Treiben. Vor einem Kornspeicher wuchteten Männer in grauer Arbeitskluft Getreidesäcke von einem Lastkahn. Einer der Arbeiter warf der Gondel des Fürsten einen kurzen Blick zu. Sophie Dorothea schien es, als würde der Mann ihr zuwinken. Sie winkte zurück. Daraufhin aber wandte sich der Mann abrupt ab, und griff nach einem neuen Kornsack. Sophie Dorothea atmete tief durch. Nein, diese schwitzenden Männer passten nicht in ihr Venedig-Bild.
Drei Wochen war sie nun schon in der Stadt. Schwiegervater Ernst August, der bereits am 16. Dezember 1685 in Hannover aufgebrochen war, hatte sie Anfang Januar nachholen lassen. Sie hatte keinen Moment gezögert, sofort war sie »über den Berg« gefahren – im Gepäck ihre schönsten Roben, Samt- und Seidenschuhe, Diamanthalsbänder und Smaragdohrringe. Der Fürst hatte von dem Nobile Sebastiano Foscari das Ca’ Foscari gemietet, einen repräsentablen Palazzo in bester Lage am Canal Grande. Und zwar auf Dauer. Wenn der Herzog selbst nicht in Venedig war, verwaltete der hier ansässige deutsche Arzt Johann Matthäus Alberti die Palastwohnung. Auch in einer Reihe von Theatern und Opernhäusern unterhielt der hannoversche Hof Logen in Dauermiete.
Wie früher sein älterer Bruder nahm sich der Herzog neuerdings viel Zeit, um die Möglichkeiten zu Zerstreuung und Lustbarkeit auch zu nutzen – sehr zum Leidwesen seiner Gemahlin, die ihren Gatten nur ein einziges Mal begleitet hatte. Die Herzogin verabscheute das bunte Treiben unter Italiens Sonne.
Die Venedig-Reisen ihres Mannes missbilligte sie aber noch aus anderen Gründen: Sie hielt Ernst August vor, dass er sich mit seinen monatelangen Aufenthalten in Italien nicht nur dringenden Staatsgeschäften entzog, sondern auch in unverantwortlicher Weise die Staatskasse ruinierte. Der hannoversche Kanzler Otto Grote hatte schon zwei Jahre zuvor darauf hingewiesen, dass es um die Finanzen nicht zum Besten stand. Und der Venedig-Aufenthalt verschlang 7000 Taler im Monat – ein Vermögen, bedenkt man, dass man für einen einzigen Taler neun Brote kaufen konnte.
Um seine Luxus-Reise zu finanzieren, vermietete der Herzog seine Soldaten gleichzeitig an den Kaiser in Wien und an die Republik Venedig. In immer neuen Verhandlungsrunden schacherten die Gesandten von Ernst August mit den Unterhändlern des Kaisers um den Preis für die hannoverschen Soldaten, die zur Unterstützung der Habsburger in den Krieg gegen die Türken geschickt werden sollten. Am Ende gelang es dem Herzog, für die Überstellung von 5 000 Mann 50 000 Taler herauszuschlagen. Zehn Taler für ein Soldatenleben. Ähnliche Geschäfte wickelte Ernst August auch mit den Kriegsherren Venedigs ab, die auf der griechischen Halbinsel Peloponnes gegen die Türken kämpften. Hier handelte der Herzog noch einen höheren Preis aus: 76 000 Taler im Jahr für drei Infanterieregimenter mit insgesamt 2400 Mann – davon waren 40 000 Taler sofort beim Eintreffen der Truppen an den Musterungsplätzen auf dem Lido fällig. Selbstverständlich kriegten die Soldaten keinen Heller davon. Für die meisten führte der Einsatz auf der fernen griechischen Halbinsel geradewegs in den Tod.
Immerhin schonte der Herzog auch seine eigenen Söhne nicht. Georg Ludwig führte die hannoverschen Truppen in Ungarn unter der Fahne des Kaisers an, Prinz Maximilian, gerade neunzehn Jahre alt, verstärkte die Reihen Venedigs. Auch Friedrich August, der zweitälteste Sohn des Herzogs, war unter die Soldaten gegangen. »Gustchen« hatte sich wie sein Bruder in den Dienst der Habsburger begeben. Doch nicht auf Wunsch des Vaters, sonders eben aus Protest gegen den Vater, von dem er sich durch die Erstgeburtsordnung um sein Erbe betrogen fühlte.
All dies ging Sophie durch den Kopf, wenn sie die Briefe aus Venedig las, in denen Ernst August die Herrlichkeiten der Stadt pries. Dabei wusste sie nur zu genau von Vergnügungen, von denen nichts in den Briefen stand. Es war in Hannover ein offenes Geheimnis, dass der Herzog intensiven Kontakt mit den Kurtisanen der Inselstadt pflegte. Schließlich war aus einer dieser Affären eine Tochter hervorgegangen, die der Vater sogar nach Hannover geholt hatte: Laura di Montecalvo – Montecalvo leitete sich von Calenberg ab.
Während Ernst August das Leben in Venedig genoss, mühte sich Sophie in Hannover, den Einfluss- und Machtbereich der Welfen zu erweitern, und zwar mit Hilfe ihrer Heirats- und Familiendiplomatie. Gespannt blickte sie auf die Vorgänge in England, wo ihr Cousin Karl II. gerade verstorben war und dessen Bruder Jakob als Nachfolger auf dem Thron mit seiner katholischen Regentschaft gegen erhebliche Widerstände zu kämpfen hatte.
Doch zurück nach Venedig. Die Glocken der umliegenden Kirchen läuteten die Mittagsstunde ein. Dumpfe, schwere Schläge mischten sich mit feinem, silberhellem Läuten; melodiöses Glockenspiel verband sich mit einförmigem Wummern. Tief berührt atmete Sophie Dorothea die himmlische Musik mit der milden Meeresbrise ein. Es war ein wunderbares Konzert, das da über dem dunklen Wasser des Canal Grande zusammenfloss aus den vielen Kirchen der Gassen und Strandpromenaden: der Santa Maria della Salute, der Santa Maria del Giglio, der Santa Maria Formosa oder der Basilica di San Marco.
Am Nachmittag erwartete Sophie Dorothea den französischen Maler Henry Gascar, den ihr Schwiegervater verpflichtet hatte, einige Bildnisse von ihr anzufertigen. Sie hatte bereits mit Monsieur Gascar besprochen, dass sie für die Sitzung in das Gewand der Frühlingsgöttin Flora schlüpfen würde, das sie auch bei dem abendlichen Ball zu tragen gedachte: ein Seidenkleid mit Blumenmuster, tief ausgeschnittenem, spitzenbesetztem Dekolleté, Reifrock und Puffärmeln. Die Haare geschmückt mit Blumen, einen kleinen Blumenstrauß in der rechten Hand haltend, nahm die Prinzessin vor der Staffelei des Malers Platz.
»Wundervoll, wahrhaft göttlich, Madame«, schwärmte Monsieur Gascar, während er mit seinen Skizzen begann. »Bitte, jetzt die linke Hand einmal heben, so als wollten Sie der Welt ihre göttliche Huld erweisen.«
Und Sophie Dorothea tat artig, was der Maler von ihr verlangte. Während sie Monsieur Gascar Modell saß, richteten sich ihre Gedanken auf ihren Sohn. Vermutlich umsorgten ihn seine Ammen und Erzieher, sodass er gar nicht auf den Gedanken kam, nach seiner Mutter zu fragen. Doch die vermisste ihn. Schon als sie noch in Hannover gewesen war, hatte er die meiste Zeit des Tages bei den Hofleuten zugebracht. Aus der Ferne betrachtet, bedauerte Sophie Dorothea dies. Gern hätte sie ihren Sohn öfter auf dem Schoß gehabt. Doch das widersprach den höfischen Regeln. Es war einfach nicht üblich, dass eine Mutter ihre Kinder unter die Fittiche nahm wie eine Glucke ihre Küken, das gehörte sich nicht – schon gar nicht für eine Prinzessin.
Sophie Dorotheas Gedanken wanderten zu Georg Ludwig. Sie war sich ihrer Gefühle für ihn immer noch nicht sicher. Ohne Frage, nach der Geburt von Georg August hatte er sie verwöhnt, mit freundlichen Worten und Geschenken, war ungewohnt zärtlich gewesen. Doch ehe sie sich auf diese neue, liebevolle Art eingestellt hatte, war er auch schon wieder in den Krieg gezogen.
Jetzt hatte er ihr von seinem ungarischen Feldlager die Nachricht zukommen lassen, dass er bald zu einem Besuch in Venedig eintreffen werde. Aschermittwoch konnte er schon in der Lagunenstadt sein. Der Gedanke beunruhigte sie. Sie fürchtete, dass es vorbei sein würde mit den sorglosen Stunden, wenn der Erbprinz erst an ihrer Seite war. Aber vielleicht täuschte sie sich, vielleicht lag in der Begegnung hier in Venedig ja auch die Chance für einen Neubeginn – fern von den strengen Augen der Schwiegermutter, fern vom klösterlichen Leineschloss.
»Wunderbar, Prinzessin, Ihr könnt die Hand jetzt herunter nehmen.«
Sophie Dorothea blickte Monsieur Gascard verwirrt an. Erst jetzt wurde ihr wieder bewusst, dass sie ihren Arm noch immer wie zum Segen in der Luft hielt. Er fühlte sich schon ganz lahm an.
Acht Bilder gingen aus den Sitzungen mit Gascard hervor. Alle spiegeln den gleichen Gesichtsausdruck wider: ein nachdenklicher, aber dennoch wacher Blick.