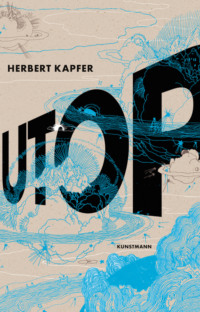Kitabı oku: «UTOP», sayfa 5
Orff sagte: »Sybille, ich habe meine Sache dumm gemacht und könnte sie, glaube ich, besser machen. Das Wichtigste wäre, wir heirateten uns.«
Sie dachte die ganze Zeit an Thomas Buber, wie er schlechter Laune war und seine Gereiztheit so wenig verbarg. Warum blieb er sitzen und beobachtete sie?
»Er ist ein Süddeutscher, ein Maler. Man sieht sofort, daß die Behauptung, der geniale Mensch sei gefährdeter als der durchschnittliche, hier eindringliche Illustration erhalten hat. Ich kenne Sie besser, als Sie sich selbst,« sagte Orff. »Vielleicht bin ich zur Zeit in Europa der einzige Mann, der Ihre Beweggründe ganz klar durchschaut. Ich bin Jude – das heißt, gehöre einer um einige Jahrtausende älteren Kultur an, bin literarisch gebildet, Frauenkenner und Amateur. Vertrauen Sie sich mir an. Sie sind ein verbrecherisches Kind.«
Sie zitterte jetzt vom Scheitel bis zur Sohle. In ihr zuckten alle Leidenschaften wie jähe Schwerter auf. Thomas Bubers Profil hob sich scharf gegen das Licht ab; er sah böse, hochmütig und höhnisch aus. Die Unterlippe hatte er etwas vorgeschoben, zerwühlte sie mit den Zähnen. Auf seiner Stirn stand senkrecht die Eigensinnsfalte, er zeichnete auf dem Tisch mit dem Finger.
Ein Königreich für eine Erregung! dachte Sybille.
sie fühlte seinen Zorn
in jedem lässigen und höhnischen Wort. Er nannte sie ohne weiteres du. Nun reckte er sich in den Schultern. Sybille sah zu ihm auf, sie zwang sich ihn ohne mit der Wimper zu zucken anzusehen.
»Lüge doch nicht!« befahl er hart.
Sie sagte: »Ich lüge nicht.« Aber ihre Lippen zitterten. Jedes Wort reizte sie, riß ihr ein Kleidungsstück ab. Sie waren nackt, ihr Atem ging und ging im gleichen Wellenschlag.
»Ich werde immer Ich sein. Ich gehöre dir nie, Thomas, und keinem.«
Ja, was taten sie eigentlich in dem Park
und warum waren sie da? Es wehte ein Wind, der gewöhnliche, zarte Stadtmenschen fast umwarf. Im Hintergrund stand ein altes, trauriges, gelbgraues Schloß. Ihn freute der Wind. »Warum willst du Bücher schreiben? Bücher sind Gestank. Ich will dich ganz für mich. Einen großen Garten sollt du haben. Und da kannst du Kinder kriegen. Oder Häschen großziehn.«
Sie waren wie ein Liebespaar, sie mit ihren wilden Haaren und dem herabgeglittenen Hut, er, der ihren Arm hielt, sie mit dem Knie stieß. Sie wußte durchaus nicht mehr, was sie denken sollte; das Denken tat ihr weh. »Sei meine Frau ein Jahr und hab’ einen Buben! Ich will dich jetzt noch bedienen. Nachher dienst du mir. Und du wirst alles lernen, was die anderen Frauen können. Gescheit genug bist du ja!« sagte Thomas Buber.
»Ich kann bloß schreiben,« sagte sie traurig. »Wie wir nur zu einander gekommen sind! Wir passen doch gar nicht zusammen.«
»Du bist böse,« sagte er lachend und sorglos. »Du hast einen Zug von Grausamkeit! Der Trotz in dir ist zu stark, du suchst den, der stärker ist, der dich einzwingt. Einmal eingebrochen, wirst du prachtvoll unter dem Sattel gehen. Alles Vollblut ist lenksam und leistungsfähig.«
Sie suchte die Worte, suchte eine genügende Erklärung. Nun fiel ihr Orff ein. Sie empfand eine wahnsinnige, die Kehle zusammenpressende Furcht. »Ich bin zweimal die Geliebte von Harry Orff gewesen.« Sie mußte ihm gerade in’s Gesicht sehen, obgleich sie ihn nicht ansehen wollte. Sie sah, daß alles Blut aus seinem Gesicht gewichen war, er war weiß wie eine Kalkwand, die Augen glichen jetzt fast Kohlen, so schwarz und grell war ihr Funkeln. »Geh! Geh sehr schnell jetzt!« stieß er hervor. »Du bist mir grauenhaft.«
Alle sieben waren da
Paul Seebeck, Jakob Silberland, Hauptmann a. D. von Rochow, Edgar Allan, Referendar Otto Meyer, Nechlidow. Der junge Melchior saß gesenkten Hauptes im Hintergrund. Paul Seebeck stand auf, und aller Augen wandten sich ihm zu. »Ich habe dreihundert Anfragen erhalten, aber gebeten, sich etwas zu gedulden. Wir sieben, das ist vorläufig genug, die Sache in Gang zu bringen.«
Nechlidow hob den Kopf: »Nun läßt sich nicht leugnen, daß wir eine Sonderstellung einnehmen. Ich schlage deshalb vor: Wir sieben Gründer bleiben das erste Jahr allein auf der Insel und genießen das einzige Vorrecht, in diesem Jahre über uns selbst und den Staat, den wir ja allein repräsentieren, zu verfügen. Dieses Vorrecht ist nur ein anderer Ausdruck für unsere Pflichten und unsere Arbeit.«
Jetzt konnte Otto Meyer sich nicht mehr beherrschen, er mußte Jakob Silberland zuflüstern: »Daß der Kerl seine geistreichen Bemerkungen nie sein lassen kann.«
Halb verlegen und belustigt, suchte Silberland nach einer Antwort; plötzlich aber erhob sich zum allgemeinen Erstaunen Melchior und sagte: »Darf ich eine Frage stellen?«
»Bitte«, sagte Seebeck. Melchior zog die Brauen zusammen: »Wie läßt sich die Idee eines solchen Staates damit vereinigen, daß große Vorarbeiten nötig sind? Daß die Ansiedler sich erst ein ganzes Jahr lang akklimatisieren sollen? Würde es nicht genügen, die Menschen einfach in die Freiheit zu setzen, so daß sie selbst kraft ihrer Menschennatur sich die neue Gemeinschaft schaffen können?«
»Bravo!« rief Nechlidow. »Der Mann kann denken.«
Jakob Silberland begann: »Privatbesitz an Boden läßt sich nur solange rechtfertigen, wie es herrenloses Land in genügender Menge gibt.«
»Herr Seebeck,« sagte Melchior, »Sie sind mir noch eine Antwort schuldig.«
Paul Seebeck griff sich unwillkürlich an die Stirn. »Überlegen Sie, wie viel die Menschen vergessen müssen, was sie selbst und ihre Vorfahren gelernt haben: die Masseninstinkte. Unterschätzen Sie unser Vorhaben nicht; es gilt einen neuen Typus Mensch heranzuziehen.«
»Sie gebrauchen dauernd das Wort: Typus im Sinne von Individuum. Ich finde das fast verdächtig.«
»Ach Gott,« sagte Paul Seebeck gleichmütig. »Typus – Art – was Sie wollen.«
Melchior zog die Augenbrauen zusammen: » Ich kann aber nicht anders, als hinter diesem schiefen Ausdruck ein Problem zu sehen, nämlich daß Sie gar nicht den freien Menschen an sich brauchen und heranziehen wollen, sondern nur einen ganz bestimmten Typus des freien Menschen.«
Paul Seebeck wurde ganz ernst. »Frei sein heißt, von Traditionen und Vorurteilen frei sein. Ich erkenne wirklich nur einen Typus des freien Menschen an; aber der ist sehr umfassend, nämlich alle einschließend, die für die Gemeinschaft im höheren Sinne brauchbar oder notwendig sind.«
»Ja, ja«, sagte Melchior nachdenklich.
Otto Meyer hatte mit einem spöttischen Lächeln zugehört; jetzt aber wurde sein Gesicht ganz ernst. Er machte eine Bewegung, als ob er aufstehen wollte, besann sich dann aber wieder. Herr von Rochow hatte wohl zu viel Wein getrunken, denn sein Lächeln wurde blöder und blöder, und seine treuherzigen, blauen Augen verschwammen immer mehr. Edgar Allan hörte nur zu; mit einem Bleistiftstumpf entwarf er auf dem weißen Tischtuch Hütten und Häuser in einem Stile, der in merkwürdiger Weise eine stark betonte Horizontale mit flachen Bogenlinien verknüpfte.
Der Vertrag
zwischen Penschuk und Urbschad war unterschrieben und günstig für die Siedelung gestaltet. Sie durfte gleich nach Abreise der Gutsherrschaft in den Besitz der Liegenschaften treten. Die Summe war großmütig bemessen und ihre Zahlung das erste Jahr hindurch gestundet. Dieses Abkommen wurde in Gegenwart der Siedler und der Gutsbeamten vorgelesen, dann trat ein jeder zu Penschuk und Urbschad, um durch einen Händedruck sein Einverständnis zu geben. Mathias hätte nie geglaubt, daß diese Handlung so weihelos verlaufen könne. Ihm war, als seien die Kameraden durch einen Vorgang, der sie enger an ihn knüpfen sollte, weiter von ihm abgerückt.
Am späten Nachmittag brachten zwei Fuhrwerke die erwartete Gesellschaft an, eine kleine offene Kalesche, in der, vor sich die Körbe mit den Lebensmitteln, der Diener saß, und ein Bänkewagen, dem Penschuks und ihre Hausgäste entstiegen. Marys Freundin, Lilly v. Kurz geb. Kamenenz, ihr Bruder Egon Kamenenz, der in dem Bankhaus seines Vaters tätig, seine Nebenleidenschaften, Tangotanz und Rennsport, als Hauptberuf betrieb; der Dragonerleutnant Kurt v. Plessow und der Attaché der italienischen Gesandtschaft, Conte Annibale Testi.
Mit der Leichtigkeit der Umgangsformen eines Romanen beherrschte Testi die Lage; schöne Mädchen, Männer von Talent, war das nicht Reiz genug für ein paar Plauderstunden? Der Anruf an ihr südländisches Blut, der von seinem Wesen zu Kornelie ging, mochte sie zur Teilnahme an dem Gespräch der jungen Männer locken, Sabine gesellte sich dazu; eine zweite Gruppe formte sich aus Penschuk, Hartley und Urbschad. Aber unvermischt, wie Öl auf Wasser, sonderten sich der Sohn des Finanzmannes und der Gardeleutnant ab und legten auf Mary Penschuks Höflichkeit Beschlag.
Egon Kamenenz wollte eine sichere Entfernung zwischen seinen schnöden Witzen und den Gegenständen, an denen er sie übte, doch Kurt v. Plessow war aufrichtig ungehalten. Er mißbilligte Penschuks Handlungsweise; unbegreiflich, wie ein deutscher Mann sich seines Heiligsten, der Erde seines Vaterlandes, des Bodens, den seine Voreltern bebauten, ohne Not entäußern könne, obendrein an Leute von verdächtigen Gesinnungen. Er hätte sich der Fahrt nicht angeschlossen, ohne die Lähmung seines Willens, der, überwältigt von des Fräuleins Großedamesitten, taumelnd in dem Dunstkreis ihres Atems hing, wie ein Schmetterling in einer Rosenlaube. Er sah sie an, wie jemand, der zu träumen glaubt. Im Gesetzlichen verwurzelt, fühlte er sich durch jede Regellosigkeit verletzt. Huberts Freimut war ihm Flegelei. Der alte Mann im Leinenkittel und den langen weißen Haaren erschien ihm närrisch, er zweifelte die Sittlichkeit der beiden ungebräuchlich angezogenen Mädchen an; der Bauernsohn Otto Sodählen war ihm keine Störung, ein Bursche mehr, um Schüsseln anzubieten; doch einen Nachmittag im engsten Kreise mit einem Hebräer zu verbringen, schien ihm der Gipfel der Ungebührlichkeit.
Sabine zog Lewicki neben sich und machte ihn zum unwilligen Zeugen des verfänglichen Benehmens, mit dem Kamenenz sie in Verlegenheit zu bringen suchte. Seinen begehrlichen Berührungen und zweideutigen Redensarten wich sie unbefangen aus. »Ich weiß nicht, was Sie unter freier Liebe meinen. Wir sollen in der Siedelung wie Geschwister leben, uns lieb haben und gütig zu einander sein. Freilich,« fügte sie treuherzig hinzu und blinzelte schelmisch zu Kornelie hinüber, »Engel sind wir nicht.« Sie trank mit selbstbewußter Miene ihren Kaffee und dachte: Alle glauben, ich weiß noch nichts von der Liebe. Und ich bekam wohl schon fünfhundert Küsse.
Küssen, sagte er plötzlich
und seine Zähne leuchteten wie die eines Raubtieres. Sie stieß ihn zurück, denn er hatte ein so fremdes, häßliches Gesicht, und seine Kleider rochen nach Leichen.
Egon biß sich auf die Lippen
Dieses heuchlerische Gör, das sich anstellte, als glaube es noch an den Storch, und sich erdreistete, ihm einen Denkzettel zu geben. Da der Spaß versagte, den er sich von den Zigeunern erwartet hatte, fand er seine Gegenwart entbehrlich. Er hing nachlässig in seinem Sessel und öffnete die Lippen nur, um zu essen und zu trinken und nach seiner Schwester halblaute Bemerkungen zu werfen.
Lilly war sehr beschäftigt, vor Hubert ihr Steckenpferd zu reiten: ihren Abscheu vor dem Geld, ihre Sehnsucht nach Bedürfnislosigkeit. Es war ein merkwürdiger Zufall, daß Mary diese Bekenntnisse unterbrach: auf welchen von den Zobelkragen, die sie in Berlin gemeinschaftlich besehen hatten, der Freundin Wahl endgültig gefallen sei, auf den, der zwanzigtausend Mark gekostet habe, oder auf den mit fünfunddreißigtausend angesetzten.
Hier sitzen wir um eine Tafel, dachte Mathias, und bilden uns ein, wir seien von dem gleichen Schlag. Im Traum wechselte er oft mit anderen lange Reden und hörte nur Geräusche, strengte sich vergeblich an, eine Meinung zu verstehen; dasselbe glaubte er jetzt mit wachen Sinnen zu erleben. »Nichts tun sie, als die Luft bewegen,« dachte er.
Jede Utopie
setzt sich aus zwei Elementen zusammen: aus der Reaktion gegen die Topie, aus der sie erwächst, und aus der Erinnerung an sämtliche bekannte frühere Utopien. Utopien sind immer nur scheintot, und bei einer Erschütterung ihres Sarges, der Topie, leben sie wieder auf. Die praktischen Erfordernisse des Mitlebens während der Epoche des revolutionären Aufruhrs und Übergangs bringen es mit sich, daß in der Form der Diktatur, Tyrannis, provisorischen Regierung, anvertrauten Gewalt oder ähnlichem sich während der Revolution die neue Topie bildet.
Die neue Topie tritt ins Leben zur Rettung der Utopie, bedeutet aber ihren Untergang. Die praktischen Erfordernisse sind nicht nur das durch die Revolution gestörte Wirtschaftsleben, sondern sehr häufig Eingriffe aus dem Bereich feindlicher Umwelt. Denn wir dürfen uns ja die Gemeinschaft ebenso wenig isoliert wie begonnen vorstellen; sie ist ringsum begrenzt von wieder Begrenzten, und im übrigen von der anderen Welt, deren Einflüsse und Bedingungen – für unsern Fall z. B. Fehljahre, Naturkatastrophen wie das Erdbeben von Lissabon, für andere Zeiten Kometen, Sonnenfinsternisse, Epidemien – oft von scharfer Bedeutung sind.
Die Revolution neigt nun weiterhin ganz besonders dazu, einen allgemeinen Völkerbrand zu entzünden, Grenzen, die ja überhaupt nur fließende sind, zu durchbrechen usw. Und insbesondere will ja die Utopie unter anderm auch nationale und staatliche Beschränktheiten nicht dulden, sie will den idealen Zustand für die ganze Menschheit usw.
In andern Ländern oder Provinzen sind aber andere auf einer stabileren Stufe, bei denen je nachdem das Herz inniger oder die Dummheit größer ist. So greifen die bedrohten Nachbartopien um ihrer Erhaltung willen oder für die Erhaltung dessen, was ihnen wert ist, zu den Waffen oder sonst bedrohlichen Mitteln: aus der Revolution wird der Krieg oder langwieriger wirtschaftlicher Kampf zwischen Nationen und dergleichen. Die Utopie also wird überhaupt nicht zur äußern Wirklichkeit, und die Revolution ist nur das Zeitalter des Übergangs von einer Topie zur andern.
Det stimmt
warf Egon Kamenenz dazwischen, während er von der Platte, die ihm der Diener reichte, ein Stück Kuchen auf seinen Teller schob. William Penschuk und er unterhielten sich über Deutschlands Handel im Wettstreit mit der Industrie und Technik anderer Nationen. Das heißt, es war meist Penschuk, der die Rede führte, von Egons gewollten Berlinismen unterbrochen. »Es war höchste Eisenbahn, daß es mit dem Gerede von dem Volk der Dichter und Philosophen alle wurde. Goethe, Shakespeare, Ibsen, welcher ausgewachsene Mensch hat noch einen Dunst davon. Zum Einschlafen kooft man sich ein Ullsteinbüchel, und will man sich mal ’nen vergnügten Abend machen, so läßt man sich ’ne Loge holen in die Operette oder in ein Varieté.«
Testi kehrte sich dem Berliner zu. »Das ist natürlich absichtliche Übertreibung, Signore Kamenenz,« seine Zunge stolperte über die ungewohnten Konsonanten, » eine Existenz ohne Kunst und Dichtung wäre unerträglich, aber ich teile Ihre Meinung, man hat den beiden zu großen Platz eingeräumt. Niemand hat darunter mehr zu leiden, als wir Italiener. Wir verbessern unseren Boden, bauen Eisenbahnen, Städte, wir prügeln uns im Parlament herum; aber die Welt beharrt darauf, uns als ein Mausoleum der Vergangenheit zu stempeln. Hunderttausende von Fremden laufen jährlich bei uns durch, fragt je einer nach unseren Wohlfahrtseinrichtungen, nach unseren neuen Gesetzen? Nein, sie stürzen sich in die Museen und Kirchen, sie verlangen nach Giotto, Rafael, Bramante, Michel Angelo und schnüffeln in Ruinen. Wahrhaftig, so leidenschaftlich man sie liebt, man möchte manchmal einen Hammer nehmen und alles kurz und klein zerschlagen, die Antike, das Tre-, Quatro- und Cinquecento und die Renaissance, damit Platz wird für das zwanzigste Jahrhundert.«
»Bravo«, der Beifall kam von Plessow. »Ich habe eigentlich kein Recht, da mitzureden, alle diese Tschentos für die Sie schwärmen, Graf, sind mir unbekannt. Aber den meisten, die in die Museen rennen, geht es genau so wie mir. Darum war mir die Auslandsanbeterei meiner Landsleute von je verhaßt. Sie sind ja so verrückt mit ihrem Goethe, sie sollten auch beherzigen, was er einmal prophezeit hat: die Welt wird nicht eher gesund, ehe sie nicht ganz deutsch geworden ist.«
Frau v. Kurz konnte es sich nicht versagen, mit ihrer Belesenheit zu glänzen. »Verwechseln Sie Goethe nicht mit Geibel? Und es mag am deutschen Wesen / Einmal noch die Welt genesen.«
Kurt v. Plessow blieb höflich. »Gnädigste haben sicher recht. Außerdem hätte ich mir denken können, daß so was nicht von Herrn Goethe stammt. Der ist ein viel zu schlechter Patriot gewesen.«
Hier endet unsere wissenschaftliche Darstellung
sie scheitert an der Zukunft, von der wir nichts wissen, und nun erst tritt die Bedeutung der Vergangenheit, von der wir nichts wissen, recht hervor. Wie aber jeder Mensch aus der Tiefe der Zeit heraus aus dem Bodenlosen herkommt, so gestaltet er sich – er wie alle seine Vorfahrenglieder – auch aus der Weite des Raumes her aus dem Unaufhörlichen, Rastlosen und Unzähligen. Denn was sich Sichtbares, Sinnenmässiges, Stoffliches also an einem Menschenleibe findet, ist immer anderes, von außen Hereingekommenes, Wechselndes. Es ist so kein Unterschied und keine Trennung zwischen den Vorfahren, die ich bin, und den Vorfahren, die ich habe, und der Umwelt, aus der ich werde. Wohl aber ist ein Unterschied: zwischen mir und dir, wie zwischen Welt und Welt. Denn du bist nur mein winzig Teilchen und bist doch wie ich eine ganze Welt; und ich bin nur dein winzig Teilchen und bin doch wie du eine ganze Welt. Darum braucht es, wie die Welten durch die Brücken des Lichtes verbunden sind, zwischen den Menschen des Geistes, der die Liebe ist, der die Formen des Mitlebens schafft, die Familie, die Herde, die Nation (Sprache, Sitte, Kunst), und der wiederum die starr gewordenen Formen, die Haß, Geistlosigkeit und Unbill erzeugt haben, in neuer Gemeinsamkeit sprengt.
Alles was wir wissen, deutet darauf hin, daß es keinen Fortschritt in der Menschengeschichte als Ganzes gibt, sondern Aufhören bestimmter Kulturen durch Alter – nicht der Völker, das ist Unsinn, sondern der Kulturen für diese Völker – und durch Völkermischung. Der sogenannte Untergang eines Volkes ist natürlich kein Aussterben, sondern eine Völkermischung. Die Stämme und Völker schieben sich vielfach und unausgesetzt durcheinander, ineinander, übereinander und in diesen Geschieben sind alle gleich alt – haben alle an der gleichen ehrwürdigen und grossen Vergangenheit teil, werden alle von Zeit zu Zeit wie müde und ruhebedürftig, und von Zeit zu Zeit wie primitiv, ursprünglich und neubeginnend.
Ohne Übergang
knüpfte Plessow den alten Faden wieder an, erklärte Kamenenz und Testi, daß sie alle drei in der Hauptsache der gleichen Meinung seien, es sei für die Nationen an der Zeit, sich ihrer besonderen Aufgaben bewußt zu werden. Um sich gleich wieder von dem Italiener abzuwenden: es ginge nicht mehr so weiter mit der Verfälschung des Germanentums, es müsse ein Ende nehmen mit dem Geschreibsel, das den Sinn des deutschen Volkes vergifte. Das Liebäugeln mit aufrührerischen Gedanken müsse weg. »Mannszucht gehört wieder her, Gottesfurcht,« er straffte sich, als grüße er den höchsten Vorgesetzten, »und Königstreue.« Zum Glück stehe Einer vor der Tür, der werde mit eisernem Besen kehren, mit allem aufräumen, was sich an wüstem Unkraut auf deutschem Boden eingenistet habe, und wieder Platz für echtes Volkstum schaffen. Er machte eine Pause, ehe er mit ehrlicher und ernster Überzeugung sagte: »Der Krieg.«
»Und das nennen Sie ein Glück?«
»Sie glauben an den Krieg?«
»Ob ich an ihn glaube? Ich erwarte ihn mit Ungeduld.«
Schon war Graf Testi mit versöhnlicher Beflissenheit dabei, die Gewalt der geharnischten Erklärung des Leutnants abzuschwächen. Ihm sei selbstverständlich Verschwiegenheit auferlegt, aber als Bundesgenosse fühle er sich verpflichtet, seinen geschätzten Alliierten zu verraten, daß die Regierungen alles daran setzten, die Funken der Zwietracht zwischen den Nationen auszutreten, er persönlich vertraue ganz der Kunst der Diplomaten.
Kornelie sagte leise, aber ganz verständlich: »Ich begreife, daß man sich an seinen Feinden rächen will.«
Mathias Urbschad begann ganz sanft; lobte ihr Recht zur Offenheit, nur habe sie damit nicht das rechte Zeugnis für den Geist der Siedelung abgelegt. Deren Ursprung, ihr Ziel sei Liebe. Weltliebe, weil jeder Mensch den ganzen Kosmos in sich schließe. Liebe zum mütterlichen Boden, von dem ein Fluch die große Masse trenne, und in den sich einzuwurzeln, die Siedelung freiwillig auf Überflüssiges verzichte. Und diese Formung der Gesellschaft sei nicht für eine ferne Zukunft, sie sei als augenblicklich Wirkendes gedacht, als der Vorsatz, die Zustände, durch eigene Veränderung, zu wandeln.
»Meister«, stammelte Ephraim Lewicki, wie über sich hinausgehoben und der Anwesenheit der übrigen entrückt. Zum Mittelpunkt der allgemeinen Beobachtung geworden, verlor er seine Fassung: »Welcher Christ würde nicht sein Leben eher geben, als die Hostie auszuspucken? Warum sollte man in die Menschen nicht auch dieselbe Ehrfurcht vor dem Menschenleben pflanzen können?«
William Penschuk, der einzige in seinem Kreise, der von Leo Tolstoi wußte, runzelte mißbilligend die Brauen. Eine solche Taktlosigkeit hätte unterbleiben müssen; ein Jude durfte hier nicht an die Geheimnisse der Hostie tasten. Kurt v. Plessow klemmte das Einglas in den Winkel seines linken Auges und sagte schnarrend: »Die Mitglieder der Siedelung sind wohl alle keine Deutschen.«
Mathias gab sich den Anschein, als fasse er den Angriff wie eine unbefangene Frage auf. »Meine Kinder sind in Amerika geboren, ich habe sie zu seinen Bürgern gemacht, um sie vor Härten zu bewahren, die Menschen unserer Weltanschauung in Deutschland noch bedrohen. Aber wenn deutsch sein heißt: mit allen guten und schlechten Eigenschaften den Vorstellungen von Jugend ähnlich sein, wie wir sie unpraktischen Leuten danken, die man deutsche Dichter nennt, dann sind Hubert und Sabine Deutsche.«
Das Einglas saß nicht mehr in Plessows Auge
Er sagte einfach, doch nicht unbescheiden: »Ich habe mich mit Bücherlesen nie viel abgegeben, Herr Urbschad. Meine deutsche Eigenschaft ist Tapferkeit.«
»Das soll heißen, daß Sie mich für feige halten, Herr v. Plessow, weil sich mir die Völker nicht in Freunde und in Feinde unterscheiden.« So wie Hubert, mochte einst dem Ritter zu Mut gewesen sein, wenn er vor seiner Dame die Lanze gegen seinen Nebenbuhler hob. »Ich war noch nicht fünfzehn, da habe ich in Südamerika Sumpfland ausgetrocknet. Vater hat mich weggebracht. Aber eine Ernte habe ich miterleben dürfen. Wenn die Menschen alle Mittel, die sie verschwenden, um sich in Kriegen das Land gegenseitig zu entreißen, darauf verwenden würden, um es durch Friedensarbeit zu bebauen, Wüsten bewässern, Kanäle bauen, Sümpfe trocknen, niemand brauchte zu hungern. Das ist der Krieg, in den ich ziehen will.«
Frau v. Kurz versagte sich nur schwer das Händeklatschen. Was für ein wundervoller Nachmittag! Was für Anregungen! Doch Mary schlug allmählich die Beharrlichkeit zum Überschwang in den Bekenntnissen der Siedler auf die Nerven. Sie erklärte sich für viel zu dumm, um sich ein Urteil über so ernste, in den Weltlauf einschneidende Dinge zu erlauben; sie meine aber, auch den gescheiten Männern könne es nicht möglich sein, sie hier, gewissermaßen aus dem Stegreif, zu entscheiden. Und da man heraufgekommen sei, um sich zu vergnügen, beantrage sie, die Streitaxt zu begraben und sich im Freien irgendeinem Spiele zuzuwenden. Doch die Siedler, in der Kunst der Verstellung ungeschult, fielen durch ihr Benehmen aus dem Rahmen, und als eine Wolke, die schon lange drohte, mit einem leichten Schauer niederging, verhinderte es die überstürzte Abfahrt, festzustellen, wer wem die Hand zum Abschied drückte und wer wem nicht.
Wir wissen von der Vergangenheit
nur unsere Vergangenheit; wir verstehen von dem Gewesenen nur, was uns heute etwas angeht; wir verstehen das Gewesene nur so, wie wir sind; wir verstehen es als unseren Weg. Anders ausgedrückt heißt das, daß die Vergangenheit nicht etwas Fertiges ist, sondern etwas Werdendes. Es gibt für uns nur Weg, nur Zukunft; auch die Vergangenheit ist Zukunft, die mit unserm Weiterschreiten wird, sich verändert, anders gewesen ist. Damit ist nicht bloß gemeint, daß wir sie je nach unserm Weiterschreiten anders betrachten. Ich behaupte vielmehr aller Paradoxie zum Trotz ganz wörtlich, daß die Vergangenheit sich verändert. Indem nämlich in der Kette der Kausalität nicht eine starre Ursache eine feste Wirkung hervorbringt, diese wieder zu Ursache wird, die wieder ein Ei legt usw. So ist es nicht. Nach dieser Vorstellung wäre die Kausalität eine Kette hintereinander folgender Positionen, die alle außer dem Letzten still und angewurzelt feststünden. Nur der Letzte geht einen Schritt vorwärts, aus ihm entspringt dann ein Neuer, der wieder weiter vorgeht und so fort. Ich sage dagegen, daß es die ganze Kette ist, die vorwärts geht, nicht bloß das äußerste Glied. Die sogenannten Ursachen verändern sich mit jeder neuen Wirkung.
Doktor Oremus
leitete das Sanatorium Mithrasberg, die Zuflucht aller jungen Frauen, die ihre Nerven plagten, die der Müßiggang launenhaft und matt machte. »Von allen Männern weiß er am meisten von Frauen. Sybille, Ihnen fehlt Oremus!« Wirklich wurde Sybille grau um die Augen und magerte auffällig ab. »Er ist ein Künstler auf seinem Gebiet! Doktor Oremus die Gebärmutter beschreiben zu hören, ist ein Gedicht, ist Caruso!« Oremus folgte dem Leitsatz, daß ein junges Mädchen erst Frau werden mußte, ehe man ihre weiblichen Möglichkeiten erkannte. Ein Mädchen überhaupt war ein Widersinn, etwas Unerlaubtes, wie eine Auster, die bloße Schale wäre oder eine taube Mandel. Die Frau war sein Studium, seine Leidenschaft, sein Gottesdienst.
Seine Anstalt war mustergültig eingerichtet. Er hatte immer die interessantesten Patientinnen, reiche, hübsche und elegante Frauen! Doktor Oremus selbst war unverheiratet, aber auch seinen Assistenten mochten Pflichten und Fesseln der Ehe nicht lächeln. Es waren weltmännisch gebildete, schmiegsame und gesellige Herren; Doktor Oremus hielt darauf, daß die Form nicht verletzt wurde, den Skandal fürchtete und brandmarkte er. Ein einziges Mal war ihm geschehen, daß eine junge und vornehme Frau sich bei ihm erhängt hatte. Natürlich war sie gemütskrank gewesen; der Vorfall hatte ihm geschadet. Schwerkranke, bedrückte oder unzufriedene Patientinnen entfernte er unnachsichtig, unbemittelte kamen nicht oder sie gingen sehr bald, nach der ersten Wochenrechnung, wieder.
Wenn man diese weißen, mit Blumen geschmückten Tische zwischen den hohen Spiegelwänden des großen Speisesaals, die erlesenen Toiletten, das angeregte Geplauder herüber und hinüber sah, hätte niemand an Kranke oder Heilungsuchende geglaubt. »Trotzdem sind diese Frauen schwerkrank!« sagte Oremus zu Sybille. »Sie würden, sich selbst überlassen, unerhörte Dinge begehen, auch Verbrechen. Dem Willen dieser Frauen fehlt jede Hemmung, sie sind reine Triebwesen, sie sterben am Eisenmangel, an der Furcht vor Schmerzen, in beständiger Narkose.«
»Warum unterstützen Sie die Narkose?«
»Man soll Nachtwandler nicht anrufen. Ein Bibelspruch warnt: Vor allen Dingen behüte dein Herz, denn aus ihm sprießt das Leben! Nun gut, es existiert nicht mehr in unserer heutigen Gesellschaft, dies Organ ist abgestorben. Warum diesen Frauen sagen, daß sie lebendig Tote sind, daß nichts ihnen Haltung gibt oder sie reizend macht, wie die Eitelkeit? Die Eitelkeit wird im späteren Leben Habsucht, Hochmut oder Bigotterie. Dies Schicksal steht ihnen bevor – allen!«
»Sie sind keine Patientin, Sie wollen krank sein! Weil Sie vor der Gesundheit Angst haben. Am Tag, wo Sie sich entschließen, die Furcht abzuwerfen, und kostete es Sie den Kopf! – sind Sie gesund.«
Sybille war rasch und heftig errötet: »Warum denken Sie dabei an Kopfabschneiden?«
»Ich denke oft daran. Mit Exekutionen ist immer ein großer Aderlaß verbunden, und wahrscheinlich ist ja das Ende dieser ganzen jetzigen Entwicklung eine gewaltsame Revolution. Der Gesamtkörper hilft sich so, wenn er überhaupt lebensfähig bleiben will. Sonst sähe ich die Zukunft sehr trübe.«
»Wir haben die Reserve im Volk.«
»Volk« – sagte der aristokratische Doktor ungeduldig. »Gehen Sie mir doch mit dem Volk! Da hilft die Schwindsucht dem Schnapsverbrauch. Ich erwarte medizinisch nichts vom Volk – Krisen, Spasmen, Krampfanfälle des Schreckens oder der Kommüne. Unsere Bourgeoisie ist angefault. Die Frau will nicht mehr gebären und unsre wirtschaftlichen Verhältnisse zwingen sie zur Unfruchtbarkeit. Welchen Daseinszweck hat eine Frau ohne Kinder?«
»Sie kann arbeiten.«
»Maschinenarbeit tun, das Ideal des Zukunftsstaats! Die Wirklichkeit rettet uns immer wieder vor allen Idealen. Ich glaube an den Schnitt, an die Blutabzapfung und natürliche Neubildung, bis die abermalige Stauung kommt oder das Alter und der Tod.«
Die Vergangenheit ist das, wofür wir sie nehmen
und wirkt dem entsprechend sich aus; wir nehmen sie aber nach tausenden von Jahren als ganz etwas anderes als heute, wir nehmen sie oder sie nimmt uns mit fort auf den Weg. Es gibt für uns zweierlei, durchaus verschieden formierte, zwei verschiedenen Bereichen angehörige Vergangenheit. Die eine Vergangenheit ist unsre eigene Wirklichkeit, unser Wesen, unsre Konstitution, unsre Person, unser Wirken. Was immer wir tun, die herüberlangenden und durchgreifenden lebendigen Mächte des Vergangenen tun es durch uns hindurch. Diese eine Vergangenheit manifestiert sich auf unendlichfache Art in allem, was wir sind. Alles was in jedem Moment überall geschieht, ist die Vergangenheit. Ich sage nicht, daß es die Wirkung der Vergangenheit ist; ich sage sie ist es. Ganz etwas anderes aber ist jene zweite Vergangenheit, die wir gewahren, wenn wir zurückblicken. Man möchte fast sagen: die Elemente der Vergangenheit haben wir in uns, die Exkremente der Vergangenheit erblicken wir hinter uns. Die Vergangenheit, die lebendig in uns ist, stürzt mit jedem Augenblick in die Zukunft hinein, sie ist Bewegung, sie ist Weg. Jene andere Vergangenheit, nach der wir uns umblicken, die wir aus Überresten konstruieren, von der wir unsern Kindern berichten, die als Bericht der Vorfahren auf uns gekommen ist, hat den Schein der Starrheit, kann sich auch nicht, da sie zum Bild geworden, keine Wirklichkeit mehr ist, fortwährend verändern. Sie muß vielmehr von Zeit zu Zeit, in einer Revolution der Geschichtsbetrachtung, revidiert, umgestürzt und neu aufgebaut werden. Und sie baut sich überdies für jeden Einzelnen besonders auf: jeder Einzelne gewahrt die Bilder anders.