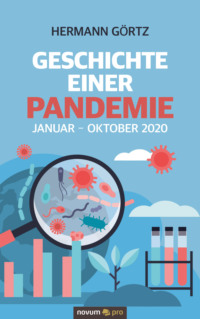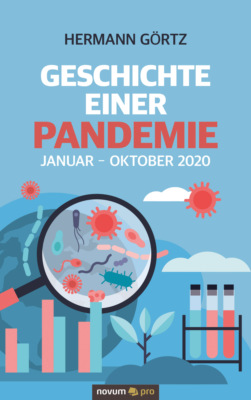Kitabı oku: «Geschichte einer Pandemie», sayfa 8
Kredit für etablierte Firmen Unternehmen, die mehr als fünf Jahre am Markt sind, können den KfW-Unternehmerkredit beantragen. Dieser kann für Investitionen, Betriebsmittel, Akquisitionen sowie für Leasingkosten eingesetzt werden. Die KfW übernimmt bei diesen Krediten einen Großteil des Haftungsrisikos. Bei kleinen und mittleren Unternehmen bis 90 %, bei Großunternehmen bis 80 %. Unter bestimmten Voraussetzungen ist ein Kredit bis zu einer Milliarde € möglich. Bei Krediten unter drei Millionen € entfällt eine Risikoprüfung. Zwischen drei und zehn Millionen € gibt es ein Schnellverfahren.
ERP-Gründerkredit Bei Unternehmen, die weniger als fünf Jahre am Markt sind, muss genauer hingeschaut werden: besteht das Unternehmen mindestens seit drei Jahren, übernimmt der Bund beim ERP-Gründerkredit Universell bis zu 90 % des Risikos bei kleinen und mittleren und bis zu 80 % bei Großunternehmen. Die sonstigen Kriterien sind identisch mit den Voraussetzungen beim KfW-Unternehmerkredit. Unternehmen, die weniger als drei Jahre am Markt sind, können diesen Kredit zwar in Anspruch nehmen, haben aber keine Haftungsfreistellung durch die KfW. Das heißt, dass die Hausbank das komplette Kreditrisiko trägt. Für Startups und Unternehmensnachfolger gibt es das ERP-Gründerkredit-Startgeld. Dieses kann bis zu maximal 100.000 € Kreditvolumen und bis zu 30.000 € für Betriebsmittel genutzt werden.
Die Kunst zu Hause zu bleiben
Der Urlaub, egal wohin, ist für uns Deutsche eine Herzensangelegenheit. Nun ist in diesem Jahr alles ein wenig anders. Wir wissen noch nicht, ob wir überall hinfahren können, und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Fernreisen liegen in weiter Ferne, Lieblingsländer stehen auf der Kippe, Ziele im eigenen Land sind schnell ausgebucht. Glücklich, wer ein Wohnmobil hat und einen Stellplatz findet. Wenn der Sommer kommt – das schöne Wetter lockt – hat der Deutsche sich so sehr daran gewöhnt, dass es uns irrigerweise als Menschenrecht erscheint, wegzufahren. Das am häufigsten gebrauchte Adjektiv zum Nomen „Urlaub“ lautet „wohlverdient“.
Exotische Urlaubsziele, begehrenswerte Orte gelten hierzulande als Statussymbole. Die Frage „Wo geht’s diesen Sommer hin“, geht bei uns nach Ostern als Begrüßungsformel durch. Nun weiß zum ersten Mal seit Jahrzehnten niemand mehr eine Antwort darauf. Vielleicht urlauben wir am Ende im eigenen Bundesland. Oder eben zu Hause. Was dummerweise das Gegenteil von Fortgehen ist. Andererseits: sollten wir einen freien Strand finden, müssen wir diesen stundenweise im Voraus buchen. Mit Maske frühstücken. Und so weiter. Deprimierende Aussichten, die auch keinen Spaß machen.
Was also tun, wenn man eigentlich nicht viel tun kann? Das Einzige, was bleibt: wir müssen unsere Einstellung zum Urlaub ändern. Erkennen, dass das Feriengebiet gleich hinter der Haustüre beginnt. Oder in den eigenen vier Wänden. Was natürlich nicht so einfach ist, wie man bereits in den Osterferien sehen konnte, dem Testlauf für die große Strecke von Juni bis August. Wie viele Wände neu gestrichen wurden, nur weil man Angst hatte, auf die immer selben starren zu müssen. Daheimbleiben heißt also, der Wahrheit ins Gesicht sehen. Die Kunst besteht nun darin, nicht nur die Langeweile oder die Hässlichkeit im allzu Bekannten zu sehen, sondern dessen Möglichkeiten.
Wer der Geschäftigkeit, dem „Gesumm“ des Alltags
entgehen will, rät der große französische Alltagsphilosoph
Roland Barthes, der müsse lernen ruhig zu sitzen und
nichts zu tun: „Das Gras wächst von selbst.“
Wer das Problem mit dem Kind, welches rund um die Uhr beglückt werden muss, nicht hat, hat dann immer noch die Möglichkeit, nichts zu tun. Aber, wer kann das schon? Erinnern Sie sich noch an Ihren letzten Kurztrip? Vielleicht eine Städtereise, vollgestopft mit Programmpunkten. Wie schnell die Zeit dabei verging, wie lang sie jedoch im Nachhinein schien, weil man in wenigen Stunden so viel erlebt hat. Unter Corona-Bedingungen verhält es sich nun genau andersrum: die Stunden ziehen sich in endloser Gleichförmigkeit, und doch: ist es zu fassen, dass der Mai schon fast vorbei ist?
Aber wie soll das bloß im Sommer werden, wenn keine geordneten Strukturen unser Sein bestimmen? Werden wir dann die Zeit mit Strichen an der Wand markieren, bis die Tage wieder kürzer und kälter werden und wir uns wenigstens ins Bett flüchten können. Sollten wir die kostbare Sommerzeit einfach abschreiben? Uns geht es wie dem Schiffbrüchigen auf einer einsamen Insel. Wir haben nichts, nur uns selbst und vielleicht noch eine Familie. Wie sollen wir diesen Sommer nur überstehen?
NRW-Wirtschaftsplan
Wie kann sich das Land, die Familien und die Wirtschaft von der Folgen der Corona-Krise erholen? NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bezeichnet die gegenwärtige Situation als „größte Wirtschaftskrise seit dem zweiten Weltkrieg“. Dazu stellen er und NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) Ideen für ein bundesweites Konjunkturprogramm vor. Wichtig sei es, „Impulse für die gesamte Volkswirtschaft“ zu setzen. Dieses Konzept soll als Vorschlag für den Bund dienen und beruht laut Laschet auf wirtschaftswissenschaftlichen Studien des RWI und DIW. Es müsse „eine neue Gründerzeit“ einsetzen, fordert A. Laschet und: „es gibt kein Zurück zum Wirtschaften wie 2019“. Klimaschutz und Digitalisierung müssten zentrale Bestandteile des Konjunkturprogrammes sein. Jawohl!
10-Punkte-Programm
Öffentliche Investitionen in Digitales, Bildung und Verkehr. – Härtefallprogramm für Unternehmen. – Steuerliche Entlastung für Unternehmen. – Bürokratieabbau und schnellere Genehmigungsverfahren. – Digitalisierung der Schulen und öffentlichen Verwaltung. – Klimaschutz beim Wirtschaftswachstum berücksichtigen. – Startbereite Projekte in Kohleregionen vorziehen. – Beteiligung an Firmen. – Innovationen in Zukunftsbranchen fördern. – Internationale Zusammenarbeit.
Wenn dieses Programm das Ergebnis von zukunftsorientierter Politik ist, verstehe ich die Welt nicht mehr. „Alter Wein in neuen Schläuchen“. Jetzt in der Krise stellt man fest, wo es überall hapert. Wir werden seit Jahren mit diesen Floskeln der Parteien, insbesondere vor Wahlen, abgespeist. Was habt ihr eigentlich bisher gemacht? Wenn es nicht mehr ist, wie Programme zu verkünden, ohne auf ihre Durchführung und Wirksamkeit dieser hinzuarbeiten und durchzusetzen, ist Politik doch nur ein Scheinriese, eine Farce!
Liebe Politik, in Zeichen dieser Pandemie machen sich viele Menschen ernsthaft Sorgen um die Zukunft. Ich auch! Wie wäre es, wenn die Politik mal hingehen würde und alle in dieser Krise erkennbaren und auch großen Defizite festhält – und sich damit einmal eingehend beschäftigt. Das betrifft viele Gesellschaftsbereiche. Wenn diese mal abgearbeitet sind, geht es erst richtig los. Ich mag nicht an die Kriegsgebiete und Flüchtlinge denken. Schon gar nicht an die Umweltflüchtlinge und Hungernden, welche Dank Klimakatastrophe demnächst vor unserer Tür bzw. vor Europa stehen. Da kommen ganz andere Aufgaben auf uns zu. Nun kommt noch ein wichtiger Aspekt hinzu. Uns rennt die Zeit weg. Wir können uns keine Spielchen mehr leisten, schon gar keine parteipolitischen.
Helden der Sonntagsreden
Pflegekräfte bekommen in der Pandemie so viel Aufmerksamkeit wie noch nie. Politiker fordern bessere Bezahlung für Pflegeberufe, und nicht nur Politiker, sondern auch die Gesellschaft. Doch der Weg dahin ist steinig und sehr teuer. Der Alltag in einem Pflegeheim ist nicht „vergnügungssteuerpflichtig“. Versuchen sie einmal, einem Demenzkranken begreiflich zu machen, dass er Abstand halten muss und sein Zimmer nicht verlassen darf.
Vor der Pandemie war die Arbeit schon nicht zu schaffen, obwohl die Angehörigen bei Besuchen mitgeholfen hätten. Durch die Besuchsverbote und Beschränkungen fiel diese Hilfe auch noch weg. Die Sorge, dass man Bewohner durch unvorsichtiges Verhalten ansteckt und vielleicht schuld am Tod von Menschen ist, bedeutet eine große psychische Belastung für das Personal. Dass zu Beginn der Pandemie nicht ausreichend Schutzkleidung vorhanden war, ist bekannt.
„Beifall ist schön, aber mehr Geld wäre mir lieber“, sagte eine Altenpflegerin in einem Facebook-Beitrag. Nun wären wir im Thema. Die durchschnittliche Bezahlung eine Altenpflegers ist brutto bei etwa 2.400 €. Damit liegt dieser Verdienst etwa 1.000 € unter dem mittleren Einkommen von Fachkräften. Im Westen ist die Bezahlung etwas besser, aber auch dort sind die Gehälter unterdurchschnittlich. In der Krise war man sich schnell einig – da muss was getan werden. Landauf, landab wurde ausgiebig darüber diskutiert. Alle waren sich einig, so geht es nicht weiter. Der Anfang ist gemacht!
Die sogenannten „systemrelevanten Berufe“
haben dafür gesorgt, dass unser Alltag, bis auf
Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote,
eigentlich krisenfrei für viele abgelaufen ist.
Aber was haben wir für ein Gesellschaftsbild, wenn wir in
Frage stellen, ob der Mensch überhaupt noch relevant ist?
Union und SPD haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dafür zu sorgen, dass „Tarifverträge in Altenheimen flächendeckend zur Anwendung kommen“. So weit, so gut. Doch die Branche ist stark zersplittert und unübersichtlich. Es gibt mehr als 14.000 Heime und 13.000 ambulante Pflegedienste, in denen 1,1 Millionen Beschäftigte arbeiten. Auf dem Markt tummeln sich sowohl kirchliche, kommunale, private und sonstige Anbieter. Lediglich ein Fünftel kommt in den Genuss von Tarifverträgen. Und das soll sich nun ändern. Bis zu 3.000 € soll nun eine Vollzeitkraft erhalten. Dies hatte J. Spahn schon 2018 verkündet. Die gesetzlichen Grundlagen für flächendeckende Tarifverträge sind geschaffen. Arbeitgeber und Gewerkschaften verhandeln einen Tarifvertrag für einen Großteil der Beschäftigten, der dann auf die gesamte Branche ausgeweitet wird. So läuft das auch auf dem Bau.
Für die Pflege muss aber ein Sonderweg gefunden werden, denn es fehlt aufseiten der Arbeitgeber schlicht ein Verhandlungspartner. Die Arbeitgeber der privaten Einrichtungen unter Führung des früheren FDP-Politikers Rainer Brüderle fallen aus, da sie Tarifverträge strikt ablehnen. Die neoliberale FDP-Politik hat mit den „systemrelevanten Berufen“ nichts am Hut und ist denen schlicht egal. Sie vertreten andere Interessen und der Staat schaut hilflos zu. Die kirchlichen Träger, die ein weiteres Drittel aller Einrichtungen betreiben, schließen grundsätzlich keine Tarifverträge ab, weil die Kirchen nicht dem normalen Arbeitsrecht unterliegen, sondern den sogenannten Dritten Weg praktizieren.
In mühsamen Verhandlungen gelang es aber, eine ausreichend große Koalition der Willigen zu formen. Caritas und Diakonie sind über ein spezielles Konsultationsverfahren einbezogen, was auch immer das bedeutet. Der Verband verhandelt nun schon seit Herbst mit der Gewerkschaft ver.di über einen bundesweiten Tarifabschluss. Ein Abschluss soll im Sommer erreicht werden. Dieser muss nicht nur von den Kirchen, sondern auch vom BM für Arbeit H. Heil mitgetragen werden. Nur er kann diesen Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklären. Die privaten Arbeitgeber haben angekündigt, gegen die Ausweitung auf die gesamte Branche vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen.
Wenn die Privaten über Tarif zahlen würden, wär’s ja auch gut. Dem ist aber nicht so. In einem haben die Privaten aber recht. Sie sagen nämlich: „Wenn die Bundesregierung höhere Gehälter für Pflegekräfte durchsetzen will, muss sie zunächst klären, wer diese bezahlen soll“. Flächendeckende Tarifverträge und ein besserer Personalschlüssel würden die Kosten um ca. 10 Milliarden € nach oben treiben. Das ist kein Pappenstiel. Geschieht nichts, werden die Eigenanteile der Heimbewohner massiv ansteigen. Im Durchschnitt liegen sie heute bei fast 2.000 € im Monat. Viele halten eine weitere Steigerung für unvertretbar. Es geht über eine Erhöhung der Pflegeversicherung oder über Steuergelder. Andere Berechnungsmodelle werden auch noch geprüft.
Reichen die Regeln aus?
Nur wenige Tage nach der Wiedereröffnung vieler Restaurants haben sich im Landkreis Leer in Niedersachsen offenbar sieben Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Die Infektionen stehen vermutlich in Zusammenhang mit dem Besuch in einem Lokal. Ob sich die Besucher oder das Personal nicht an die Regeln gehalten haben, sei noch unklar. Seit der Öffnung von Restaurants gelten für die Gastwirte und Gäste strenge Auflagen, wie das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und das Einhalten von Mindestabstand.
Es wird deshalb dringend an Gastwirte und Gäste appelliert, sich verantwortlich zu verhalten und die Regeln zu befolgen. Auch den Gästen müsse klar sein, dass man die Tische nicht verrücken dürfe und dass die Beschränkung von Personen aus maximal zwei Hausständen, die ohne Mindestabstand an einem Tisch sitzen dürfen, so festgelegt und nicht verhandelbar sei. Das gemeinsame Ziel kann nur so funktionieren. „Wir sitzen alle in einem Boot, es soll Spaß machen und dafür müssen alle mitrudern.“ Hier zeigt sich, dass in geschlossenen Räumen die Gefahr einer Ansteckung besonders hoch ist und nicht unterschätzt werden darf.
Bundesweit gilt: die Kontaktbeschränkungen bleiben
vorläufig bis zum 5. Juni 2020 bestehen, ebenso die
Hygiene- und Abstandsregeln.
Eine dichte Menschenmenge drängelt sich am Mittwochabend (20.5.) vor Kneipen auf dem Brüsseler Platz in Köln. Kaum jemand wahrt den Mindestabstand oder trägt eine Maske. Kurz vor Mitternacht räumt die Polizei den Platz. Anwohner berichten, dass es an den Tagen zuvor ähnliche Szenen gegeben habe. Es gibt nun auf dem Brüsseler Platz ein Verweilverbot – montags bis freitags von 18 Uhr bis 1 Uhr sowie samstags und sonntags schon ab 15 Uhr. Die Gastronomie ist davon ausgenommen. Und den Rheinboulevard darf man täglich von 15 bis 6 Uhr gar nicht mehr betreten. Auch dort hat es etliche Verstöße gegeben. Die Vatertagsfeiern verliefen in Köln im Großen und Ganzen durchweg unauffällig.
Demokratie kennt keine Quarantäne
Vor 71 Jahren, am 23. Mai 1949, wurde das Grundgesetz verkündet. Kanzlerin Merkel verteidigte am Tag des Grundgesetzes die Corona-Einschränkungen. „Die Grundrechte wurden im Zuge der Corona-Krise teilweise stark eingeschränkt.“
Bundeskanzlerin Merkel hat die Einschränkungen von Grundrechten in dieser Krise erneut als „Zumutung“ für die Demokratie bezeichnet. Sie sagte auch, dass sie die Sorgen von Bürgern angesichts der Einschränkungen in der Pandemie verstehe. Die Regierung macht es sich mit den Beschränkungen von Grundrechten nicht einfach. „Deshalb sollen sie so kurz wie möglich sein. Aber sie waren notwendig, und das haben wir auch immer begründet, weil wir uns der Würde der Menschen verantwortlich fühlen, so wie es im Artikel 1 unseres Grundgesetzes gesagt ist.“
Demokratie heißt auch, sich in seine eigenen
Angelegenheiten zu mischen.
Zitat: Max Frisch
Die Politik hat noch nie in ihrer Geschichte so viel begründet und erklärt wie in dieser Corona-Krise. Das war aber auch dringend geboten, da ansonsten die Bürger alle diese Maßnahmen nicht verstanden hätten. Es ging darum, die Überforderung der Gesundheitsdienste zu vermeiden. Der Lockdown und auch die Lockerungen wurden ausführlich begründet. Die Regierung hat begründet was ging und was nicht ging. Sie hat versucht die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen mit dem Gesetz in Einklang zu bringen, und laufend gemahnt, die Regeln einzuhalten. Eine Leistung in dieser Art ist in unserem Lande noch von keiner Regierung erbracht worden.
In zahlreichen deutschen Städten fanden am 23. Mai erneut Demonstrationen gegen die staatlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie statt. Es muss niemand die Beschränkungen gut finden oder befürworten. Aber hinzugehen und zu posaunen: „Wir sind das Volk“, geht entschieden zu weit. Sie sind ein ganz kleiner Teil des Volkes – und das Volk, das wir ja alle sind, hat vielleicht eine andere Meinung. Es darf auch gegen die Einschränkungen der Grundrechte demonstriert werden. Vielleicht ist ja auch nicht alles verhältnismäßig. Wer aber hingeht, stolz sein selbstgemaltes Plakat mit der Aussage: „Ich will meine Freiheit wiederhaben“ zeigt, weiß gar nicht, was Freiheit im eigentlichen Sinne bedeutet. – Der Staat kann sich seine Bürger nicht immer aussuchen. Der Bürger aber seinen Staat. Es ist jedem deutschen Staatsbürger freigestellt, in das Land seiner Wahl zu gehen. – Das ist nicht überall so, aber das ist wirkliche Freiheit.
Nun möchte ich mich den sogenannten Demonstranten widmen, deren einziges Ziel es ist, zu hetzen, zu brüllen, Lügen zu verbreiten und sich nicht an geltendes Recht zu halten. Diese Klientel weiß genau, dass sie Unrecht ausübt. Goethe hat schon vor 200 Jahren gesagt: „Wer sich den Gesetzen nicht fügen will, muss die Gegend verlassen, wo sie gelten“. Das wird aber nie passieren. Warum? Weil es für sie kein besseres Land wie unser geliebtes Deutschland gibt, und sie auch keines finden werden mit ihrer Vollkasko-Mentalität.
Muslime feiern Zuckerfest „light“
Das Zuckerfest ist neben dem Opferfest die wichtigste Feier im Islam. Das Fest des Fastenbrechens ab Sonntag, den 24. Mai 2020, markiert das Ende des Fastenmonats Ramadan. Corona macht auch nicht vor Religionen halt. In diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie vieles nicht möglich, was sonst selbstverständlich wäre. Normalerweise ist beim Fastenbrechen das Haus voller Gäste. Man achtet nun darauf, dass sich nur zwei Familien treffen. Es wird sich in verschiedenen Räumen aufgehalten und, wenn es möglich ist, im Freien. Das Fest dauert drei Tage und beginnt normalerweise mit dem Gebet in der Moschee. Nun beten die Muslime zu Hause und verzichten aufs Händeschütteln und auf Umarmungen. Der obligatorische Handkuss gegenüber Älteren, als Zeichen des Respekts, fällt auch aus. Eigentlich unvorstellbar für die Muslime. Laut Aussage vieler Muslime verzichten sie in diesem Jahr auf viele Glaubensrituale. Aber Süßigkeiten zum Zuckerfest, die gibt es zur Freude der Kinder schon.
Der neue R-Wert
Das RKI versorgt Deutschland mit aktuellen Zahlen. Dabei wurde die Berechnung für die Reproduktionszahl nun verändert –sie ist höher als der alte Wert.
Am Donnerstagabend hat das RKI erstmals den neuen geglätteten R-Wert vorgestellt. Bei diesem werden zum einen Corona-Hotspots, wie zuletzt die Schlachthöfe, herausgerechnet, da diese den Wert verzerren würden. Bei dem geglätteten R--Wert handelt es sich um einen Durchschnittswert. Er bezieht sich auch auf einen längeren Zeitraum und unterliegt somit weniger aktuellen Schwankungen. Alles verstanden?
Kurz & Knapp vom 25. Mai
Altmaier plant weitere Hilfen für Mittelstand. – Fußballprofis in Spanien brechen Corona-Regeln und feiern Partys. – Lauterbach: Corona-Schutzvorschriften in Thüringen beibehalten. – Europarat warnt vor Biowaffen-Terror in der Corona-Krise. – Japaner setzen „Corona-Fett“ an. – Wirtschaftsminister optimistisch für Auslandsurlaub. – Zahl der Neuinfektionen in Frankreich steigt nur noch langsam. – Streit um Regeln: Wirtin und Mutter attackieren Polizei. – Epidemiologin: „„Das wichtigste ist der Abstand“. – Übertragung durch Aerosole nicht eindeutig erforscht. – Fähre nach Sylt über Dänemark wieder frei. – Lindner für regional unterschiedliche Regeln. – 23 Infektionen in Düsseldorfer Seniorenheim. – Altmaier will Lufthansa Jahre Zeit geben. – Trump geht wieder Golfen. Aktueller R-Wert 0,94 (24. Mai).
Thüringen stoppt Corona-Schutz
Thüringens Ministerpräsident beendet Einschränkungen ab 6. Juni 2020. Er möchte auf die allgemeinen Schutzvorschriften wie das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und Kontaktbeschränkungen verzichten. Sein Motto lautet: „Von Ver- zu Geboten, von staatlichem Zwang hin zu selbstverantworteten Maßnahmen“. Anstelle von landesweiten Regelungen soll es regionale Maßnahmen geben, abhängig vom Infektionsgeschehen vor Ort. Im März sei man von 60.000 Infizierten in Thüringen ausgegangen, aktuell haben wir 245 Infizierte, stellt Ramelow fest. Das ist wirklich nicht viel.
Kritiker sehen diesen Vorgang mit Besorgnis. Karl Lauterbach sagt: „Wir haben immer noch keine Neuigkeiten in Bezug auf die Gefährdung durch das Virus“. Außerdem beende das Land jene Maßnahmen, denen man den gesamten Erfolg im Moment zu verdanken haben. Die bayerische Landesregierung zeigt sich auch entsetzt. Wenn hier jemand die Richtung vorgibt, dann ist das Bayern! Oder nicht?
Es haben sich an diesem langen Wochenende nach mehreren Zusammenkünften in Hessen wie auch in Niedersachsen viele Menschen infiziert. Merkwürdigerweise haben sich die Infizierten nicht bei den Veranstaltungen, sondern zu Hause angesteckt.
Man sieht, es ist nicht einfach und jeder Fall vielleicht anders. Wer kann und will sagen, was richtig ist? Vielleicht sollte man noch vier lausige Wochen Vorsicht walten lassen. Die Lockerungen sind so massiv – mit der Folge, dass sich manche Menschen nicht mehr so an die Regeln halten. Das müsste sich doch in irgendeine Richtung auswirken.
Kommt die zweite Welle? Experten zeigen sich beunruhigt und befürchten einen erneuten Anstieg der Infektionen. In der Theorie klingen die Verhaltensregeln nach den Corona-Lockerungen klar und eindeutig. Doch werden diese auch in der Praxis umgesetzt?
Die zuvor genannten Beispiele in Hessen und Niedersachsen lassen Zweifel aufkommen, ob wirklich alle Regeln eingehalten wurden. Diesen Schluss muss man leider ziehen. Man weiß auch nicht, ob dies Einzelfälle sind, oder schon Anzeichen einer zweiten Welle. Unabhängig von diesen Ereignissen sollte sich Europa nach Ansicht der WHO auf eine zweite tödliche Welle von Coronainfektionen einstellen. „Es sei nun an der Zeit für Vorbereitungen, nicht für Feierlichkeiten.“ An diesem Beispiel wird eigentlich klar, so richtig weiß niemand was – und das ist nicht gut!
Schulpolitik in der Pflicht
Nach mangelhaftem Krisenmanagement ist jetzt mehr als die Simulation von Unterricht gefordert. Für viele SchülerInnen geht an diesen Tagen der Unterricht wieder los. Eigentlich! Wenn wir ehrlich sind, reden wir über eine traurige Simulation von Schule. Ich habe zwei Enkel von 12 und 15 Jahren und weiß, wie deren Unterricht aussehen soll. Die allermeisten Kinder kommen bis zu den Ferien auf drei Tage Präsenzunterricht, d. h. mit Lehrern und MitschülerInnen. Die groß angekündigte Rückkehr zu einem geregelten Schulbetrieb ist nicht mehr als eine Mogelpackung. Das muss man leider so sagen.
Dieses Schulproblem ist schon in anderen Beiträgen behandelt worden. Um es klar zu sagen, liegt dies nicht nur an den Schulleitern und Lehrern. Wie in jedem Beruf gibt es Engagierte und weniger Engagierte. Wenn aber ein Klassenlehrer sich zehn Wochen nicht bei einem Kind gemeldet hat, wissen wir alle, zu welchem Kreis dieser gehört. Grundsätzlich sind LehrerInnen Ausführende und in diesem Fall Leidtragende einer Bildungspolitik, die sich große Versäumnisse vorwerfen lassen muss.
Nicht abgerufene finanzielle Mittel für eine Digitalisierung der Schulen sind verschlafen oder vernachlässigt worden. Sanierungen in Schulen wurden verschleppt und sanitäre Einrichtungen sind in manchen Schulen eine Katastrophe. Da sind schon die Schulträger und auch die Schulleitung gefragt. Aber das wird nun alles viel besser, so wie vieles andere auch noch viel besser werden muss!
Aber wie heißt es so schön im Volksmund: „Der Fisch stinkt zuerst vom Kopf“. Das Krisenmanagement der Landesregierung hat nicht nur falsch oder schlecht reagiert, es hat erst einmal überhaupt nicht reagiert. So war es zumindest in NRW. Unser umtriebiger Ministerpräsident A. Laschet hat dann doch irgendwie den Laden auf Trab gebracht. Er ist jedenfalls wie ein Herold durch die Lande und Talk-Shows gezogen und hat gesagt, wie toll alles in NRW ist. Alles ist ja nicht schlecht gelaufen, aber die Schul- und auch Kita-Politik war und ist bis heute noch nicht zufriedenstellend gelöst.
Konzepte für die Wiederaufnahme des Unterrichts oder die Notbetreuung in den Kitas ließen viel zu lange auf sich warten. Andere Bereiche des öffentlichen Lebens hatten eine stärkere Lobby als die Familien. Bund und Länder haben sich schließlich aufgerafft und investieren eine halbe Milliarde €, um Kinder aus ärmeren Familien mit Endgeräten für das digitale Lernen zu versorgen.
Erst nachdem Ärzte und Psychologen die Forderung nach der Öffnung von Schulen und Kitas stellten, um das Kindeswohl nicht zu gefährden, nahm die Debatte weiter Fahrt auf. Das Corona-Virus wird nach den Sommerferien nicht weg sein. Aber wie wird der Unterricht dann aussehen? Wird der verpasste Lehrplan, gut drei Monate, nachgeholt? Gibt es da Überlegungen? Was passiert mit den SchülerInnen, die nicht so gut dastehen? Ach, stimmt ja, jedes Kind wird mitgenommen. Eine der dümmsten Phrasen, die Schulen bei Vorstellungen ihrer Systeme immer wieder gebetsmühlenartig vortragen. Der Wunsch mag ja vorhanden sein, aber die Praxis ist eine andere. Es reicht vollkommen aus, wenn die LehrerInnen die Stärken ihrer SchülerInnen besser erkennen und fördern würden.
Jeder hat ein Grundrecht auf Bildung. Das neue Schuljahr muss intensiv vorbereitet werden und es sind kreative Lösungen gefragt. Wie geht der Präsenz- und Videounterricht, was machen die Lehrer über 60 mit Vorerkrankungen, muss nicht vielleicht auch Samstagsunterricht angeboten werden? Antworten auf solche Fragen stehen nicht im Belieben der Bildungspolitik: Unsere Kinder haben einen Anspruch darauf.
Warnung aus der Kläranlage
Das Wesen einer Kläranlage erschließt sich nicht jedem direkt, zumal nach dem vorangegangenen Artikel. Es ist trotzdem ein spannendes und nicht zu unterschätzendes Thema. Die Analyse von Abwasserproben könnte helfen, die Dunkelziffer der Corona-Infektionen zu klären und die Entwicklung der Pandemie vorherzusagen. Dieser letzte Satz ist für mich einer der hoffnungsvollsten Aussagen während der letzten drei Monate. Nicht dass das Corona-Virus verschwunden wäre, nein, es ist ein logischer Ansatz, die Auswirkungen und Folgen einer Pandemie besser bewerten zu können.
Was derzeit jeden Tag in Millionen von Haushalten durch die Toiletten rauscht, ist nicht nur eine Mischung aus Wasser und den menschlichen Ausscheidungen. Auch die Corona-Pandemie hinterlässt ihre Spuren im Abwasser. Hauke Harms vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig sagt: „Wir hoffen, dass wir dort eine Art Frühwarnsystem installieren können, das uns mehr über den Verlauf der Pandemie verrät“.
Erste Indizien dafür, dass das klappen könnte, kamen in Februar aus den Niederlanden. Ein Team um den Mikrobiologen Gertjan Medema hatte die RNA des Erregers im Abwasser von sechs Kläranlagen nachgewiesen – im Fall der Stadt Amersfoort sogar, bevor es dort die ersten bestätigten Corona-Fälle gab.
Mit einer einzelnen Probe lässt sich das
Infektionsgeschehen in einer einzelnen Region
überwachen – ohne Tausende von Personen
einzeln testen zu können.
In Deutschland haben sich dazu Fachleute des UFZ, der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) und der Technischen Universität Dresden zusammengetan. Auch die Kläranlagen von Köln, Leipzig, Dresden und weiteren zwanzig Städten sowie der Wasserverband Eifel-Ruhr sind mit im Boot. „Aus der Menge der Virus-RNA im Abwasser wollen wir abschätzen, wie viele Menschen im Einzugsgebiet der jeweiligen Kläranlage infiziert sind“, erläutert H. Harms. Für eine effektive Seuchenbekämpfung hätte dies gleich mehrere Vorteile. Diese Untersuchung ist nicht nur weniger aufwendig, man kommt auch schneller zu Ergebnissen. Bevor jemand überhaupt hustet, scheidet er schon Virus-RNA aus und es bleibt mehr Zeit für Gegenmaßnahmen. Zudem ließe sich auch das Rätselraten darüber beenden, wie groß die Dunkelziffer der Infizierten ist. Ein sehr wichtiger zusätzlicher Parameter für eine Bewertung einer Pandemie.
Abwasserproben können zum Drogen-Screening, zur Überwachung anderer Viren und auch zur Bestimmung, wie viele Kokain-Konsumenten es gibt, genutzt werden. Aber das neue Corona-Virus stellt die Fahnder vor besondere Herausforderungen. Möglicherweise kommt ein geringerer Teil der ausgeschiedenen Erreger-RNA auch tatsächlich an der Kläranlage an. Dabei sind Erbgut-Mengen im Abwasser ohnehin schon extrem gering.
Es müssen Berechnungsgrundlagen gefunden werden, um aus den ermittelten Virus-Konzentrationen auf die Zahl der Infizierten zu schließen. Auf verschiedenen Wegen versuchen die Forscher, zu realistischen Einschätzungen zu kommen. Abwasseruntersuchungen sind ja nicht neu, sondern Tagesgeschäft. Die Forscher sind sehr optimistisch, dem Corona-Virus im Abwasser auf die Spur zu kommen und sehr bald verwertbare Ergebnisse zu liefern. Schon wieder ein kleines Licht am Horizont.
Wie demonstriert das Ausland?
Im Folgenden ist das Verhalten der Bürger von Frankreich, Belgien, Schweiz, Spanien, Großbritannien, Italien und den USA bei den Demos beschrieben. Festzustellen ist, dass es kaum Proteste in diesen Ländern gegen die Corona-Regeln gegeben hat.
Frankreich Die Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie waren in Frankreich schärfer als in Deutschland. Doch es gibt wenig Kritik am Handeln der Regierung. Ein weiterer Grund: Frankreich hat bisher durch Covid-19 mehr als 27.000 Tote zu beklagen, soviel wie kaum ein anderes EU-Land. Krankenhäuser, vor allem im Elsass, arbeiteten zeitweise am Rande ihrer Kapazitäten. Schwerkranke wurden in Deutschland behandelt, viele Leichenhallen sind noch überfüllt. Präsident E. Macron erwartet dennoch für die kommenden Monate ein Aufflammen der Proteste, etwa der Gelbwesten. Hier und da gingen kleine Gruppen der „Gilets Jaunes“ auf die Straße. Diese Pandemie hat, wie in fast allen anderen Ländern auch, die sozialen Ungleichheiten zu Tage treten lassen. Es wurden Schwächen im öffentlichen Gesundheitswesen deutlich. Er hat Fehler bei der Gesundheitsreform eingeräumt. Den Mitarbeitern im Gesundheitswesen hat er eine Prämie von bis zu 1.500 € versprochen. Marine Le Pen, Chefin des rechtsnationalen Rassemblement National, macht sich zur Fürsprecherin jener, die ihren Job verloren haben. Dies wird nicht nur Le Pen gefallen haben.