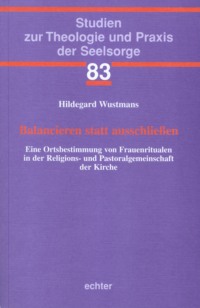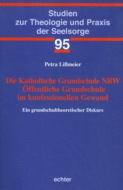Kitabı oku: «Balancieren statt ausschließen», sayfa 8
1.2.2.2 Begründung der Methode
Wissenschaftlerinnen, die Fragestellungen und Problemlagen von Frauen untersuchen, verwenden immer häufiger qualitative Methoden (vgl. Becker-Schmidt/Bidden 1991; Franke/Matthie/Sommer 2002). Gerade Becker-Schmidt und Bidden weisen darauf hin, dass diese Forschungsmethoden nicht einfach nur beliebter sind, sondern dass sie aus forschungspraktischer Sicht in besonderer Weise geeignet sind. „So sind die Lebensverhältnisse von Frauen einmal durch ihre Position in der Geschlechterhierarchie bestimmt, zum andern durch die Klassen- oder Schichtzugehörigkeit. Historisch-geschlechtliche und berufsspezifische Arbeitsteilung verschränken sich, normative Anforderungen, die aus tradierten Weiblichkeitsbildern herrühren, und faktische, die aus dem Eindringen von Frauen in ehemalige Männerdomänen erwachsen, geraten in Widersprüche zueinander. Diskontinuitäten und biographische Brüche gehören zur weiblichen ‚Normalbiographie‘, wenn Phasen des Familienlebens quer zu beruflichen Statuspassagen liegen“ (Becker-Schmidt/Bidden 1991, 25).
Auch die positiven Veränderungen der Lebensmöglichkeiten für Frauen (besserer Zugang zu Bildung und Berufstätigkeit, soziale und geografische Mobilität, Flexibilität in der Gestaltung von Beziehungen u. a.) können nicht darüber hinwegtäuschen, dass parallel oftmals die alten Strukturen weiterbestehen. Auf der einen Seite gibt es eine enorme Angleichung der männlichen und weiblichen Lebenssituation, besonders in den Bereichen von Bildung und Beruf. Auf der anderen Seite wird nach wie vor im Bereich der Reproduktionsarbeit der größte Anteil von Frauen geleistet. „Für die meisten Frauen heißt ‚Individualisierung‘ demnach wohl einerseits Zuwachs an Freiheit aufgrund der Erosion traditionaler Sozialformen und der dadurch entstehenden Pluralisierung der Lebensformen, andererseits sind sie durch den Individualisierungsprozess widersprüchlichen Anforderungen und Doppelstandards ausgesetzt, die sich u. a. in den widerstreitenden Bereichen Familie und Beruf manifestieren“ (Sommer 1998, 31).
Frauen bewegen sich vielfach in strukturellen Zusammenhängen, die von Widersprüchen gekennzeichnet sind. Die Lösungen, welche die Frauen dafür finden, sind individuell und sehr verschieden und hängen u. a. von der biografischen Vorerfahrung, den sozialen Ressourcen und der psychischen Verfassung der Frauen ab. Untersuchungen, die etwas über die Lebenslage der Frauen aussagen wollen, müssen diese Widersprüche und Diskontinuitäten berücksichtigen und analysieren können. Dies kann mithilfe qualitativer Methoden gelingen; denn sie bieten den Raum, frei zu berichten und die konkreten Erfahrungen zu benennen. Dabei entsteht jedoch das methodische Problem, die Exemplarität der einzelnen Frau und ihrer Aussagen zu bewahren und zugleich über das Individuelle hinaus das gesellschaftlich Relevante ihrer Aussagen herauszuarbeiten. Deshalb sind die konstitutiven Bedingungen für Lebenserfahrungen und Lebenswege von Frauen analytisch zu betrachten und zu interpretieren. Relevante Aussagen über Frauenwirklichkeiten werden möglich, wenn die Erfahrungen der Forscherinnen mit den Erfahrungen anderer Frauen in Beziehung gebracht werden. So wird die Vielfalt nicht nur sichtbar, sondern kann auch nachvollzogen werden (vgl. Becker-Schmidt/Bidden 1991, 26). Zur Erreichung dieses Ziels eignen sich vornehmlich qualitative Methoden; denn sie beschreiben komplexe Deutungs- und Wahrnehmungsmuster und decken Strukturzusammenhänge auf, um so eine umfassende Analyse individueller und kollektiver Handlungskontexte zu ermöglichen (vgl. Franke 2002b, 45).
Wenn die Erfahrungen von Frauen im Mittelpunkt des Interesses stehen, dann müssen zwangsläufig auch die gemeinsamen Betroffenheiten, aber auch die Unterschiede zwischen der Forscherin und den befragten Frauen erkannt und thematisiert werden. In der qualitativen Sozialforschung spielt die Selbstreflexion der Forscherin eine besondere Rolle. Denn jede Wissenschaftlerin weiß, dass sie in irgendeiner Form von dem, was sie erforscht, auch betroffen ist. So kann die Fragestellung bewusst oder unbewusst von der eigenen Biografie mitbestimmt sein oder sie spricht lebensgeschichtliche Erfahrungen und Entscheidungen an. Dabei werden in der Regel die eigenen Gefühle, Muster und Wertungen durch die Art der Aussagen der interviewten Frauen aktiviert. Das ist eine Gefahr und eine Chance zugleich. Deswegen ist es unabdingbar, genau auf beide zu schauen: auf die Gesprächspartnerinnen und die Forscherin.
„Es gilt zu sehen, was wir als Frauen gemeinsam haben und worin wir aufgrund von sozialer Situation und Lebensgeschichte differieren. Auf die Gesprächspartnerin schauen heißt, meine Lebensauffassung, meine Erfahrungen und Wertungen in der Schwebe zu halten, während ich die Lebenspraxis der anderen in ihrem sozialen Kontext zu verstehen suche. Auf mich schauen heißt, meiner emotionalen Reaktion und ‚Betroffenheit‘, meiner Verunsicherungen und Wertungen im Forschungsprozeß gewahr werden; es heißt Selbstkonfrontation, Selbstreflexion in Beziehung zu den Lebenspraxen der anderen Frauen; denn meine oft unbewußten Vorannahmen, meine Werte, meine Position sind zu klären und evt. zu revidieren“ (Becker-Schmidt/Bidden 1991, 27). Und so erkennt die Forscherin auch den blinden Fleck ihrer Realitätswahrnehmung. Die Selbstreflexion ist wichtig, aber es ist hervorzuheben, dass es dabei nicht um Selbsterfahrung geht. Vielmehr muss die Selbstreflexion in den Forschungsprozess eingebettet sein, „welcher Materialerhebung und- interpretation, Arbeit an den eigenen Gefühlen und Einstellungen mit dem theoretischen Begreifen weiblicher Subjektivitätskonstitution verbindet“ (ebd., 28).
Diese Aspekte sind in besonderer Weise im Rahmen der vorliegenden Studie von Bedeutung – dies nicht zuletzt deswegen, weil auch Interviews in einem anderen Kulturkreis, mit Frauen in einer gänzlich anderen sozialen Situation und mit außerordentlich verschiedenen Lebensgeschichten stattgefunden haben. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wurden in der vorliegenden Arbeit in Anlehnung an die von Maya Nadig entwickelte ethnopsychoanalytische Methode (Nadig 1986) nicht nur Interviewprotokolle erstellt, sondern zu jedem Interview auch ein kontextuelles Gesprächsprotokoll, in dem die Beobachtungen, Gefühle, Irritationen, Gedanken und Fragen während des Forschungsprozesses festgehalten wurden. Diese Protokolle dienten vor allem dazu, den eigenen Standpunkt in der Forschungsarbeit immer wieder einer Reflexion zu unterziehen.
Das Sample dieser Forschungsarbeit bietet einen Einblick in die Praxis von Frauen innerhalb und außerhalb der katholischen Kirche, die Frauenliturgien und Rituale feiern. Das Anliegen dieser Studie ist es, die oben genannte Fragestellung an einer kleinen Gruppe von Frauen mit Methoden der qualitativen Sozialforschung genauer zu untersuchen und zu verifizieren. Aufgrund der methodischen und inhaltlichen Ausgangsbasis sollte eine gewisse Bandbreite von Frauen erreicht werden, um Hinweise auf bedeutsame Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten zu können.
Vor diesem Hintergrund wurden folgende Aspekte beachtet:
Eine gewisse Streuung in Bezug auf das Alter der befragten Frauen sollte vorhanden sein. Auch war daran gelegen, Frauen mit unterschiedlichen Lebenskonzepten und Lebensformen in den Blick zu nehmen. Darüber hinaus war ein gewisser Grad an Verbundenheit mit der katholischen Kirche (und sei es wegen der erfahrenen Sozialisation) wichtig. Zudem sollten auch Frauen aus einem anderen Land zu Wort kommen, um nicht zuletzt auch den weltkirchlichen Aspekt der Fragestellung zu berücksichtigen und der Tatsache Rechnung zu tragen, dass in vielen Ortskirchen Frauen Wege zu einer lebensnahen und frauenspezifischen Spiritualität und rituellen Praxis suchen. Die Beschränkung auf zwölf Interviews ermöglicht eine inhaltsanalytische Betrachtung und Auswertung und gewährt zudem eine Streuung in Bezug auf Alter, Lebensform, Kultur etc.
Die Auswertung bewegt sich zum einen im Bereich der Einzelfallanalyse, zum anderen in der Stichprobenauswertung und ist somit ein Prozess mit mittlerer Tiefenschärfe. Die genaue Darstellung der einzelnen methodischen Schritte dieser Forschungsarbeit findet sich in Kapitel 2, wo unerhörte Frauenerfahrungen zu Wort kommen sollen.
1 In der Enzyklika Pacem in terris werden folgende Zeichen der Zeit aufgeführt: die Arbeiterfrage, die Frauenbefreiung, die Freiheit der kolonialisierten Völker, die Menschenrechte sowie die Verhinderung von kriegerischen Auseinandersetzungen durch Organisationen wie die Vereinten Nationen (vgl. DH 1963, 3955–3997).
2 Im Rahmen dieser Arbeit bleibt die ebenso entscheidende und lebensprägende Frage des Transgender unberücksichtigt und so verweise ich hier nur auf Literatur zum Thema: Beemyn, Brett/Eliason, Mickey (ed.): Queer Studies. A lesbian, gay, bisexual, and transgender anthology, New York 1996; Degele, Nina: Gender/Queer Studies. Eine Einführung, Paderborn 2008; Fausto-Sterling, Anne: Sexing the body. Gender politics and the construction of sexuality, New York 2006; Ekins, Richard/King, Dave: The transgender phenomenon, London/Thousands Oaks/New Delhi 2006; Lang, Claudia: Intersexualität: Menschen zwischen den Geschlechtern, Frankfurt a. M. 2006; Lindemann, Gesa: Das paradoxe Geschlecht. Transsexualität im Spannungsfeld von Körper, Leib und Gefühl, 2., überarb. u. aktual. Aufl., Wiesbaden 2010.
3 Definition des Europarates von 1998: „Gender mainstreaming besteht in der (Re)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung politischer Prozesse mit dem Ziel, eine geschlechterbezogene Sichtweise in alle politischen Konzepte auf allen Ebenen und in allen Phasen durch alle an politischen Entscheidungen beteiligten Akteure und Akteurinnen einzubeziehen.“
4 Luce Irigaray wurde in den 30er Jahren in Blaton, Belgien, geboren. Bezüglich ihres Geburtsjahres kursieren unterschiedliche Angaben. Die einen sprechen von 1932, andere von 1939 oder 1940. Sie ist ausgebildete Linguistin, Psychologin und Psychoanalytikerin. In den 60er Jahren studierte sie u. a. bei Jacques Lacan. Die Auseinandersetzung mit ihm und der Psychologie hat ihre Forschungen nachhaltig geprägt. Nach Lehrtätigkeit an verschiedenen Orten (Rotterdam, Bologna, Paris) war sie zuletzt Forschungsleiterin für Philosophie am Centre national de la recherche scientifique (CNRS) in Paris. Mit ihren Arbeiten verfolgt sie das Ziel, ein neues Denken und eine neue private und politische Praxis der Geschlechterdifferenz auszuarbeiten. Ihr Hauptthema ist das Verhältnis zwischen männlichem und weiblichem Geschlecht. Ein konstruktiver Umgang zwischen Frauen und Männern ist nach ihrer Meinung erst dann möglich, wenn jedes der Geschlechter sich selbst entdeckt und sich selbst akzeptiert. Dies setzt voraus, dass sich die soziokulturelle Ordnung verändert und ihre ethischen und rechtlichen Fundamente eine Umgestaltung erfahren (vgl. Irigaray, Klappentext zu: Ethik der sexuellen Differenz, Frankfurt a. M. 1991) Ihre theoretische Arbeit wurde immer auch durch politische Arbeit in unterschiedlichen Bündnissen ergänzt. Wichtige Publikationen: Speculum Spiegel. des anderen Geschlechts, Frankfurt a. M. 1980; Das Geschlecht, das nicht eines ist, Berlin 1997; Ethik der sexuellen Differenz, Frankfurt a M 1991; Genealogie der Geschlechter, Freiburg i. Br. 1998; Die Zeit der Differenz, Frankfurt a M 1991; Der Atem der Frauen, Rüsselsheim 1997.
5 Auch das Schreiben der Glaubenskongregation „Über die Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt“ vom 31. Mai 2004 geht von der Geschlechterdifferenz aus. Es weist auf die Zusammenarbeit von Männern und Frauen, bei der ausdrücklichen Betonung der Verschiedenheit der Geschlechter, hin. Allerdings gewinnt man bei der Lektüre den Eindruck, dass zwar die Differenz anerkannt wird, dass dies aber nicht zwingend zu einer kreativen Balance zwischen den Geschlechtern führt. Vgl. hierzu auch den Kommentar von Luisa Muraro: http://christel-goettert-verlag.de/html/kardinal_ratzinger.htm (15. Juli 2005).
6 Wie den Angaben des Statistischen Bundesamtes zu entnehmen ist, wurden 2009 185.817 Ehen in Deutschland geschieden 145 656 minderjährige Kinder waren betroffen „Bei den im Jahr 2009 geschiedenen Ehen wurde der Scheidungsantrag in der Mehrheit der Fälle von der Frau (53,3 %) und in 38,1 % vom Mann gestellt“ (http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/ DE/Presse/pm/2011/01/PD11_028_12631,templateId=renderPrint.psml, 14. Februar 2011).
7 Vgl. Lebenslagen in Deutschland Der 3 Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, http://www.bmas.de/portal/26742/property=pdf/ dritter_armuts_und_reichtumsbericht.pdf, 14. Februar 2011. Er bestätigt, dass soziale Ungleichheit auch in Deutschland kein Randphänomen mehr ist und in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen hat. „Etwa jeder achte Bundesbürger (13 http://digiom.wordpress.com/2009/11/24/es-gibt-keine-authentizitaet-es-sei-denn-wir-entdecken-was-wir-fur- wahrscheinlich-halten-koennen/) war arm“ (http://www.sovd.de/1343.0.html, 14. Februar 2011).
8 Die Konkurrenzsituation wird an dieser Stelle der Arbeit beschrieben und geschildert. Eine nüchterne Analyse der Situation ist geboten, weil vor diesem Hintergrund auch Aussagen der Interviewpartnerinnen einzuordnen sind. Eine Bewertung kann sinnvollerweise erst später, vor dem Hintergrund der gesamten Daten, vorgestellt werden.
9 Informationen über die Bewegung und eine Selbstdarstellung finden sich unter: http://www.womenchurchconvergence.org; vgl. Flatters 1990, 20–27.
10 Starhawk, 1951 als Miriam Samos geboren, studierte Psychologie (MA) Seit 1979 hat sie mehrere Sachbücher zur Göttinnenreligion geschrieben. Für ihr Buch „Truth or Dare. Encounters with Power, Authority and Mystery“ (1987) wurde sie 1988 mit dem Media Alliance Meritorius Achievement Award ausgezeichnet. Von 1993 bis 1996 war sie Dozentin am Institute for Culture and Creation Spirituality at Holy Names College in Oakland Sie hat wesentlich zur Anthologie „The Pagan Book of Living and Dying“ (1997) beigetragen und hat 1998 zusammen mit Anne Hill und Diane Baker „Circle Round. Raising Children in the Goddess Tradition“ veröffentlicht. Sie ist Ökofeministin und Friedensaktivistin und eine gefragte Rednerin für Vorträge und Workshops Darüber hinaus hat sie sich an Filmproduktionen beteiligt (wissenschaftliche Beraterin und Koautorin) und schreibt Romane Sie lebt teilweise in San Francisco, wo sie zusammen mit dem Reclaiming-Kollektiv Kurse und öffentliche Rituale in der Tradition der Göttin-Religion anbietet, und teilweise in Sonoma County, wo sie eine Ranch betreibt. 1993 erschien ihr erster Roman „Das fünfte Geheimnis“, für den sie 1994 den Lambda Award für homosexuelle Science-Fiction erhielt 1997 erschien ihr zweiter Roman („Walking to Mercury“); vgl. http://www.feministische-sf.de/einzelne_autorinnen/fsf_starhawk.html (27. Januar 2005).
11 Naomi Goldenberg studierte Psychologie und ist Professorin in Ottawa. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Psychologie, Religionswissenschaft und Frauenforschung. Sie ist Gründerin des Frauenstudienprogrammsan der Universität in Ottawa und war in den Jahren 1998–1992 die Leiterin; vgl. http://web5.uottawa.ca/medi/mediaroomm/award_recipients-f.php?aid=21&rid091 (27. Januar 2005).
12 Von dieser Fremdheit ist auch in einem Interview explizit die Rede. Martina Franz sagt dazu: „Und diese Körpersprache, die war mir anfangs sehr fremd. Ich hab mich da auch, ja, nicht sehr schwergetan, aber hab mich überwinden müssen. Mh. Aber als ich es einmal gemacht habe, habe ich gesagt, das ist einfach, äh, doch die Bestätigung dessen, was ich so in mir spüre, was ich fühle. Das trage ich jetzt auch nach außen. Und durch dieses Nachaußentragen merke ich wieder, wie befreiend das sein kann oder wie gut es mir tut“ (Martina Franz). An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass Unterstreichungen jene Äußerungen markieren, die ich als Interviewerin gemacht habe.
13 Im Diskurs über Frauenliturgien fällt auf, dass Liturgie und Ritual fast immer in einem Atemzug genannt werden. Dies ist im liturgiewissenschaftlichen Diskurs ganz anders. Dort wird das Wort „Ritual“ so gut wie nicht verwendet. „Ritus“/„Riten“ werden in der Titulatur der reformierten liturgischen Bücher vermieden und meist durch „Die Feier“ ersetzt. „Denn das im 17. Jh. aus dem Lateinischen entlehnte Wort ‚Ritus‘ erfasst von seiner etymologischen Grundbedeutung her vornehmlich die äußere Seite der Liturgie, den Aspekt der Wiederholbarkeit ihrer äußeren Formen und Vollzüge, das Gewohnte, Vertraute und Traditionelle, das liturgischen Feiern anhaftet, das Zeremonielle, […] das bis ins einzelne geregelt werden kann und geregelt worden ist. All das gehört zwar auch zur Liturgie bzw. zum Gottesdienst der Kirche, aber damit ist das Wesen der Liturgie und ihre Bedeutung für das kirchliche Leben noch keineswegs erfaßt. Dieses wird im ersten Kapitel der Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium vielmehr als ‚Werk der Erlösung der Menschen und der vollendeten Verherrlichung Gottes‘ (SC 5) bzw. als ‚Feier des Pascha-Mysteriums‘ (SC 6) qualifiziert“ (Hahne 1999, 81 f.).
14 Eine genaue Vorstellung erfolgt in Kapitel 2.1.
15 Für diese Aussage kann das Handbuch Praktische Theologie als Beleg angeführt werden. In beiden Bänden gibt es nur einen Artikel, der sich mit der Bedeutung von Orten für die Praktische Theologie auseinandersetzt. Vgl. Klein 1999, 60–75. Und auch in der Festschrift für Ottmar Fuchs zum 60. Geburtstag (Nauer/Bucher/Weber 2005) findet sich nur ein Artikel von 67, der im Titel explizit auf einen Ort verweist: Rainer Krockauer, Praktische Theologie am Ort institutionalisierter Diakonie, 142–150.
16 Der Sinn einer Aussage ist der Gedanke, den sie repräsentiert. Die Bedeutung dagegen ist die Wahrheit oder Falschheit dieses Gedankens. Mit der Sinnebene alleine ist man nicht wahrheitsfähig; vgl. Frege 1994, ders. 1971.
2. Unerhörte Frauenerfahrung. Eine qualitativ-empirische Untersuchung weiblicher Ritualpraktiken
Die Einleitung hat den Rahmen der Arbeit abgesteckt und vor allem darauf hingewiesen, dass der Fokus auf den Veränderungen in den modernen Frauenbiografien und den daraus resultierenden Konsequenzen für Gesellschaft und Kirche liegt. Durch diese Veränderungen sieht sich gerade die Kirche vor ein drängendes Problem gestellt, weil sie ihre Positionen zu den Frauen und deren Erwartungen an Teilhabe und Teilnahme überdenken muss – dies nicht zuletzt auch, um an einer notwendigen Balance zwischen Kirche und Frauen zu arbeiten. Aber die Frage der Balance stellt sich nicht nur für die Kirche, sondern auch für die Frauen. Was büßt die Kirche ein, wenn sie die Frauen verliert? Was entgeht den Frauen, wenn sie sich nicht mehr auf die Kirche beziehen und einwirken? Um diese Fragen beantworten zu können, ist es zunächst erforderlich, auf Frauen zu hören, ihre Meinung und Position zu erfahren. Die folgende Beschreibung der methodischen Einzelschritte verdeutlicht, wie diese Fragestellungen bearbeitet wurden.
2.1 Die angewandte Methodik
Zunächst werden die Ausgangssituationen beschrieben und Informationen zur Untersuchungsgruppe sowie zu der Auswahl und auch zur Kontaktaufnahme mit den Interviewpartnerinnen gegeben. Dann folgen Angaben zu dem offenen Gesprächsleitfaden und der Durchführung der Interviews. Dieser Punkt wird durch die Darstellung des Auswertungsverfahrens, das sich sowohl auf die soziologische wie auf die philosophisch-sprachliche Ebene bezieht, ergänzt. Anschließend werden in Kurzporträts die Interviewpartnerinnen vorgestellt und es erfolgt zum Abschluss dieses Kapitels ein analytischer Schnitt durch die Interviews, bei dem erste Ergebnisse festgehalten werden.