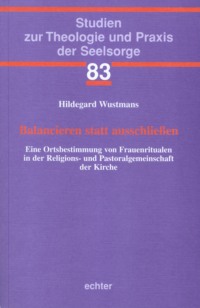Kitabı oku: «Balancieren statt ausschließen», sayfa 7
1.2.1.3 Rituale – wirkmächtige Zeichen von Gemeinschaften
Rituale gliedern, ordnen und bestimmen den Alltag von Menschen. Sie begleiten Menschen vom ersten Tag des Lebens bis zu ihrem letzten. Sie sind überall präsent. Wir finden sie in allgemeinen Höflichkeitsformen, bei Geburtstagen, politischen Inszenierungen wie Parteitagen und Gewerkschaftskongressen, im Sport und in liturgischen Zeremonien. Rituale strukturieren die feierlichen und festlichen Anlässe im Leben von Menschen, sie begleiten durch Krisen und Katastrophen. Es gibt jahreszeitlich bedingte Rituale, Widerstandsrituale, Liebesrituale und religiöse Rituale. Rituale sind allgegenwärtig. Inzwischen ist es auch so, dass Rituale wieder ein Thema sind. Ein Blick auf Buchtitel mag dies belegen. Es gibt Rituale für die Seele (Stutz 42001), Rituale für das Leben im Verband (Bundesvorstand der KLJB 2003), Rituale im Management (Echter 2003), Rituale für den Alltag und die Therapie (Welter-Enderlin/Hildenbrand 2002), die spirituellen Rituale der Frauen (Walker 1998), Rituale fürs Alleinsein (Iding 2003) und kraftvolle Rituale (Stutz 2001). Vom Zauber der Rituale (Zirfas 2004) ist ebenso zu lesen wie von ihrer Hilfe auf einem Weg zu mehr Lebensfreude (Grün 1997).
Von der Ritualkritik jüngster Epochen ist gegenwärtig kaum mehr etwas zu spüren. Damals wurde im Namen der Authentizität nicht das Gewohnte und Bewährte gesucht, sondern für jede Situation wurden neue, entsprechende, aktuelle Entwürfe und Ausdrucksformen erfunden und postuliert. Gewohntes und Wiederkehrendes standen grundsätzlich unter Ritualismusverdacht und wurden als hohle Zeremonie empfunden (vgl. Haunerland 1999, 282). Heute wird hingegen nahezu überall das Bewährte, Wiederholte von Menschen gesucht und mit gutem Recht ist von der Wiederkehr der Rituale zu sprechen (vgl. Kranemann/Fuchs/Hake 2004). Inzwischen werden Rituale als performative kulturelle Welten begriffen (vgl. Wulf/Zirfas 2004, 29–32). Rituale sind unverzichtbar für die Entstehung, Ausübung und Umgestaltung von Religion und Politik, Gesellschaft und Institutionen, Erziehung und Bildung. Mithilfe von Ritualen werden die Welt, in der Menschen leben, und die Erfahrungen, die Menschen machen, geordnet und interpretiert. Dabei erzeugen Rituale eine Verbindung und einen Zusammenhang zwischen Vergangenem, Gegenwärtigem und Zukünftigem. Rituale stehen für Kontinuität und Verlässlichkeit und auch für Veränderung und Wandel. Durch ihre lebensweltlichen Bezüge sind Rituale gerade in Zeiten der Unsicherheit und der zunehmenden Komplexität ein Ort, der Sicherheit und Orientierung bietet.
Aber ein Blick auf die „Ritualorte“ zeigt deutlich, dass eine Instanz mit einer eigenen Ritualtradition und- praxis von diesem Boom nicht profitiert – es ist die Kirche. Sie hat in den letzten Jahrzehnten ihr Monopol auf Rituale eingebüßt. Ihre Rituale werden oftmals nicht als bewahrend, sondern als starr erlebt. Dies zeigt nicht zuletzt auch der wachsende Markt an kirchenfernen Riten, ob es nun Bestattungen mit einem freien Trauerredner/einer freien Trauerrednerin sind oder alternative Hochzeiten. Eines scheinen die Kunden in besonderer Weise bei den freien Ritualanbietern zu schätzen: dass man sich auf ihre Bedürfnisse ganz und gar einstellt (vgl. Fincke 2004).
Mit dieser Kundenorientierung wird z. B. im Internet oder auch auf Hochzeitsmessen geworben. Freie Redner/-innen bieten rituelle Begleitung bei Lebensabschnitten, wie Geburt, Hochzeit, Tod und Trauer, an, aber ebenso zu Anlässen wie Trennung und Scheidung. Indem sie auf die Wünsche der Kunden/Kundinnen (gegen Bezahlung natürlich) eingehen, kann man ihre Haltung als „religiös-kundenorientiert“ bezeichnen (vgl. Fincke 2004, 260; Karmer Abebe 2000, 35–64). Verständlich, denn sie sind institutionell nicht eingebunden. So dürfen die Kirchen in Deutschland z. B. Trauungen nur dann vornehmen, wenn die Paare vorher beim Standesamt eine zivilrechtliche Ehe geschlossen haben, doch solche Vorgaben gibt es auf dem „freien Markt“ nicht. Im Internet schreibt eine Anbieterin: „Ich bin keine Standesbeamtin und kann Ihnen damit den Gang auf das Rathaus nicht ersparen. Es ist allerdings für mich nicht relevant, ob Sie vor oder nach der Trauzeremonie zum Standesamt gehen. Vielleicht wollen Sie auch ohne rechtliche Absegnung Ihre Lebenspartnerschaft bestätigen. Auch das ist bei mir möglich“ (zit. n. Fincke 2004, 260).
Diese Entwicklungen und Gelegenheiten zeigen, dass es auf der einen Seite ein Bedürfnis nach Ritualen gibt und dass auf der anderen Seite sich die Wahrnehmung und Wirklichkeit der christlichen Religion in der Gesellschaft massiv verändert (haben). So haben z. B. die Umbrüche in der Bestattungskultur auch mit einem Rückgang an christlichem Auferstehungsglauben zu tun. Hier gehen also Entwicklungen Hand in Hand, die die Kirchen in ihrer Verkündigungspraxis massiv herausfordern.
Aus dem Vorausgegangenen wurde deutlich, wie vielfältig, bunt und herausfordernd die Entwicklungen im Zusammenhang mit Ritualen sind. Aber in der Vielfalt zeigt sich auch, wie wenig einheitlich die Rede vom Ritual ist. Da sind zum einen solche Rituale, die den gleichbleibenden Ablauf bestimmter Situationen festlegen, wie das persönliche Morgenritual oder bestimmte Abläufe im Zusammenleben einer Familie oder von Paaren. In diesen Fällen geht es um individuelle und kollektive Gewohnheiten. Es gibt daneben Formen der Zusammenkunft, die vorstrukturiert und immer gleich sind, wie z. B. die Jahreshauptversammlung eines Vereins oder die Eröffnung der Kirmes in einem Dorf. Diese Abläufe haben ihre Wurzeln zum Teil im Brauchtum oder wurden bewusst entwickelt. Davon unterscheiden sich dann wiederum Rituale in großen Gruppen von Menschen, wie z. B. bei Sportwettkämpfen (vgl. Bromberger 1998).
Den Alltag übersteigende Inszenierungen leiten über in den Bereich des religiösen Rituals. „Geprägte, standardisierte und wiederholbare Handlungssequenzen bilden die religiöse Zeremonie; in ihr bringt einerseits die religiöse Gemeinschaft ihre Identität zum Ausdruck und stärkt diese zugleich; andererseits wird hier die Bezogenheit auf das Göttliche bzw. der Kontakt zu einem personalen Gott vollzogen. Solche religiösen Riten haben vielfach soziale und biografische Bedeutung. Auf jeden Fall transzendieren sie den Alltag, haben häufig einen kultischen Akzent und werden gelegentlich magisch verstanden“ (Haunerland 1999, 283).
In welchem Kontext man auch immer ein Ritual vollzieht, es ist ihm eigen, dass es eine gewisse Wiederholbarkeit hat (vgl. Haunerland 1999, 283). Rituale haben standardisierte Elemente und Verläufe. Diese Elemente und Verläufe stehen aber nicht nur für Zeichen der Wiederholbarkeit, sie haben auch einen Wiedererkennungswert. Hat eine Person schon einmal an einem solchen Ritual teilgenommen, dann kann sie dieses in einen größeren Rahmen einordnen und sich zugleich in diesem Ritual verorten. Etwas Weiteres kommt an dieser Stelle noch hinzu: Sofern es sich nicht um individuelle Rituale handelt, benötigen sie die soziale Akzeptanz. „Auch die jeweils anderen müssen die verwendete Riten- bzw. Symbolsprache als solche erkennen können und in ihrer Sinnhaftigkeit akzeptieren“ (ebd., 283). Ist dies der Fall, dann wirkt das Ritual außerdem noch identitätsstiftend und gemeinschaftsstärkend.
Rituelles Handeln hat einen formalen Charakter. „Es folgt höchst strukturierten, standardisierten Sequenzen und wird oft an gewissen Plätzen und zu bestimmten Zeiten, die ihrerseits mit einer speziellen symbolischen Bedeutung gefüllt sind, durchgeführt. Rituelles Handeln ist repetitiv und aus diesem Grund oft redundant; diese Faktoren sind aber wichtige Mittel zur Kanalisierung von Emotion, zur Leitung von Erkenntnis und zur Organisation sozialer Gruppen“ (Kertzer 1998, 373). Rituale helfen, der Welt einen Sinn zu geben, indem sie Vergangenes mit der Gegenwart und die Gegenwart mit der Zukunft verbinden. Dies hilft, Probleme in den Griff zu bekommen. Vor diesem Hintergrund können folgende Dimensionen in Bezug auf Rituale festgehalten werden – „Rituale sind:
1. kommunitär, indem sie Gemeinschaften hervorbringen, restituieren und gestalten und dadurch ihren emotionalen und symbolischen Zusammenhalt gewährleisten; 2. stabilisatorisch, indem sie Ordnung, Aufgabenverteilung und Planung gewährleisten, insofern aber auch Einordnung, Anpassung und Unterdrückung möglich machen; 3. identifikatorisch-transformatisch, indem sie die Identität der bisherigen Mitglieder re- oder neu definieren oder ein neues Mitglied aufnehmen; 4. gedächtnisstiftend, indem sie den Teilnehmern eine zeitliche Kohärenz sicherstellen und so kontinuitätsstiftend und zukunftsorientierend wirken; 5. kurativ-philosophisch, indem sie infolge schmerzhafter Erfahrungen Heilungsprozesse und Krisenbewältigungsmechanismen in Gang setzen bzw. Fragen im Zusammenhang von Leben und Tod zu beantworten suchen; 6. transzendentmagisch, indem sie eine Kommunikation mit dem Anderen, dem „Heiligen“ gewährleisten, und 7. differenzbearbeitend, indem sie zunächst Brüche, Schwellen und Rahmen im Sozialen generieren und markieren, um sie dann gegebenenfalls aufzuheben“ (Wulf/Zirfas 2004, 18).
Rituale lassen Einzelne mit den anderen der Gesellschaft in Verbindung treten und soziale und natürliche Wirklichkeit überschreiten. Im Fußballspiel sind die Fans einer Mannschaft alle gleich. Im Gottesdienst sind die Gläubigen unabhängig von ihrem sozialen Status in der Gesellschaft eine feiernde Gemeinschaft, sie sind versammeltes Volk Gottes. Im Ritual ist temporär diese Überschreitung gegeben, welche die normale Ordnung der Dinge um der eigenen Lebendigkeit willen auch braucht. Neben den vielen Orten, an denen Rituale präsent sind, kommt ihnen doch vor allem (in den individuellen Biografien wie auch im Zusammenleben von Gesellschaften) eine besondere Bedeutung in Situationen des Umbruchs zu (vgl. Haunerland 1999, 284). Dies sind vor allem Situationen und Begebenheiten, wo ein Status quo als Gesamt von Regeln, Erwartungen, Verhaltenszuschreibungen an seine Grenzen stößt, Akzeptanz verliert und die Zeichen der Zeit nicht begreift. Es beginnt dann unweigerlich eine neue Phase mit neuen Erwartungen und Verhaltenszuschreibungen (z. B. lebensgeschichtliche Brüche, Übergang von Jugend- zum Erwachsenenalter, Geburt, Tod, Scheitern von Beziehungen, Übernahme einer [neuen] Berufsrolle) (vgl. van Gennep 1999, 15).
Im Ritual wird der Zwischenraum zwischen zwei Phasen begehbar. In dieser Schwellenphase zwischen Verlassen des alten und Angliederung an den neuen Zustand wird das Andere der alltäglichen Ordnung als „Anti-Struktur“ begehbar (vgl. Turner und die Ausführungen in Kapitel 4.3). In dieser Phase tritt man in eine neue Gemeinschaft ein. Diese neue Gemeinschaft bietet eine hohe Intensität an Begegnung mit sich selbst wie auch mit den anderen Mitgliedern der Gruppe. Wie die Begehung des Rituals vorbereitende Schritte der Grenzüberschreitung voraussetzt, so wird nach dem Ritual eine erneute Grenzüberschreitung notwendig, deren Inszenierung eine Veränderung der alltäglichen Wirklichkeit (durch die Erfahrung des Rituals) bewirkt und darstellt (z. B. der Segen am Ende einer Liturgie) (vgl. van Gennep 1999, 21).
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass das, was an Ritualen produziert wird, sich von dem absetzt, was vorher repräsentiert war, und sie verweisen auf etwas, was zukünftig bedeutsam wird. Was jetzt ist, wird in den Begriffen, die man von ihm bildet, auf mögliche Veränderungen hin überschritten. Nicht zuletzt deswegen geht es auch darum, Rituale als Zeichen zu verstehen. Denn Erfahrungen und Handlungen werden von Zeichen repräsentiert, die Menschen aufgrund der Beziehungen zur Welt, in der sie leben, ausbilden. Insofern ist jedes Ritual ein Zeichen. Zeichen sind von Erfahrungen angereichert oder sie sind keine Zeichen. In Bezug auf Rituale bedeutet dies, dass sie an dem Erfahrungsgehalt, den sie repräsentieren, gemessen werden können. Zeichen zu errichten und Rituale zu entwickeln, bedeutet Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen (vgl. Mersch 1998; Peirce 1986; Sander 1996). Insofern verkörpern Rituale auch eine Macht. Sie bringen Handlungen, Situationen auf einen Punkt. Ihre Basis sind Zeichen und auf diesem Fundament können wahre, heilende Aussagen und Erfahrungen gemacht werden. Die Auseinandersetzung mit Ritualen, verstanden als Zeichen, besitzt einen großen Wert, denn sie ermöglicht es, Situationen zu überschreiten und Realität neu zu gestalten.
Rituale führen Zeichen in die Situation von Menschen ein, die sie verändern. In den Überzeugungen und Ritualen des Glaubens werden die Erfahrungen von Menschen repräsentiert. Deswegen sind sie Vergegenwärtigungen des Glaubens angesichts der Zeichen der Zeit, zumindest dann, wenn sie nicht hohles Ritual ohne spirituellen Rang sein wollen. Glauben im Ritual zu vergegenwärtigen bedeutet, der Zerstörung von Leben zu widerstehen. Die Liturgien, die Frauen feiern, und die Rituale, die sie begehen, sind ihre Antwort und Ausdruck ihres Umgangs mit der veränderten Situation. Für sie ist es nicht mehr so, wie es einmal war. Im Kontext ihrer Neuorientierung und Standortvergewisserung entwickeln sie das Bedürfnis nach neuen Liturgien und Ritualen und setzen es in die Tat um.
In den vorausgegangenen Abschnitten wurde beschrieben, was Rituale kennzeichnet und auszeichnet. Vor diesem Hintergrund muss die Forschungsmethode dem Untersuchungsgegenstand angemessen sein. Weil Frauen auf die Veränderungen in ihren Biografien und im gesellschaftlichen Bereich mit Ritualen antworten, wurde eine empirische Methode gewählt, um diesen Prozess genauer verstehen und analysieren zu können. Es sollten Frauen zu Wort kommen, die eine Praxis entwickeln, die eine besondere Herausforderung für die Kirche ist.
1.2.2 Methodische Konsequenzen
1.2.2.1 Zur Relevanz qualitativ-empirischer Forschung im Bereich aktueller ekklesiologischer Entwicklungen
Empirisches Arbeiten in der Theologie ist darauf gerichtet, die tatsächlichen Begebenheiten zu beschreiben und zu erklären (vgl. van der Ven 1990, 90). Die Beschreibung wird dabei von dem her bestimmt, wie sich die Realität zeigt bzw. wie sie von Menschen wahrgenommen wird. Die Erklärung basiert dann auf genau dieser Beschreibung. So kann die Gefahr gebannt werden, an Orten präsent zu sein, die keine(r) mehr aufsucht, und Antworten auf Fragen zu geben, die keine(r) mehr stellt. Empirisches Arbeiten in der Theologie steht zugleich dafür, die Wahrnehmungen des Volkes Gottes ernst zu nehmen und nach dem consensus fidelium zu suchen (vgl. Finucane 1996; Yong-Min 2003). Sie achtet auf die individuelle gelebte religiöse Praxis der Menschen, hört auf ihre Fragen und Zweifel, nimmt ihre Formen des gelebten Glaubens wahr und reflektiert sie (vgl. Klein 2005, 36–38). Nur wenn die Theologie auf die Stimmen und Fragen des Volkes Gottes hört, wird sie in der Lage sein, angemessene Wörter und signifikante Symbole für eine Verkündigung der Frohen Botschaft zu finden, die in die konkreten Erwartungen und Bedürfnisse der Menschen auch tatsächlich hineinwirkt (vgl. van der Ven 1990, 28; ders. 2002).
Bei empirischen Arbeiten ist zwingend zu bedenken, dass die Entscheidung für eine bestimmte Methode, quantitativ oder qualitativ, den möglichen Erkenntnisgewinn wesentlich bestimmt. Mehr noch, die Erkenntnisse sind zudem von der Subjektivität der Forschenden geprägt, von ihren eigenen Erfahrungen, Standpunkten und kulturellen Hintergründen. „Auch die empirischen Wissenschaften beschreiben die Wirklichkeit nicht einfach ‚so, wie sie ist‘. Jede Beschreibung und Theorie beinhaltet subjekt- und kulturabhängige Deutungen“ (Klein 2005, 25). Vor diesem Hintergrund ergibt sich auch die Notwendigkeit der empirischen Wissenschaften, nicht nur Daten und Tatsachen darzustellen, sondern auch den Prozess der Datenerfassung darzulegen und zu reflektieren.
Im Nachfolgenden sollen Möglichkeiten und Grenzen quantitativer und qualitativer Methoden vorgestellt werden, um die Basis für die Methodenwahl der vorliegenden Arbeit vorzubereiten.
In den Sozialwissenschaften wurden quantitative Studien vorwiegend bis in die Mitte der 60er Jahre durchgeführt und die Qualität der Forschungen wurde vor allem daran gemessen, wie gut eine Übertragung in naturwissenschaftliche Modelle gelang (vgl. Hopf 1993). „Quantitative Studien unterscheiden sich von qualitativen in erster Linie durch ihre wissenschaftstheoretischen Grundpositionen, den Status von Hypothesen und Theorien sowie das Methodenverständnis“ (Atteslander 102003, 83). Quantitative Methoden sehen soziale Realität als objektiv gegeben an und mithilfe kontrollierter Methoden ist diese auch erfassbar. „Empirische Forschung soll theoriegeleitet Daten über soziale Realität sammeln, wobei diese Daten den Kriterien der Reliabilität, der Validität sowie der Repräsentativität und der intersubjektiven Überprüfbarkeit zu genügen haben und in erster Linie der Prüfung der vorangestellten Theorien und Hypothesen dienen. Forscher haben den Status unabhängiger wissenschaftlicher Beobachter, die die soziale Realität von außen und möglichst objektiv erfassen sollen“ (ebd.).
Seit den 70er Jahren wuchs in den Sozialwissenschaften die Kritik an quantitativen Methoden, und zwar wegen der starken Bindung an Standards und des distanzierten, analytischen Blicks. In diesem Kontext entwickelte sich das Interesse, Lebenswelten von innen, aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben, um so zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit zu gelangen (vgl. Flick/von Kardorff/Steinke 22003, 14). Dabei wurden von Lammek (vgl. Lammek 1988, 21–30) sechs Prinzipien entwickelt, die wie folgt zusammengefasst werden können:
„1) Offenheit gegenüber der Untersuchungsperson, Untersuchungssituation und den Methoden. Der Verzicht auf die Hypothesenformulierung ex ante ist ein konkretes Beispiel.
2) Kommunikation als konstituierender Bestandteil des Forschungsprozesses. Die Forscher und Daten werden nicht als unabhängig voneinander gesehen, vielmehr interagieren sie miteinander.
3) Prozesscharakter. Die Verlaufprozesse in der sozialen Realität stehen im Mittelpunkt der qualitativen Forschung.
4) Reflexivität. Hierzu gehören Fragen der Sinnkonstitution und des Sinnverständnisses.
5) Explizitheit der Unterschritte und Analyseregeln.
6) Flexibilität der Forschungsschritte“ (Lissmann 2001, 54).
Qualitative Methoden räumen der Subjektivität der Befragten einen großen Freiraum ein. Dies wird z. B. bei Methoden wie den biografischen oder narrativen Interviews deutlich (Schütze 1979, 1983). Darüber hinaus verzichten qualitative Methoden auf eine Hypothesenbildung zu Beginn des Forschungsprozesses. So ist es eher möglich, neue Hypothesen im Forschungsprozess selbst zu entwickeln (vgl. Franke 2002b, 43). In der Übersicht stehen sich die beiden Forschungsansätze mit folgenden Charakteristika gegenüber (Bucher 1994, 23):

Im Rahmen der qualitativen Sozialforschung gibt es nun wiederum eine Vielzahl von Methoden. Nach Kardroff stehen sie in folgender Weise miteinander in Verbindung: „Qualitative Forschung hat ihren Ausgangspunkt im Versuch eines vorrangig deutenden und sinnverstehenden Zugangs zu der interaktiv hergestellt und in sprachlichen wie nichtsprachlichen Symbolen repräsentiert gedachten sozialen Wirklichkeit. Sie bemüht sich dabei, ein möglichst detailliertes und vollständiges Bild der zu erschließenden Wirklichkeitsausschnitte zu liefern. Dabei vermeidet sie so weit wie möglich, bereits durch rein methodische Vorentscheidungen den Bereich möglicher Erfahrungen einzuschränken. […] Die bewußte Wahrnehmung und Einbeziehung des Forschers und der Kommunikation mit den ‚Beforschten‘ als konstitutives Element des Erkenntnisprozesses ist eine zusätzliche, allen qualitativen Ansätzen gemeinsame Eigenschaft“ (von Kardorff 1991, 4).
Qualitative Methoden verfolgen das Ziel, komplexe Deutungs- und Wahrnehmungsmuster zu beschreiben und Strukturzusammenhänge freizulegen, „um eine umfassende Analyse individueller und kollektiver Handlungskontexte zu ermöglichen und damit Mechanismen der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit herauszuarbeiten“ (Franke 2002b, 45). Die „dichte Beschreibung“ (Geertz 1987) kann gerade im Zusammenhang mit Fragen nach Religion und Spiritualität eine wichtige und produktive Vorgehensweise sein.
Praktische Theologie, die um ihre Sprachfähigkeit in Bezug auf aktuelle und komplexe, religiöse und theologische Entwicklungen ringt, sollte dabei auf jeden Fall auch auf die methodischen Entwicklungen in den Sozialwissenschaften und der Psychologie zurückgreifen und deren Anwendung im eigenen Fach vorantreiben. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil Praktische Theologie sich als Handlungswissenschaft versteht, deren Gegenstand die Kirche und das Volk Gottes sind (vgl. Mette 1979; Haslinger 1999, 102–121). Kennzeichnend für den handlungswissenschaftlichen Ansatz sind die folgenden Aspekte:
• „Das induktive Vorgehen, das nicht von der kirchlichen Dogmatik, sondern von den Erfahrungen der Menschen ausgeht.
• Der Einsatz von empirischen Methoden. […]
• Die interdisziplinäre Orientierung: Nur durch eine enge Zusammenarbeit mit anderen Handlungs- und Humanwissenschaften lassen sich die der Praktischen Theologie gestellten Probleme angemessen angehen.
• Die Vermittlung von Orientierungshilfen für gegenwärtiges und zukünftiges christliches, kirchliches und pastorales Handeln.
• Die Überwindung des ‚Subjekt-Objekt-Schemas‘“ (Klein 2005, 45).
Praktische Theologie hat nicht nur auf das Evangelium und die Tradition zu hören, sondern auch auf das Volk Gottes, auf das, was Männer und Frauen in der Welt von heute bewegt, wie sich die Männer und Frauen in ihrem Leben der Trauer und Angst, der Freude und Hoffnung stellen, nach ihnen fragen, um sie ringen und ihnen Ausdruck verleihen. Zur Beantwortung dieser Fragen kann empirische Forschung einen wichtigen Beitrag leisten, auf den die Theologie nicht verzichten sollte (vgl. Bucher 1994, 13).
Zur näheren Beschreibung des prekären Verhältnisses von Frauen und Kirche liegt es nahe, einen qualitativen Ansatz zu wählen, um die Erfahrungen der Frauen zur Entwicklung einer pastoralen Antwort auf diese Situation nicht nur zurate zu ziehen, sondern zum Ausgangspunkt zu machen. In ihren Frauenliturgien und Ritualgruppen zeigt sich eine Praxis, welche die Kirche und ihre Pastoral in besonderer Weise herausfordert. Es handelt sich bei ihnen um Orte, die die gängige pastorale und liturgische Praxis infrage stellen und auf ihre Defizite in der Darstellung in der Welt von heute hinweisen. Im Rahmen einer empirischen Studie wird es möglich, genauer auf diese Punkte einzugehen, den Prozess nachzuzeichnen und zu verstehen sowie vor diesem Hintergrund Perspektiven für eine neuerliche Annäherung von Frauen und Kirche zu entwickeln.