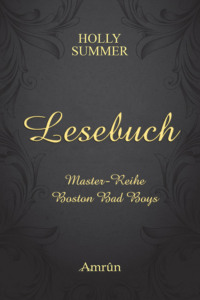Kitabı oku: «Das Holly Summer Lesebuch», sayfa 3

»Hi, Sunday, lange nicht gesehen. Was trinkst du?«, fragt mich Cole, der Barkeeper in Jimmy’s Bar, während er über die Theke wischt. Cole ist ein guter Freund von Elijah und wir kennen uns aus meiner Zeit, als ich auch im Service gearbeitet habe. Elijah ist in der Garage mit seinem Fahrrad beschäftigt und später steht noch ein Gespräch mit seinem Teilhaber an, mit dem es gestern Nacht schon Ärger gab. Elijah will ihn ausbezahlen, aber die Verhandlungen scheinen sich schwierig zu gestalten. Also habe ich mich allein in diese Bar geschleppt, um einfach mal raus zu kommen.
»Einen Zombie«, bestelle ich gelangweilt den Drink. Cole schaut mich kritisch an, da ich ansonsten höchstens mal einen Sex on the Beach oder eine Pina Colada trinke, leichte Drinks mit wenig Alkohol. Er zieht seine gepiercte Augenbraue hoch und legt den Kopf schräg.
»Alles in Ordnung mit dir? Bist du sicher?«
»Vollkommen.«
»Scheißtag gehabt?«, fragt er, während er Eiswürfel in ein Glas füllt.
»Ich weiß nicht, was du unter einem Scheißtag verstehst. Aber wenn es reicht, dass ich von meinem Chef unter Druck gesetzt wurde und er mir mehr oder weniger die Kündigung unter die Nase gehalten hat, dann würde ich sagen, ja, es war ein Scheißtag. Außerdem habe ich einen Jogger mit dem Fahrrad über den Haufen gefahren.«
»Okay, ich denke, da hast du dir einen Zombie verdient. Hier wird es auch in nächster Zeit einige Veränderungen geben.«
»Wie meinst du das?«
»Der Club wird verkauft. Es gibt drei Interessenten, die ihn übernehmen wollen. Hat Elijah nichts davon erzählt?«
Ich schüttle den Kopf. »Nein, hat er nicht. Er hat im Moment andere Sorgen. Sein Partner macht ihm Probleme.«
»Ich dachte, es hat sich schon rumgesprochen. Ich hatte ja gehofft, Elijah würde diesen Club kaufen, gerade weil er so einige Schwierigkeiten mit seinem Teilhaber hat.«
»Elijah wird versuchen, ihn auszubezahlen.«
Cole nickt. »Kann ich verstehen. Das Black Sugar ist der In-Club. Hat eine super Lage und ist nicht nur bei den jungen Leuten angesagt. Die ganze Szene trifft sich dort. Außerdem müsste er hier in diesem Laden einen Haufen Geld investieren, wenn er neue Leute anziehen will.«
Ich schaue mich in der Bar um, dabei habe ich die Einrichtung schon viele Male gesehen. Aber es ist mir nie aufgefallen, wie heruntergekommen und veraltet hier alles ist.
»Vielleicht kommen die Leute gerade aus diesem Grund her.«
»Mag sein. Ich will mich auch gar nicht beschweren, aber ...« Cole unterbricht seinen Satz. Ich folge seinem ernsten Blick. »Da hinten kommen sie.« Er weist mit einem Kopfnicken zur Tür, die gerade aufgeht.
Drei Männer betreten die Bar. Sie tragen legere Kleidung und doch wirken sie wie die Sorte Businesstypen, die nur im Sinn haben, Geld zu verdienen. Ihre Blicke gleiten kurz durch die Bar, aber keiner der drei verzieht eine Miene. Die würden sich sicher nicht hinter die Bar stellen, wenn mal Not am Mann ist, so wie es Elijah in seinem Nachtclub des Öfteren tut.
»Aalglatte Businesstypen«, spuckt Cole verächtlich aus, dann wendet er sich wieder der Bestellung zu, die eine Angestellte über den Tresen geschoben hat.
»Drei Bier, Cole«, höre ich Judy, eine der Bedienungen, hinter mir über die Theke rufen.
»Kriegst du«, verspricht Cole. »Heute ist wieder die Hölle los. Ich sag dir, wer diesen Club übernimmt, bekommt eine Goldgrube. Der Laden braucht nur einen neuen Anstrich.«
Ich beachte die drei Neuankömmlinge nicht weiter und wende mich wieder Cole zu.
»Warum wird der Club überhaupt verkauft?«, will ich wissen.
»Der Boss ist zu alt. Er will alles hinter sich lassen und sich in den sonnigen Süden nach Florida absetzen.«
»Verstehe. Kennst du die neuen Besitzer schon?«
Cole schüttelt verneinend den Kopf. »Hab sie nur ein paar Mal hier ins Büro gehen sehen. Aber schau sie dir doch an.« Dabei nickt er Richtung Büro, hinter dessen Tür die Männer verschwinden.
»Glaubst du, die neuen Besitzer werden das Personal entlassen?«
Cole dreht sich um und greift nach den Flaschen, um einen Drink zu mixen, der neben mir bestellt wurde. Er zuckt mit den Achseln.
»Wer weiß das schon? Auf jeden Fall sehen sie nicht danach aus, als könnte man mit ihnen verhandeln. Die wissen doch ganz genau, was sie wollen. Und das ist Kohle machen.«
»Warte doch erst mal ab. Für meine Begriffe sehen sie nicht so aus, als wollten sie dir deinen Platz als Chef der Bar streitig machen.«
»Da könntest du recht haben. Die kommen nur zum Abkassieren.«
Die Frau neben mir greift zu ihrem Glas, das Cole vor sie gestellt hat. Sie stößt aus Versehen gegen die Flasche, die ebenfalls auf dem Tresen steht. Bevor ich überhaupt mitbekomme, was passiert ist, läuft der Inhalt über die Theke und mir auf meine Jeans. Erschrocken springe ich vom Barhocker hoch, aber es ist zu spät, meine Hose ist durch und durch nass, genau wie meine Bluse.
»Oh, sorry Süße, das tut mir leid«, entschuldigt sie sich bei mir.
»Ist nicht schlimm. Außer, dass ich jetzt rieche wie ein ganzes Spirituosenlager, ist ja nichts passiert«, antworte ich sarkastisch.
Cole schüttelt den Kopf und reicht mir einige Papierservietten. Das ist wieder mal typisch. Die Bar ist voll mit Menschen, aber mich muss dieses Schicksal ereilen. Warum immer ich?, denke ich deprimiert. In jedes Fettnäpfchen muss ich treten. Ich wüsste nicht, was mir heute noch passieren könnte.
»Warte, ich habe ein Kleid in meiner Tasche, das kannst du anziehen«, bietet sie mir großzügig an.
Ich werfe ihr einen zweifelnden Blick zu. Sie sieht nicht gerade aus wie eine Büroangestellte. Eher wie eine der Prostituierten, die hier immer mal wieder einkehren. Was für ein Kleid soll das wohl sein? Schon zieht sie ein kurzes, enges Kunstleder-Ding aus ihrer Tasche, das mehr zeigt als verdeckt. Mir kommt sofort die Szene mit Julia Roberts in Pretty Woman in den Sinn, wie sie in dem kurzen blauen Rock und dem angedeuteten weißen Top, die mit einem Metallring verbunden sind, die Straße entlang flaniert und dann auf den reichen Geschäftsmann trifft, der sie aus dem Elend herausholt. Aschenputtel in modern! Aber eben leider nur eine Utopie.
»Hier, zieh das an. Bei deiner Figur sieht das richtig heiß aus.«
»Ich weiß nicht«, blocke ich ab.
»Warum denn nicht. Du kannst das tragen, Sunday«, bestärkt mich Cole lächelnd.
»Du spinnst ja«, sage ich lachend.
Doch irgendwie bin ich heute in der merkwürdigen Stimmung, so einen Blödsinn mitzumachen. Ich zögere noch kurz, dann nehme ich den kleinen Kunstlederfetzen und verschwinde nach hinten zu den Waschräumen. Von den Gästen in der Bar hat sonst keiner etwas von dem Fauxpas mitbekommen. Die Gespräche an den Tischen werden immer lauter, je mehr sich die Bar füllt, während ich mich an einer Gruppe junger Frauen vorbei dränge. Ich könnte auch einfach nach Hause gehen. Aber ich tue es nicht, betrete stattdessen eine der Kabinen, befreie mich von der nach Alkohol riechenden hellen Hose und der Bluse und streife mir das Lederkleid über.
Als ich aus der Kabine trete, fällt mein Blick in den großen Spiegel, der quer über der hinteren Wand hängt und ich muss zugeben, das Outfit sieht wirklich scharf aus, obwohl das so gar nicht mein Kleiderstil ist. Eine junge Frau tritt ebenfalls vor den Spiegel und überprüft ihr Make-up. Unsere Blicke treffen sich im Spiegel.
»Sieht scharf aus«, bemerkt sie anerkennend. Ich lächle sie an, stopfe heute schon zum zweiten Mal verschmutzte Kleidung in meine große Handtasche und gehe wieder zurück in die Bar. Mittlerweile steht mein Zombie auf der Theke und die Prostituierte ist verschwunden.
»Wo ist sie hin?«, frage ich Cole, nachdem ich mich vorsichtig auf den Barhocker geschoben habe, sodass der kurze Rock wenigstens meinen Po bedeckt.
»Sie hatte es plötzlich sehr eilig. Vielleicht ein Klient?«
Klient, wie sich das anhört. Wenn ich einen Klienten habe, dann zeige ich ihm Häuser oder Wohnungen in Beacon Hill oder Back Bay, aber mehr als einen Händedruck und ein Lächeln kann mein Kunde von mir nicht erwarten.
»Du siehst wirklich heiß aus, Sunday«, gibt Cole nickend von sich.
Ich schlage die Beine übereinander und ernte dafür von einigen jungen Männern an den Tischen aufmerksame Blicke und Pfiffe. Durch die Schnüre, die sich über meine Brüste ziehen und sie optisch so richtig in Szene setzen, trifft der Begriff »heiß« absolut zu. Im normalen Leben trage ich Körbchengröße B, aber in dieser Korsage könnte man annehmen, ich hätte Titten in Doppel-C. Ich schaue an mir herunter und muss feststellen, dass die Schnürer so gar nicht zum Kleid passen. Ein Stilbruch, der schon mehrere Male auf den internationalen Laufstegen gezeigt wurde. Ich bin keine Modeikone, aber meine Freundin Tyler hat einen ähnlichen Style erst vor kurzem für ein Modelabel getragen.
»Ich soll dir sagen, du sollst das Kleid einfach in den nächsten Tagen hier abgeben. Sie holt es sich dann wieder ab«, unterbricht Cole meine Gedankengänge.
»Ist gut. Ich hatte auch nicht vor, dieses Teil zu behalten. Ist schon peinlich genug, hier an der Bar in so einer Aufmachung zu sitzen.« Dabei schaue ich an mir herunter.
»Ich pass schon auf dich auf, Sunday.«
Dann rollt Cole genervt die Augen, als er von seinem Chef ins Hinterzimmer gerufen wird.
»Tut mir leid, ich muss mal kurz nach hinten. Das war es dann wohl? War schön, dich kennengelernt zu haben«, sagt er zu mir, legt das Handtuch auf die Theke und verschwindet nach hinten ins Büro.
Ich greife zu meinem Glas und trinke den Cocktail, der unwahrscheinlich viel Alkohol enthält, zu schnell. Aber irgendwie fühle ich mich unter den Blicken der Typen hinter mir gar nicht wohl. Die erregende Stimmung, die ich gerade noch in den Waschräumen empfunden habe, ist wie weggewischt und jetzt ärgere ich mich, diesen Fetzen überhaupt angezogen zu haben. Bin ich denn total verrückt geworden?
Ich kann die Männer im Spiegel vor mir beobachten, wie sie scherzend zu mir schauen. Jetzt stehen zwei von ihnen auf und kommen auf mich zu. Ich will schnell die Bar verlassen und krame in meiner Handtasche, um das Geld für den Drink auf den Tresen zu legen. Aber leider zu spät. Der eine stellt sich rechts von mir an die Bar, der andere quetscht sich auf der anderen Seite zwischen die Barhocker.
»So allein?«
»Das kann man in einer voll besetzten Bar wohl nicht behaupten«, antworte ich reserviert, drehe mich erst gar nicht um und starre weiter geradeaus auf das Regal mit den Flaschen vor dem Spiegel. Ich hoffe, sie haben verstanden und verschwinden wieder.
»Für 20 Piepen, Bunny, kannst du mir einen blasen.« Dabei zieht er einen Geldschein aus seiner Hosentasche und wedelt damit vor meinem Gesicht herum.
Ich ziehe scharf die Luft ein und verziehe angeekelt das Gesicht. Das darf doch nicht wahr sein. Mal ganz abgesehen davon, dass ich diesen widerlichen Typen nicht mal mit der Kneifzange anfassen würde, läuft es mir eiskalt den Rücken herunter, wenn ich mir vorstelle, ihn mit meinem Mund an einer Stelle zu berühren, die in mir nur einen Würgereiz hervorruft. Ich kenne die Preise in der Branche nicht, aber für lumpige 20 Dollar kann er nicht mal erwarten, dass ich es ihm mit der Hand besorge, geschweige denn, meine Lippen um seinen Schwanz lege. Allein der abgestandene Zigarettengeruch, der ihn umgibt und der ihm bei jedem Wort aus dem Mund schleicht, vermischt mit Schweiß, der an seinem Körper klebt, und den Ausdünstungen des Alkohols, ekelt mich an. Jetzt legt er seine große, raue Hand auf meine Schulter und lässt seine Finger über meine nackte Haut wandern. Unter der Gänsehaut, die sich sofort ausbreitet, zucke ich angewidert zusammen.
Jetzt reicht es!

Holly Summer
Dark Guardian
Boston Bad Boys Band 2

»Elijah?«, rufe ich laut in den Flur, dabei hüpfe ich unbeholfen auf einem Bein aus der Tür meines Schlafzimmers, während ich die flachen Schuhe überstreife.
Der Duft von frischem Kaffee steigt mir verführerisch in die Nase. Aber ein Blick auf meine Armbanduhr genügt, um mir darüber klar zu werden, dass aus einem gemütlichen Frühstück mit Elijah heute nichts werden wird. Ich bin spät dran. Fast wäre ich in meiner Eile auf der vorletzten Treppenstufe hängen geblieben und murmle wilde Verwünschungen. Verdammter Stromausfall letzte Nacht! An der Tür stecke ich den Kopf zur Küche hinein. Elijah steht mit der Hüfte schwingend am Herd und wippt im Takt der Musik aus dem Radio mit.
»Eliiiijjjaaah«, rufe ich ihn laut und wild mit der Hand fuchtelnd. Endlich dreht er sich zu mir um und stellt das Radio leise.
»Guten Morgen, Süße. Du bist spät, hast du mal auf die Uhr geschaut?«
»Das weiß ich selbst«, stöhne ich. Wäre Elijah nicht der beste Freund, den man sich wünschen kann, würde ich ihm seinen Sarkasmus übel nehmen. Aber ihm böse zu sein, ist genauso, als wollte man den Mond vom Himmel holen: unmöglich.
»Mein Wecker war aus. Wir hatten letzte Nacht einen Stromausfall, falls du es nicht bemerkt haben solltest. Du hättest mich ruhig wecken können«, halte ich ihm vor und betrete die Küche.
»Sorry, Süße.«
»Schon gut. Ich nehme dein Rennrad, okay? Mit dem Bus schaffe ich es nicht mehr.« Das ist eigentlich keine Frage, sondern eine Feststellung.
»Ich würde dich gerne fahren, aber ich erwarte jeden Moment den Handwerker, damit endlich diese verdammte Treppenstufe repariert wird. Also gut, nimm das Rennrad. Es ist gestern Nacht spät geworden bei mir, wir hatten Ärger im Club«, teilt er mir mit, während er geschäftig in der Pfanne rührt. Ich ziehe fragend eine Augenbraue hoch, aber sein Bericht muss bis heute Abend warten.
»Lass uns später darüber reden, okay? Und mach dir keine Gedanken, mit dem Rad bin ich ohnehin viel schneller im Büro. Ich nehme einfach die Abkürzung durch den Park.«
»Okay, aber pass auf, dass es nicht geklaut wird«, sagt er und wendet das Omelett in der Pfanne.
»Ich lass doch dein heiß geliebtes Rennrad nicht auf der Straße stehen. Was denkst du denn von mir? Ich stelle es natürlich in den Hausflur«, verspreche ich ihm.
Der Geruch von geschmolzenem Käse und frischen Tomaten steigt mir verführerisch in die Nase. Elijah ist ein fabelhafter Koch. Seit ich nach der Trennung von meinem Ex vor einem Monat bei ihm eingezogen bin, habe ich sicher schon ein Kilo zugenommen. Darüber sollte ich eigentlich glücklich sein, denn die Trennungsphase war alles andere als leicht. Sechs Jahre streicht man nicht einfach so aus dem Leben. Auch wenn Sean, mein Ex, sich wie ein verficktes Arschloch verhalten hat, habe ich immer noch Gefühle für ihn. Als ich erfahren musste, dass er schon seit über einem Jahr ein Verhältnis mit einer anderen Frau hatte, brach eine Welt für mich zusammen.
Vielleicht hätten wir unsere Beziehung noch kitten können, doch die Situation, in der er sich jetzt befindet, hat das unmöglich gemacht. Zwar versprach er mir hoch und heilig, sein Verhältnis zu beenden, aber das wollte ich nicht. Von dem Baby, das er mit ihr hat, kann er sich schließlich nicht so einfach trennen.
Als ich das Bild von seinem Kind sah, gab es für mich nur noch eins: Meine Koffer packen und ausziehen. Einen glatten Schlussstrich ziehen, auch wenn es noch so sehr wehtat. Seitdem wohne ich bei Elijah in seinem Haus, aber über kurz oder lang muss ich mir eine eigene Wohnung suchen und meine Möbel bei Sean abholen.
Elijah und ich haben uns vor einigen Jahren kennengelernt, er hatte meinem Ex und mir Jobs als Bedienungen in seinem Nachtclub angeboten. So konnten Sean und ich uns trotz des Studiums die schöne Wohnung leisten, in der ich so glücklich war. Jetzt quält mich der Gedanke an unser Zuhause nur noch. Ich konnte es nicht mehr ertragen, dortzubleiben. Dort, wo mich alles an unsere gemeinsame Zeit erinnerte.
Für manche Menschen mag es merkwürdig klingen, mit einem schwulen Nachtclubbesitzer zusammen zu wohnen, dessen Körper über und über mit Tattoos bemalt ist. Meine Eltern würden die Nase darüber rümpfen, wenn sie wüssten, dass ich nicht mehr mit Sean zusammen bin und stattdessen im Haus eines Mannes lebe, der ein ziemlich ungeordnetes und zügelloses Leben führt und auf Konventionen und Vorurteile pfeift. Aber gleichzeitig ist Elijah der liebevollste Mensch, den ich hier in Boston kenne, ein wirklicher Freund.
Meine Eltern wissen noch nichts von der Trennung von Sean und seinem Doppelleben.; Ich muss es ihnen endlich sagen. Spätestens nächsten Monat kommt es sowieso raus, denn meine Mom feiert ihren fünfzigsten Geburtstag, und dann erwartet sie, dass ich mit Sean bei ihr aufkreuze. Er war für sie immer der perfekte Schwiegersohn, und wenn es nach ihr ginge, wären wir sicher schon verheiratet. Es wäre unfair, wenn ich es ihr nicht vorher sage.
Schnell schiebe ich, nicht zum ersten Mal, diese negativen Gedanken zur Seite und angele nach dem Brötchen, das Elijah sich aufgeschnitten und mit Butter bestrichen hat. Er zieht lächelnd eine Augenbraue hoch und haut mir leicht auf die Finger.
»Hab dich auch lieb«, rufe ich ihm zu und sehe nur noch seinen gespielt tadelnden Gesichtsausdruck, als ich mich umdrehe und herzhaft in das Brötchen beiße.
»Sunday?«, pfeift er mich zurück.
»Ja?«, sage ich undeutlich mit vollem Mund.
»Pass auf mein Rennrad auf«, warnt er mich schmunzelnd mit erhobenem Holzlöffel.
Lächelnd werfe ich ihm einen Kuss zu, bevor ich das Haus verlasse und mich auf den Weg ins Büro mache.
Meinen Beruf als Immobilienmaklerin liebe ich sehr, ich hatte schon immer eine Schwäche für schöne Häuser. Sobald ich ein leeres Haus betrete, richte ich es in Gedanken ein. Leider ist mein neuer Chef, Mister Fullerton Junior, ein widerlicher Stinkstiefel, der mir nicht nur einmal zweideutige Angebote gemacht hat. Ein Blick auf meine Uhr zeigt mir, dass er mich in zehn Minuten zu einem Brainstorming erwartet. Mein kleiner roter Nissan ist in der Werkstatt und zu Fuß oder gar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln schaffe ich es unmöglich, pünktlich zu sein. Ich hänge die große Tasche um, in die ich mein Kleid und ein Paar Pumps gepackt habe, und schwinge mich auf den Sattel. Da Freitag ist und ich keine Kundentermine habe, ist es völlig in Ordnung, mit Jeans, Bluse und Blazer im Büro zu erscheinen, aber für alle Fälle habe ich ordentlich zusammengelegt mein Businesskleid dabei. Korrekte Kleidung und Etikette sind das A und O in der Firma.
Manchmal wünschte ich mir, wir hätten keinen Dresscode, so wie es in anderen modernen Firmen üblich ist. Besonders, wenn ich an den Hai von einem Chef denke. In letzter Zeit ist er besonders penetrant. Mister Fullerton Junior ist und bleibt ein alter Kotzbrocken, der nur Dollarzeichen in den Augen hat – wenn er nicht gerade seine Mitarbeiterinnen betatscht.
Diesen Monat konnte ich trotz vieler Außentermine noch keinen Abschluss machen. Das liegt nicht an mir, sondern an der Konkurrenz. Besonders an unserem stärksten Rivalen, J. Edwards Immobilien. Jedes Mal, wenn ich glaubte, das Geschäft in der Tasche zu haben, kam ein Mitarbeiter seiner Firma und hat dazwischengefunkt.
Dieser Edwards ist nicht nur mir ein Dorn im Auge, er ist der Schrecken der ganzen Immobilienbranche. Ich kenne ihn nicht, weiß nicht mal, wie er aussieht, aber ich kann ihn mir lebhaft vorstellen. Sicher ein schmieriger Businesstyp mit Bauchansatz, schütterem Haar und einem dicken Schlitten, mit dem er bei seinen Kunden vorfährt, um Eindruck zu schinden. Man hört, dass er in der High Society von Boston verkehrt.
Seine Methoden sind mir ein Rätsel, aber sicher spielt er mit den oberen Zehntausend am Sonntagmorgen Golf oder wickelt seine Klienten mit Besuchen in Nachtclubs um den Finger, in denen die Frauen mehr zeigen, als nötig wäre. Was für ein Klischee! Vorstellen könnte ich es mir, denn dass er nicht ehrlich spielt, ist in der Branche bekannt.
Nächste Woche habe ich einen Termin für ein Objekt, das richtig viel Provision bringt, da muss es klappen. Mein Klient ist ein Mann und keine von den reichen First-Class-Ladys, die auf ein bisschen Speichelleckerei abfahren und sich von einem arroganten Sack wie Edwards einwickeln lassen. Ich sehe mich schon, wie ich meinem Chef den unterschriebenen Vertrag auf den Tisch knalle, innerlich zufrieden grinsend, während er fett und feist hinter seinem Schreibtisch sitzt und ein verdutztes Gesicht macht.
Schnell weiche ich einer Pfütze aus und hätte dabei beinahe den Lenker verrissen. Die Straßen sind noch nass von dem Unwetter, das gestern Nacht über die Stadt gefegt ist, und überall liegen Blätter, die der Wind von den Bäumen gerissen hat. Die Luft riecht frisch nach feuchter Erde. Ich sauge sie gierig ein, als ich in den Park einbiege. Nur noch ein kurzes Stück, dann habe ich es geschafft. Vor mir ragt schon der Wolkenkratzer auf, in dem sich das Maklerbüro Fullerton befindet. Um diese frühe Tageszeit ist es noch ruhig hier, nur ein Jogger und eine Frau mit einem kleinen Kind an ihrer Seite kommen mir entgegen. Die Kleine zerrt quengelnd am Arm der Frau, die mit dem Handy in der anderen Hand keinen Blick für das Mädchensie übrig hat. Stattdessen ist sie ganz auf ihr Gespräch konzentriert.
Plötzlich reißt sich das Kind von der Hand der Frau los, deutet auf irgendetwas auf meiner linken Seite und läuft ohne zu schauen direkt in meine Fahrtrichtung. Die Kleine muss mich total übersehen haben. Ihr Schrei, der folgt, als sie mich dann doch entdeckt, hallt in meinen Ohren, der entsetzte Blick brennt sich in meine Gedanken und ich reagiere instinktiv. Ich greife in die Bremsen und reiße den Lenker zur anderen Seite. Den Jogger, der jetzt fast auf meiner Höhe ist, blende ich dabei völlig aus.
Dann passiert das Unvermeidliche: Statt einen Sprint über die Rasenfläche zu machen und dem Jogger damit noch auszuweichen, bleibe ich mit dem Vorderrad an einem kleinen Mäuerchen hängen, das ein Blumenbeet abgrenzt, und verliere die Kontrolle über das Rad. Der entsetzte Ausruf des Joggers, die aufgerissenen Augen der Frau und mein Aufprall auf dem sandigen Boden sind alles, was ich noch wahrnehme, bevor ich mit dem Kopf auf den weichen Sandboden aufschlage.
Verdammte Scheiße! Im ersten Moment verspüre ich keinen Schmerz, sehe in Gedanken nur die schreckliche Szene vor mir, wie das Kind blutend auf dem Weg und der Jogger unter dem Rennrad begraben liegen. Ich öffne die Augen und ein Stöhnen entfährt mir, als ich meinen Kopf heben will. Zum Glück scheint mir nichts Schlimmeres passiert zu sein. Vielleicht eine Gehirnerschütterung? Dafür war der Aufprall nicht heftig genug. Das erschrockene Weinen des Kindes durchdringt die Stille um mich herum.
Nachdem der erste Schock überwunden ist, sehe ich unter dem Schmutz an meinen Händen, dass die Haut leicht aufgekratzt ist. Der Schreck sitzt mir in allen Gliedern und mein linker Arm schmerzt ein wenig. Mit der anderen Hand streiche ich darüber. Ein Blick auf den Mann, den ich zu Boden gerissen habe, zeigt mir, dass ihm vermutlich auch nicht viel passiert ist. Er steht auf, klopft sich den Schmutz von der Kleidung und schaut sich nach dem Kind um, das für den Unfall verantwortlich war und jetzt unbeschadet in den Armen der Frau an seiner Seite liegt und sich langsam wieder beruhigt. Dann gleitet sein Blick zu mir und alle Freundlichkeit verschwindet wie durch Zauberhand aus seinem Gesicht.
Dabei sieht er verdammt sexy aus.
Warum beunruhigt mich das? Vielleicht weil er mich mit diesem drakonischen Gesichtsausdruck fixiert? Ein kurzer Schauer legt sich über meine Haut und ich ziehe unbewusst die Schultern nach oben, als würde es mich frösteln. Ich spüre, wie sich meine Nippel hart zusammenziehen. Er zieht sich die Kopfhörer aus den Ohren und spricht mich an.
»Können Sie aufstehen? Oder sind Sie verletzt?«
Seine Stimme ist kräftig und doch wirkt sie sinnlich und anziehend auf mich. Ich muss bei dem Sturz doch etwas mehr abbekommen haben, anders kann ich mir meine Reaktion auf ihn nicht erklären. Ich versuche umständlich, auf die Beine zu kommen.
»Es geht schon. Ich glaube nicht.«
Jetzt, wo er direkt vor mir steht, wird mir seine Wirkung auf mich erst bewusst. Er ist groß, muskulös gebaut und sieht nicht nur fantastisch aus, er ist ein Traum von einem Mann. Das fällt mir jetzt so richtig auf, als ich vor ihm auf dem Boden sitze und zu ihm aufschaue. Mein Blick gleitet unbewusst zu seinem Ringfinger. Da ist nichts, nur glatte Haut.
Immer noch fixieren seine stahlblauen Augen mich unter seiner Baseballkappe. Ich kann nur verlegen zur Seite sehen. Er geht zwei Schritte auf mich zu, greift entschlossen unter meine Arme und zieht mich vorsichtig hoch, nachdem er sich davon überzeugt hat, dass mir wirklich nichts weiter fehlt, dann setzt er mich auf dem Gras neben dem Fußgängerweg ab. Anschließend dreht er sich um, greift nach dem Rennrad und hebt es hoch wie ein Spielzeug, um es aus dem Weg zu räumen. Als ich den verkratzten Rahmen und das verbogene Vorderrad sehe, bin ich schlagartig wieder im Hier und Jetzt und kann einen Fluch nicht unterdrücken.
»Verdammter Mist!«
Wieder trifft mich sein strenger Blick. Hat er noch nie eine Frau fluchen gehört? Das Nächste, was ich aufschnappe, ist die laute Stimme der Frau, die das Kind immer noch an sich gedrückt hält. Sie beschimpft mich auf das Übelste, während sie mit der freien Hand in der Luft herumfuchtelt. Seit dem Augenblick, als ich in die Augen dieses Alphagottes geschaut habe, hat sich alles um mich herum in Luft aufgelöst. Ich sollte mich bei der Frau entschuldigen, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Dennoch sitze ich einfach hier und bin wie verhext von diesem Mann.
»An Ihrer Stelle würde ich den Mund halten«, wendet der große Unbekannte sich an die Frau, was sie sofort verstummen lässt.
Seine Stimme ist überlegen, aber nicht beleidigend oder laut. Völlig sprachlos wegen seiner Impertinenz bleiben ihr die Worte im Hals stecken. Sie reißt die Augen auf und schnaubt aufgebracht. Ich halte kurz die Luft an, als mir die Unverschämtheit seiner Worte bewusst wird. Warum ergreift er Partei für mich, obwohl ich ihn gerade über den Haufen gefahren habe?
»Der Kleinen ist doch nichts passiert, oder? Sie sollten besser auf sie aufpassen und Ihre Pflichten nicht vernachlässigen, dann wäre das hier nicht geschehen«, zischt er. Dem kleinen Mädchen zwinkert er dabei verschwörerisch, ja fast liebevoll zu.
Innerlich lächle ich über seine Worte, aber gleichzeitig kann ich nur den Kopf schütteln über seine Dreistigkeit ihr gegenüber. Ich hätte mich niemals getraut, die Frau in diesem beleidigenden Ton anzugreifen, besonders, da das hier ein Fußgängerweg ist, und die Schuld damit ganz allein bei mir liegt.
»Es tut mir leid«, versuche ich, zu retten, was zu retten ist. »Es war meine Schuld.«
»Die Menschen werden immer dreister«, dringen noch die verärgerten Worte der Frau an mein Ohr. Meine Entschuldigung hat sie überhaupt nicht zur Kenntnis genommen.
Dann dreht sie sich völlig empört über seine Reaktion um, nimmt das Kind an der Hand und verschwindet vor sich hin schimpfend hinter der nächsten Biegung. Bevor ich aufstehen kann, wendet er sich wieder mir zu.
»So, und jetzt zu Ihnen«, funkelt er mich aufgebracht an.
Ich schaue zu ihm hoch, während ich vorsichtig den Schmutz von meinen Händen reibe, und verziehe nun angefressen das Gesicht. Ups, scheinbar habe ich ihn falsch eingeschätzt. Jetzt bin ich es, die in sein Visier geraten ist.
»Sie hätten sie nicht so anfahren dürfen. Es war ganz allein meine Schuld.«
»Dann brauche ich Ihnen ja auch nicht zu erklären, dass das hier ein Fußgängerweg ist!« Dabei zeigt er provozierend auf den Gehweg und das Schild hinter mir.
Mein Gott, seine Belehrung kann ich jetzt gebrauchen wie einen Pickel an meinem Hintern. Und was heißt hier überhaupt »erklären«? Ich bin nicht blöd. Nur, weil ich blondes Haar habe, muss er mich nicht behandeln wie die sprichwörtliche Blondine. Dieser Machomann mir gegenüber spielt sich auf wie einer meiner Lehrer in der Schule, der auch bei jedem kleinsten Vergehen den Autoritären raushängen lassen musste.
»Ach, wirklich?«, rutscht es mir jetzt herablassend heraus, dabei streiche ich mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Eigentlich wollte ich mich bei ihm entschuldigen, aber seine überhebliche Art lässt meinen Adrenalinspiegel wieder in die Höhe schnellen.
»Sie finden das wohl auch noch witzig?«, brummt er.
»Sehe ich etwa so aus?«, kontere ich genervt. »Ja klar, ich liebe es, mich auf dem Boden im Dreck zu wälzen. Was dachten Sie denn?« So viel Zynismus ist eigentlich ganz untypisch für mich.
»Werden wir jetzt etwa auch noch zickig?«, provoziert er mich weiter. Dabei umspielt ein kleines Lächeln seine Mundwinkel. Ich atme hörbar ein und will ihm antworten, doch er unterbricht mich sofort. »Ich sage Ihnen mal was. Wenn Sie mir gehören würden, würde ich dafür sorgen, dass Ihnen so etwas nicht noch einmal passiert. Ich kann sehr überzeugend sein.« Dabei zeigt er mit dem Finger auf mich.
Mir bleibt im ersten Moment vor Sprachlosigkeit der Mund offen stehen. Ist dieser Kerl denn verrückt? In welcher Welt lebt er eigentlich? Und was fällt ihm ein, von mir als Besitz zu sprechen? Der hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun! Schnell fasse ich mich wieder.
»Das glaube ich Ihnen sofort«, antworte ich schnippisch. »Allerdings finde ich Ihre Wortwahl etwas übertrieben.«
»Ach ja? Inwiefern?«
Dabei fixiert er mich wie eine Klapperschlange, die ihr Opfer vor sich sieht und nur darauf wartet, im richtigen Moment die Giftzähne in das Objekt ihrer Begierde zu schlagen. Seine Worte sind leise, aber sehr bestimmt, sodass es mir heiß und kalt wird.
»Na, Menschen als Besitz zu bezeichnen. Das geht ja wohl entschieden zu weit. Finden Sie nicht?«
Seine einzige Antwort auf meine Frage ist ein geheimnisvolles Lächeln. Dabei beobachtet er mich, als wollte er abschätzen, wie ich reagiere. Er regt mich auf eine Art auf, die mir unbegreiflich ist. Ob es an den Worten liegt, die er gerade zu mir gesagt hat, oder an seinem verdammt guten Aussehen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das warme Gefühl in meinem Bauch bis in meine Scham dringt. Was ich überhaupt nicht verstehen kann.