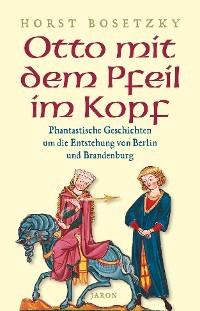Kitabı oku: «Otto mit dem Pfeil im Kopf», sayfa 7
Zwei
Um die Bedeutung des Klosters Lehnin für die Askanier zu begreifen, müssen wir ins Jahr 1180 zurückgehen. Zu dieser Zeit war Otto I., Sohn von Albrecht dem Bär, Markgraf von Brandenburg und bemüht, das Werk seines Vaters fortzusetzen.
Otto war im weiten Land zwischen Brandenburg und Spandow unterwegs, genauer gesagt in der Zauche, und schlief, ermattet von der Jagd, unter einer Eiche ein, einem Baum, der den Slawen heilig war. Da plagte ihn ein Albtraum. Immer wieder drang eine grimmige weiße Hirschkuh auf ihn ein, Kopf und Geweih voran, und wollte ihn aufspießen. Ottos Versuche, sie mit seinem Jagdspieß abzuwehren, blieben vergeblich. In seiner Not begann er zu beten: »Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott!« Darauf löste sich die Traumerscheinung auf wie eine Nebelbank bei Wind und Sonne.
Als der Markgraf seinen Begleitern von diesem Traum erzählte, wussten sie ihn sofort zu deuten. »Die Hirschkuh steht für den Satan«, sagte Hancz von Crüchern, ein alter Haudegen, der schon Albrecht dem Bär gedient hatte. »Und der Satan schnaubt vor Wut und erzittert in seinem Ingrimm, weil ihr, dein Vater wie du, im Lande Brandenburg schon so Großes vollbracht habt und noch mehr vollbringen werdet, dass der Herr der Finsternis fürchtet, seine Herrschaft zu verlieren.«
Jacopp von Colno sah die Sache nicht ganz so mystisch. »Ich glaube eher, dass wir die Hirschkuh als Sinnbild für die heidnischen Slawenstämme nehmen sollten, die hier noch immer so reichlich siedeln.«
»Dann sollten wir an dieser Stelle eine Burg zu Ehren unseres Christengottes errichten!«, rief einer. »Gegen all die heidnischen Gottheiten!« Otto I. schaute zum Himmel hinauf. »Wenn schon eine Burg, dann eine Burg Gottes, also ein Kloster. Von ihm aus sollen das Licht des Glaubens sowie die gute Sitte und ehrbarer Fleiß ausgehen über das ganze Heidenland. Die Zisterzienser sollen das Land ringsum als mein Lehen erhalten.«
»Und wie nennen wir den Ort?«, fragte Hancz von Crüchern.
Der Markgraf überlegte nicht lange. »Lehnin, weil es ein Lehen ist!«
Jacopp von Colno hielt das für bedenklich. »Bei den Slawen heißt die Hirschkuh Jelenin oder auch Lanye, und es geht doch schlecht an, dass ein deutscher Markgraf einer Klosterstiftung, die sich gegen die heidnischen Slawen wendet, ausgerechnet einen Namen gibt, von dem man annehmen könnte, er stamme aus dem Slawischen.«
Otto I. lachte. »Warum nicht? Damit werden die Slawen ohne Arg sein und uns keinen Widerstand entgegensetzen.«
Um die Machtverhältnisse klarzustellen, fällte man die slawische Eiche, so wie der heilige Bonifatius einst die Donar-Eiche gefällt hatte.
Diese Szene hatte der Zisterzienserabt Sibold vor Augen, als er im Sommer 1190 die Altarstufen der Klosterkirche betrat, in der ein verkieselter Eichenblock eingelassen war – ein Teil des Baumes, den Ottos Leute vor zehn Jahren gefällt hatten. Vor sieben Jahren war Sibold dem Ruf von Otto I. gefolgt und aus dem Harzvorland in die Mark gekommen, aus dem Kloster Sittichenbach nahe Eisleben. Die dortigen Mönche schuldeten Albrecht dem Bär Dank für früher erwiesene Freundlichkeit.
»Herr, hättest du dem Markgrafen die weiße Hirschkuh nicht an einem besseren Orte schicken können!«, hatten die Ministerialen am askanischen Hof schon wiederholt geklagt, denn das Land um den Lehniner Klostersee bestand weithin aus tiefen, unwegsamen Sümpfen. Die Slawen siedelten auf der kargen, aber wenigstens begehbaren Hochfläche ringsum oder an Seen mit schönen sandigen Ufern. Die Zisterzienser aber hatten vom Benediktinerorden die Maxime ora et labora übernommen, und das Leben konnte für sie gar nicht hart genug sein, um Gott zu zeigen, wie sehr man ihm verpflichtet war. Und wenn einer den Tod jeden Tag vor Augen hatte, dann tröstete er sich damit, dass niemand tiefer fallen konnte als in die Hand Gottes. So suchten sie denn mit dem Spaten in der rechten und dem Kreuz in der linken Hand, den Slawen zeitgemäße Methoden des Ackerbaus wie auch den christlichen Glauben nahezubringen.
»Herr«, betete Sibold, »wir flehen dich an, verschone uns mit weiteren heftigen Gewittern, die das mühsam gerodete Land unter Wasser setzen und unsere Ernte vernichten!«
Dabei baute er auf das, was im Matthäus-Evangelium geschrieben stand, 21. Kapitel, Vers 22: Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubet, werdet ihr’s empfangen.
Pater Hilarius wartete schon auf ihn, um mit ihm den Ablauf des Tages zu besprechen und aktuelle Probleme zu erörtern. »Die Slawen in Nahmitz wollen uns nicht fischen lassen, weder im Netzener See noch im Klostersee«, klagte er. »Und da ist einer gekommen, der nennt sich Darko und will sie gegen uns aufhetzen. Er sagt, der Markgraf habe ihnen vor langer Zeit schon die Fischerei- und Mühlenrechte übertragen – und nicht uns. Otto sollte uns ein paar Leute schicken, die hier für Ordnung sorgen.«
»Ich will keinen Streit und erst recht keinen Gebrauch von Schwertern, Pfeilen und Lanzen!«, rief Sibold, der jedem Konflikt herzlich abhold war. »Mit Liebe wollen wir die Heiden bekehren. Darum bitte ich den Herrn.«
Veytt von Gonna hatte sich im Hause eines Ackerbürgers einquartiert und schlich nun im Morgengrauen über den Hof, in den Händen einen Becher mit frischem Wasser und einen Teller mit Brot und Speck. Bevor er das Scheunentor aufzog, sah er sich nach allen Seiten um, ob ihn auch niemand beobachtete. Nein, alles lag noch in tiefem Schlaf. Diese Vorsicht musste er walten lassen, denn erfuhr man, dass er Ricario Accorsi bei sich versteckt hatte, verfiel auch er der Ächtung, da ganz Magdeburg den Venezianer für den Mörder des Kaufmanns Peter Drackstedt hielt.
Ricario Accorsi war den Häschern entkommen und hatte sich zu Veytt von Gonna geflüchtet, dem er bei Gott und seiner Ehre immer wieder hatte schwören müssen, Drackstedt nicht getötet, sondern nur als Erster dessen Leichnam entdeckt zu haben. Er fuhr hoch, als er den Zisterzienser kommen hörte.
»Buongiorno, Signore. Hier, bitte labt Euch!«
Ricario bedankte sich und machte sich über das her, was auf dem Teller lag.
»Du musst weg aus Magdeburg«, begann Veytt von Gonna die Unterhaltung. »Sie werden die Reichsacht über dich verhängen, so dass dich jedermann ohne Strafe töten kann.«
Ricario fuhr auf. »Ich bin aber unschuldig!«
»Pst!« Veytt von Gonna legte den Finger auf den Mund. »Die Magdeburger sind ohne Ausnahme von deiner Schuld überzeugt. Du hättest sonst nicht die Flucht ergriffen, argumentieren sie.«
»Ich habe die Flucht nur ergriffen, weil ich mir sicher war, dass sie mich für den Mörder Drackstedts halten und köpfen würden …« Noch konnte keiner beweisen, dass er es mehrmals mit Katharina Drackstedt getrieben hatte, aber man tuschelte schon. Und bei einem hochnotpeinlichen Verhör würde Katharina wohl ein Geständnis ablegen.
Veytt von Gonna musste diesen Zusammenhang ahnen, da er von der Triebhaftigkeit des Freundes wusste, vermied das Thema Frauen aber.
»Jedenfalls musst du noch heute aus Magdeburg verschwinden, denn irgendwann wird man sich daran erinnern, dass wir befreundet sind, und die richtigen Schlüsse ziehen.«
Ricario stöhnte auf. »Wie soll ich denn aus Magdeburg rauskommen? An den Toren wird mich doch selbst der dümmste Posten erkennen und dingfest machen!«
Veytt von Gonna überlegte eine Weile. »Ich habe eine Idee. Gestern ist eine Schar von Zisterziensern nach Magdeburg gekommen, und die wollen heute weiter zum Kloster Kamp am Niederrhein. Unter die könntest du dich mischen …«
»Ich in meinem Gewand?«
»Nein, ich verschaffe dir eine Ordenstracht.«
Nach einer Stunde brachte er sie dann. Sie bestand aus einer weißen Tunika mit schwarzem Gürtel und einem Überwurf mit Kapuze, genannt Skapulier.
Ricario hatte zwar keinen Spiegel zur Verfügung, empfand sich aber in dieser Verkleidung eher als Narr denn als Mönch.
Veytt von Gonna musste schmunzeln, so arg und dramatisch alles auch war. »Sehr schön! Das Schönste aber kommt noch.«
Ricario Accorsi erschrak. »Was denn?«
»Ich muss dir noch eine Tonsur schneiden.«
»Mein Gott, nein!«
Der Zisterzienser blieb hart. »Doch! Ohne Tonsur wirst du nicht wie ein Mönch wirken.«
Ricario Accorsi ergab sich seinem Schicksal, denn eine andere Chance, dem Henker zu entgehen, hatte er nicht.
»Wunderbar«, fand Veytt von Gonna, als er sein Rasiermesser wieder absetzte. »Nun muss es dir nur noch gelingen, dich bis zum nächsten unsrer Klöster durchzuschlagen – und das wäre Lehnin.« Er beschrieb ihm den Weg dorthin.
»Das hatte ich mir schon immer gewünscht: eine Woche lang ohne Essen und Trinken durch Sumpf und Heide wandern zu dürfen«, sagte Ricario ironisch. »Vielleicht gibt es auch noch ein paar reißende Ströme, durch die ich schwimmen muss …«
»Das kann dir nur dann widerfahren, wenn du dich total verläufst und am Ufer des Rheins landest.«
»Und wie soll ich nun heißen?«, fragte Ricario Accorsi. »Bruder Ricario?«
»Nein, das klingt zu verdächtig. Es sollte ein Name sein, der zu einem frommen Menschen passt. Am besten nennst du dich nach einem unsrer verstorbenen Päpste.«
Ricario Accorsi überlegte. »Anaklet, Evaristus, Telesphorus, Hyginus, Eleutherus, Zephyrinus … Nein, diese Namen kann man sich ja kaum merken. Hast du nicht einen einfacheren für mich?«
»Dann nimm doch am besten Lando«, schlug Veytt von Gonna vor.
»Wie?« Ricario Accorsi glaubte sich verhört zu haben.
»Lando, ganz richtig! Der war im Jahre 913 unser Papst und ist insofern einmalig.«
So wie ich, dachte Ricario Accorsi.
Darko saß in seiner Hütte, die etwas außerhalb von Poztupimi gelegen war, dem heutigen Potsdam. Im Ort selbst war er nicht gern gesehen, denn während er nicht anders konnte, als immer nur Hass zu predigen, wollten die Slawen in ihrer überwiegenden Mehrheit in Frieden mit den Deutschen leben. Es gab allerdings einige, die seine Gesellschaft nicht scheuten, ja die sogar zu ihm kamen. Sie erbaten sich von ihm Hilfe in allerlei Lebenslagen und beteten mit ihm die alten Götter an, deren Bilder Darko an den Wänden hängen hatte. An deren Spitze stand Svarog, der Gottvater und Schöpfer allen Lebens, Gott des Lichtes und des Feuers, der Himmelsschmied. Neben ihm, aber ein Stückchen tiefer, hingen Svarozic, sein Sohn, der Sonnengott, Vermittler des göttlichen Lebens auf der Erde und Spender des Guten, und Perun, der Gott des Gewitters und des Krieges. Dessen Hilfe erflehte Darko besonders oft.
Während er über seinen Plänen brütete, kamen vom Havelufer immer wieder alte Männer und Frauen zu ihm herauf, die seiner Hilfe bedurften.
Bohuměr, ein Fischer, klagte über einen Karbunkel, der sich auf seiner linken Gesäßbacke gebildet hatte und ihn daran hinderte, längere Zeit in seinem Kahn zu sitzen.
»Zieh die Hose runter«, sagte Darko. »Ich öffne den Karbunkel mit den Krallen eines Fischotters, dann heilt er bald.«
Cveta, eine Magd, wollte, dass er ihre Warze an der linken Hand behandelte, die immer größer wurde. Er berührte diese mit einem gefundenen Knochen und stach zusätzlich noch kreuzweise vier spitze Kienspäne hinein, um ihre Verbindung zum Körper zu kappen.
Tješimir, ein Bauer, sorgte sich um sein Vieh, das andauernd krank wurde.
»Stell einen schwarzen Ziegenbock in den Stall!«, rief ihm Darko zu. »Der zieht die Krankheiten ab.«
So ging es den halben Vormittag über, bis sich endlich sein engster Vertrauter bei ihm blicken ließ, der Bäcker Jarosław.
Sie setzten sich ans Ufer und waren bald bei ihrem Lieblingsthema angelangt: der Vertreibung aller Fremden aus dem Slawenland zwischen Elbe und Oder.
Als hätte er Cato den Älteren gehört, erhob Darko bei jedem ihrer Treffen seine Forderung: »Im Übrigen bin ich der Meinung, dass das Kloster Lehnin zerstört werden muss!«
Auch in Jarosław brannte dieser verzehrende Hass. »Ja, die Deutschen müssen weg, die Askanier müssen weg, die Zisterzienser müssen weg!«, rief er. »Zum Teufel mit allen!«
Dann berauschten sie sich an vergangenen Geschehnissen.
»Weißt du noch, am 29. Juni 983 …« Da war der große Slawenaufstand losgebrochen, und man hatte die Besatzung von Havelberg getötet und den dortigen Bischofssitz zerstört.
»Ja, und drei Tage später haben die Unsrigen die Brandenburg überfallen, und das Blut der Askanier und ihrer Priester ist in Strömen geflossen. Dann haben wir auf dem Harlunger Berg einen Tempel für unseren Triglaw errichtet.«
»Das ist leider schon lange her«, seufzte Darko. »Aber vor elf Jahren war ich selber dabei, als wir in Jutriboc den Rizzo erschlagen haben, den Abt aus Zinna. Du siehst also, man muss nur den Mut haben, das Böse aus der Welt zu schaffen.«
Jarosław war recht skeptisch. »Es sind zu viele, und gegen ihre Waffen sind wir ohne Chance.«
Darko wusste das und plädierte für etwas, das man einige Jahrhunderte später eine Guerilla-Taktik nennen sollte. »Wir müssen sie mit Nadelstichen treffen und langsam mürbe machen. Sie müssen dieses Land hier zu hassen beginnen und nur noch den einen Wunsch haben: Weg von hier, bevor wir alle vor die Hunde gehen! Und was meinst du, wie schnell die Zisterzienser wieder in ihr Mutterkloster zurück wollen, wenn sie Woche für Woche einen von ihnen tot im Wald auffinden!«
»Und wie willst du das bewerkstelligen?«
»Ganz einfach! So nämlich …« Darko holte eine Keule aus dem Schrank, um die er oben einen dicken Wolllappen gewickelt hatte. »Damit kriegen die Mönche einen über den Schädel gezogen. Sie haben ja ihre Kapuze über den Kopf gestreift, und deshalb wird wohl die Kopfhaut nicht aufplatzen. Dann können wir …«, er zog eine Art Dreizack hervor, dem aber das Mittelteil fehlte, »… dem Toten diese Gabel ins Bein stechen. Das sieht dann aus wie ein Schlangenbiss.«
Jarosław war begeistert von dieser Aussicht. »Eine großartige Idee! So wird keiner uns verdächtigen.«
Ricario Accorsi hatte die Karte der Mark Brandenburg so weit im Kopf, dass er in etwa wusste, wie er zu laufen hatte: erst Richtung Nordost, dann Ost – also immer hinein in die aufgehende Sonne. Es wurde langsam Hochsommer, und da war es kein großes Problem, in den Wäldern einen Schlafplatz zu finden. Nur im Morgengrauen, wenn sich der Tau auf Gesicht und Hände legte, fror er etwas, zumal ihm eine Decke fehlte. Fand er aber weiches Moos und trug er genügend dünne Äste und trockene Gräser zusammen, so ergab das ein halbwegs komfortables Nachtlager. Richtig satt wurde er zwar nie, aber es gab so viele Beeren und wilde Früchte zu essen, dass er nicht verhungerte. Und verdursten musste er auch nicht, da er regelmäßig an Bächen vorbeikam. Was ihn aber mächtig störte, war seine Ordenstracht. Zum einen behinderte sie ihn beim Laufen, und zum anderen war sie ihm viel zu auffällig. Er konnte sicher sein, dass der Erzbischof seine Heidereiter ausschickte, ihn einzufangen, und die hätten schon blind sein müssen, ihn nicht zu entdecken, wenn er über ein Feld oder eine Lichtung lief. Grün und grau wären die richtigen Farben gewesen, so wie sie die Meisen und die Grünlinge zeigten, nicht aber das Schwarzweiß einer Elster.
Einmal, als ihm zu heiß geworden war, stieg er in einen Pfuhl, um sich zu erfrischen. Als sich die Frösche gestört fühlten und lauthals gegen sein Geplansche protestierten, trug er ihnen Ovid vor. »Nun hört mal schön zu, das ist aus den Metamorphosen VI, Die Frösche.«
In die Fluten zu springen,
Freut sie und bald ganz unter den Pfuhl zu tauchen die Glieder,
Bald zu erheben das Haupt, und bald auf der Fläche zu schwimmen;
Oft sich über dem Bord zu sonnen am Sumpf, und hinab dann
Wieder zu plumpsen in kühlende Flut. Noch jetzo beständig
Gellt von Zank die schmähliche Zung’; und der Schande nicht achtend,
Ob sie die Flut auch bedeckt, auch bedeckt noch schimpfen sie kecklich.
Selber der Ruf tönt rauh, und es schwillt der geblähete Hals auf,
Und viel weiter noch sperrt den gedehneten Rachen die Schmähung.
Schulter und Haupt sind gesellt, und scheinen den Hals zu verdrängen,
Grünlich gefärbt ist der Rücken, der groß vorragende Bauch weiß.
Jugendlich hüpfen herum im morastigen Sumpfe die Fröschlein.
Das gefiel den Tieren, und sie hörten auf mit ihrem Gequake, von dem er befürchten musste, dass es seine Häscher aufhorchen ließ.
Auf diese Weise wurde Ricario zwar nicht gerade eins mit der Natur, kam aber gut mit allem zurecht und konnte hoffen, Lehnin am Abend des zweiten Tages zu erreichen. Bis jetzt war er keinem Menschen begegnet, was in diesem mehr als dünn besiedelten Landstrich auch nicht anders zu erwarten war. Plötzlich merkte er auf: Da brannte etwas, irgendwo vor ihm! Da es kein Gewitter gegeben hatte, konnte kein Blitz etwas entzündet haben, es mussten also Menschen ein Feuer angefacht haben. Waren es Jäger oder Fischer, die sich etwas brieten? Es gab aber auch noch eine andere Möglichkeit: Der Rauch kam aus der Küche des Klosters, und dann konnte er nicht weiter als eine Stunde von dessen Mauern entfernt sein.
Voller Vorfreude beschleunigte er seine Schritte und zerriss sich dabei vollends das Gewand. Egal, bald gab es neue Kleider für ihn. Als er vor sich eine kleine Rodung sah, hörte er, wie sich ganz in der Nähe zwei Männer etwas zuriefen.
»Jest to człowiek.«
»A mnicha.«
»Do niego!«
So viel verstand er von den slawischen Sprachen, dass er eines im Nu begriff: Da waren zwei, die ihm an den Kragen wollten. Schnell bückte er sich nach dem dicksten Ast, den er finden konnte, und sprang auf die Lichtung hinaus, um die Angreifer zu erwarten. Doch aus dem Unterholz kam nur ein Mann, der die Hände hob, um anzuzeigen, dass er nichts Böses im Sinne hatte. Aber das war nur eine Finte, und fast wäre Ricario Accorsi auf sie hereingefallen. War es sein Instinkt, war es das Knacken eines Astes hinter ihm – wie auch immer, in letzter Sekunde fuhr er herum und sah gerade noch, wie ein zweiter Mann mit einer Keule ausholte, die oben mit einem Wolllappen umwickelt war. Zum Glück war er behende, und so konnte sich Ricario noch rechtzeitig um die eigene Achse drehen und die Keule mit beiden Händen abfangen. Zugleich rammte er dem Angreifer sein rechtes Knie mit derartiger Gewalt ins Gemächt, dass der sofort niederstürzte und sich schreiend auf dem Boden wälzte. Schon aber war sein Kumpan herangeeilt, um sich nach der Keule zu bücken. Ricario blieb nichts anderes, als ihm mit dem Fuß so gegen das Kinn zu treten, dass er nach hinten flog und in den nächsten Minuten genug damit zu tun hatte, sich um seinen gebrochenen Kiefer zu kümmern. Ricario Accorsi huschte zum Waldesrand und ward nicht mehr gesehen.
Sosehr ihn sein Sieg erfreute, so sehr fluchte er über seine zerrissene Kleidung. Er war es gewohnt, immer das Beste zu tragen, was es in Italien, Spanien und Frankreich zu kaufen gab, denn je eleganter er gewandet war, umso leichteres Spiel hatte er bei seinen Eroberungen. Als er an die Frauen dachte, die er zuletzt gehabt hatte, Katharina Drackstedt allen voran, verspürte er sofort eine Erektion, die sich sehen lassen konnte. Erst in diesem Augenblick wurde ihm mit großem Schrecken gewahr, dass Lehnin kein Nonnenkloster, sondern nur von Männern bewohnt war. Dieser Gedanke war für ihn so entsetzlich, dass er vergaß, darauf zu achten, wo er hintrat – und übersah deshalb eine ausgewachsene Kreuzotter, die sich vor ihm durchs Gras schlängelte … Und die zögerte nicht lange, ihm ihre Giftzähne in die nackte Wade zu schlagen.
»Herr, unser Gott, ausgelöscht wurde hier ein Leben von fremder Hand – durch furchtbare Gewalt. Herr, wir sind fassungslos, können nicht begreifen, was Menschen dazu treibt, einen anderen Menschen zu töten. Nur zu rasch geht uns in einer Stunde wie dieser der Satz über die Lippen: ›Wie kann Gott das zulassen?‹ Doch dabei vergessen wir nur zu schnell, dass nicht du, Herr, das Böse vollbringst, sondern wir selbst. Wir Menschen sind es, die einander dieses Schreckliche antun.«
Der Erzbischof selbst war es, der die Trauerrede hielt, und alle Verwandten und Freunde Peter Drackstedts waren erfüllt vom Rachegedanken, obwohl Wichmann mahnte, dass dieser nicht alles andere übertönen dürfe. Und schon nachdem man den Kaufmann zu Grabe getragen hatte und beim Leichenschmaus beieinandersaß, entwickelte Lennhart Drackstedt Pläne, wie man den Mörder seines Bruders endlich zu fassen bekommen konnte.
»Ich werde nicht eher ruhen, bis der Henker seine Arbeit getan hat!«, rief er. »Dieser Venezianer muss am Galgen hängen!«
Pater Vigilius versuchte, besänftigend auf ihn einzuwirken. »Lennhart, bist du dir denn wirklich sicher, dass es dieser Ricario Accorsi war, der …«
»Ja, ich habe doch mit ihm an ein und derselben Tafel gespeist und ihm über Stunden ins Gesicht gesehen.«
Pater Vigilius ließ dennoch nicht ab, die anderen zu ermahnen, nicht unbesonnen zu reagieren. »Bedenket aber, was in Matthäus 7 geschrieben steht: Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden; und mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden.«
»Unsinn!«, entfuhr es Jacopp von Colno, und er vermied nur mit Mühe das Wort Paffengewäsch. »Mein Freund Peter ist durch Mörderhand gestorben. Warum also sollen wir alle hier am Tisch diesen Mörder nicht richten dürfen, da wir allesamt doch keine Mörder sind!«
Katharina Drackstedt blickte sich verstohlen in der Runde um, denn sie war sich sicher, dass der Mörder ihres Mannes nicht Ricario Accorsi hieß, sondern hier mit ihr beim Leichenschmaus saß. Aber selbstverständlich schwieg sie.
»Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich der Mörder noch in Magdeburg versteckt hält?«, fragte ein Vetter des Verstorbenen.
»Das ist sehr wahrscheinlich«, antwortete Lennhart Drackstedt, »denn die Posten an den Toren hatten strenge Weisung, jeden genauestens zu überprüfen, der nach dem Mord Magdeburg verlassen wollte.«
»Das stimmt«, meinte ein anderer Verwandter, einer aus dem Rheinland, »aber zwischen der Tat und ihrer Entdeckung wird doch einige Zeit vergangen sein, und die wird der Mann genutzt haben, die Stadt zu verlassen.«
Lennhart Drackstedt reagierte etwas unwirsch. »Nein doch!« Und er murmelte noch, dass der andere wohl nicht aus Köln käme, sondern aus dem Mustopf.
Jacopp von Colno wiederholte, was eigentlich alle hätten wissen müssen: »Ich habe diesen Mann doch selbst gesehen, Sekunden nach der Tat, und bin sofort zum nächsten Nachtwächter gelaufen, um Alarm geben zu lassen. Wie soll der Mörder da entkommen sein?«
Lennhart Drackstedt bildete nun kleine Trupps aus Freunden und Verwandten der Drackstedts, die alsbald auszogen, jeden Winkel der Stadt an der Elbe zu durchkämmen. Doch ihr Bemühen war vergeblich. Was sie weiterbrachte, war ein Zufall. Am Tor, das zur Brücke auf die Elbinsel vor Magdeburg führte, unterhielten sich zwei Posten darüber, ob es eher ein Glück oder ein Unglück sei, als Mönch zu leben.
»Na, die sieben Zisterzienser, die wir neulich reingelassen haben, die haben mir einen sehr glücklichen Eindruck gemacht.«
»Wieso sieben?«, fragte der andere. »Es waren doch acht.«
»Wieso acht? Ich kann doch noch bis sieben zählen!«
»Und ich bis acht! Und ich schwöre beim Allmächtigen, dass ich acht aus der Stadt gelassen habe!«
Sie stritten sich so laut, dass Jacopp von Colno, der in der Nähe war, das mitbekam, und sofort hatte er das Rätsel gelöst.
»Wenn sieben Zisterzienser nach Magdeburg gekommen sind und es acht wieder verlassen haben«, erklärte er wenig später Lennhart Drackstedt, »dann wird der achte kein anderer gewesen sein als der Mörder deines Bruders. Er wird sich eine Ordenstracht verschafft und sich unter die Mönche gemischt haben.«
»Wie sollte das möglich gewesen sein?«
Jacopp von Colno überlegte. »Fragen wir doch einmal Veytt von Gonna!«
Sie taten es, und der Zisterzienser bestätigte ihnen, dass sich sieben seiner Glaubensbrüder bei ihm eingefunden hatten.
»Aber acht haben Magdeburg verlassen!«, rief Lennhart Drackstedt. »Und wir vermuten, dass dieser achte der Mörder meines Bruders war, nämlich der Händler Ricario Accorsi aus Venedig.«
Jacopp von Colno musterte Veytt von Gonna mit einem Blick, der nichts Gutes verhieß. »Wie ist denn zu erklären, dass dieser Mann zu einer Ordenstracht der Zisterzienser kam?«
Veytt von Gonna zuckte die Schultern. »Sie führen immer Ersatz bei sich, und er wird ihnen vorgegaukelt haben, dass er einer von ihnen ist. Ein paar Sätze Latein, ein Psalm, bestimmte Kenntnisse … Manchmal reicht nur wenig aus, andere zu täuschen.«
»Wo sind Eure Ordensbrüder denn hin?«, wollte Lennhart Drackstedt wissen.
»Nach Braunschweig wollten sie, Heinrich den Löwen zu neuen Klostergründungen in seinen Landen zu bewegen.«
»Dann auf nach Braunschweig!«, rief Jacopp von Colno.
Ricario Accorsi saß auf einem umgestürzten Baum und kühlte seine Wunde. Wenn der Biss einer Kreuzotter tödlich war, dann hatte er nicht mehr lange zu leben. Starb er hier im märkischen Urwald, würde ihn nie jemand finden – höchstens sein Skelett, wenn hier einmal gerodet wurde.
Denn dass sich die Wölfe sogleich an seiner Leiche gütlich tun würden, stand außer Frage. Er hatte nur noch eine Chance: Er musste es bis ins Kloster schaffen und hoffen, dass die Mönche ein Gegengift kannten.
Also rappelte er sich wieder auf und lief in die Richtung, in der er Lehnin vermutete. Und er schien sich nicht geirrt zu haben, denn nach ein paar Minuten stieß er auf einen Trampelpfad und eine Viertelstunde später sogar auf einen schmalen Weg. Die Fußspuren im Sand waren noch frisch, das ließ ihn weiter hoffen. Dann hörte er Stimmen, und nach weiteren hundert Schritten war er wirklich am Ziel. Man brachte ihn zum Abt.
Sibold empfing ihn mit freudiger Umarmung. »Herzlich willkommen, Bruder! Wie lautet dein Name, was führt dich her zu uns?«
»Mein Name ist Lando, ich komme aus Italien, aus dem Kloster Acquafredda, das in der Nähe des Comer Sees gelegen ist. Mein Freund und Gönner Veytt von Gonna aus Magdeburg hat mich zu Euch geschickt.«
»Wie schön!«, rief der Abt.
Ricario merkte, dass ihm der Name Veytt von Gonna alle Türen öffnete und ihm Fragen nach seiner Herkunft und seinen bisherigen Aktivitäten im Orden ersparte – vorerst jedenfalls. Später, wenn sie merkten, dass er von vielen ihrer Regeln keine Ahnung hatte, kamen bestimmt Zweifel. Um abzulenken, sprach er schnell von seinem Schlangenbiss.
»Das passiert hier öfter«, verriet ihm der Abt. »Und um das Schlimmste zu verhindern, haben wir unseren Hilarius.«
Der war ein lebensfroher, kugelrunder Mann, der alle Krankheiten kannte, die ein Mensch haben konnte, und der in einem kleinen Garten Kräuter zog, um Übel wirkungsvoll zu heilen.
»Keine Angst«, sagte er, als er Ricario Accorsis Bein betrachtet hatte, »du müsstest schon von fünf Kreuzottern gleichzeitig gebissen werden, um vom Herrn heimgeholt zu werden in die Ewigkeit.«
»Aber die Bissstelle schwillt langsam an und sieht schon bläulich aus«, klagte Ricario. »Auch kriege ich immer schwerer Luft, und mein Herz schmerzt zunehmend.«
»Ach, das gibt sich wieder!«, rief Hilarius. »Ich trage einen Brei aus Kräutern auf deine Wunde auf und verbinde sie dann. Danach trinkst du einen Schluck Wein, um ruhiger zu werden.«
In der Tat ging es ihm bald wieder besser, und der Abt holte ihn ab, um ihm seinen Schlafplatz zuzuweisen.
»Ruhe dich nun etwas aus, Bruder Lando, denn um zwei Uhr in der Nacht werden wir, wie du weißt, von der Glocke zur vigil geweckt.«
Ricario Accorsi bedankte sich und streckte sich auf seinem Strohsack aus. Nacheinander kamen die Lehniner Mönche herein.
Mein Gott, dachte Ricario Accorsi, so viele Männer! Wenn ich doch nur der Männerliebe anhängen würde! Und ein bisschen hatte er Angst, dass seine Triebe früher oder später umgelenkt werden könnten und er dann sexuell mit dem feisten Hilarius verkehrte. Um diese Ängste abzuwehren, dachte er umso intensiver an die Frauen, die er am heftigsten geliebt hatte, vor allem aber an Katharina.
Kurz vor der vigil schreckte er hoch. Gott, ein Samenerguss!