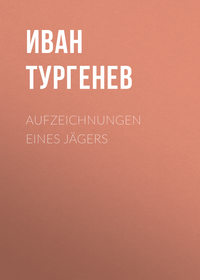Kitabı oku: «Aufzeichnungen eines Jägers», sayfa 11
Draußen war es indessen ganz dunkel geworden; Arkadij Pawlytsch ließ vom Tisch abräumen und Heu hereinbringen. Der Kammerdiener breitete Laken aus und verteilte die Kissen; wir legten uns nieder. Sofron entfernte sich, nachdem er Befehle für den folgenden Tag erhalten hatte. Arkadij Pawlytsch sprach vor dem Einschlafen noch etwas von den vorzüglichen Eigenschaften des russischen Bauern und bemerkte mir bei dieser Gelegenheit, daß seit der Amtseinsetzung Sofrons die Schipilowschen Bauern mit keinem Groschen im Rückstand seien . . . Der Nachtwächter klopfte auf sein Brett; ein Kind, das noch nicht vom Gefühl der nötigen Selbstlosigkeit durchdrungen war, schrie irgendwo im Hause . . . Wir schliefen ein.
Am nächsten Morgen standen wir ziemlich früh auf. Ich wollte schon nach Rjabowo fahren, aber Arkadij Pawlytsch äußerte den Wunsch, mir sein Gut zu zeigen, und bewog mich zu bleiben. Ich hatte auch selbst Lust, mich von den herrlichen Eigenschaften des ›Staatsmannes‹ Sofron zu überzeugen. Der Burmistr erschien. Er trug einen blauen Rock mit einem roten Gürtel. Er sprach viel weniger als gestern, sah aufmerksam und fest seinem Herrn in die Augen und gab vernünftige und zusammenhängende Antworten. Wir begaben uns mit ihm zur Dreschtenne. Sofrons Sohn, der klafterlange Schulze, allem Anschein nach ein höchst dummer Kerl, begleitete uns; ferner gesellte sich zu uns der Gemeindeschreiber Fedossejitsch, ein verabschiedeter Soldat mit riesigem Schnurrbart und einem sehr sonderbaren Gesichtsausdruck: Er sah aus, als hätte ihn vor vielen Jahren etwas in außergewöhnliches Erstaunen gesetzt, so daß er seitdem noch nicht zu sich gekommen wäre. Wir besichtigten die Tenne, die Riege, die Schuppen, die Scheunen, die Windmühle, den Viehhof, die Wintersaat, die Hanffelder; alles war tatsächlich in bester Ordnung; nur die trübseligen Gesichter der Bauern machten mich etwas stutzig. Sofron sorgte nicht nur für das Nützliche, sondern auch für das Angenehme: Er hatte alle Gräben mit Bachweiden bepflanzt, zwischen den Schobern auf der Tenne Wege angelegt und mit Sand bestreut, auf der Windmühle eine Windfahne in Gestalt eines Bären mit offenem Rachen und einer roten Zunge angebracht, an den Backsteinbau des Viehhofes eine Art griechischen Giebels angeklebt und darunter mit weißer Farbe hingeschrieben: ›Errichtet imdorfe Schipilowka imjahre tausend Acht hundert undfierzig. Dieser Fiehhof.‹ Arkadij Pawlytsch war ganz gerührt und begann mir auf französisch die Vorteile des Zinsstandes der Bauern auseinanderzusetzen, wobei er jedoch bemerkte, daß der Frondienst für die Gutsbesitzer vorteilhafter sei – aber alles könne man doch nicht haben . . .! Er fing an, dem Burmistr Ratschläge zu erteilen, wie die Kartoffeln zu pflanzen, wie das Viehfutter zuzubereiten sei und so weiter. Sofron hörte die Worte seines Herrn aufmerksam an, machte manchmal Einwände, titulierte aber Arkadij Pawlytsch weder Väterchen noch gnädigster Herr mehr und pochte immer darauf, daß sie zuwenig Land hätten und daß man welches hinzukaufen sollte.
»Nun, kauft welches dazu«, sagte Arkadij Pawlytsch, »auf meinen Namen, ich habe nichts dagegen.«
Sofron antwortete darauf nichts und strich sich nur den Bart.
»Jetzt sollten wir eigentlich in den Wald«, bemerkte Herr Pjenotschkin.
Man brachte uns sofort Reitpferde, und wir ritten in den Wald oder, wie man ihn bei uns nennt, Bannforst. In diesem Bannforst fanden wir eine furchtbare Wildnis, und Arkadij Pawlytsch lobte dafür Sofron und klopfte ihm auf die Schulter. In bezug auf das Forstwesen folgte Herr Pjenotschkin den russischen Anschauungen und erzählte mir bei dieser Gelegenheit einen, wie er ihn nannte, komischen Fall, wo ein Spaßvogel von einem Gutsbesitzer seinem Förster den halben Bart ausraufte, um ihm zu beweisen, daß der Wald nicht dichter wachse, wenn man ihn lichte . . . Aber in anderen Beziehungen waren weder Sofron noch Arkadij Pawlytsch gegen Neuerungen abgeneigt. Nach unserer Rückkehr ins Dorf führte uns der Burmistr zur Besichtigung der vor kurzem aus Moskau verschriebenen Getreideschwinge. Die Schwinge funktionierte wirklich gut, aber wenn Sofron gewußt hätte, welche Unannehmlichkeit ihn und seinen Herrn auf diesem letzten Gang erwartete, so wäre er wahrscheinlich mit uns zu Hause geblieben.
Es ereignete sich nämlich dieses. Als wir den Schuppen verließen, bot sich uns folgendes Schauspiel: Einige Schritte vor der Tür knieten neben einer schmutzigen Pfütze, in der sorglos drei Enten plätscherten, zwei Bauern: ein Greis von etwa sechzig Jahren und ein zwanzigjähriger Bursch, beide in geflickten Hemden, barfuß und mit Stricken umgürtet. Der Gemeindeschreiber Fedossejitsch bemühte sich um sie und hätte sie wohl überredet, sich zu entfernen, wenn wir noch etwas länger im Schuppen geblieben wären. Als er uns aber erblickte, richtete er sich auf und erstarrte. Gleich daneben stand der Schulze mit aufgerissenem Mund und geballten Fäusten, mit denen er nun nichts anzufangen wußte. Arkadij Pawlytsch runzelte die Stirne, biß sich auf die Lippen und ging auf die Bittsteller zu. Beide verneigten sich vor ihm schweigend bis zur Erde.
»Was wollt ihr? Worum bittet ihr?« fragte er mit strenger Stimme und ein wenig durch die Nase.
Die Bauern sahen einander an und versetzten kein Wort, sie kniffen nur die Augen wie vor der Sonne zusammen und atmeten schneller.
»Nun, was gibt’s?« fuhr Arkadij Pawlytsch fort und wandte sich sogleich an Sofron: »Aus welcher Familie sind sie?«
»Aus der Tobolejewschen«, antwortete langsam der Burmistr.
»Nun, was wollt ihr?« begann Herr Pjenotschkin von neuem. »Habt ihr keine Zungen? Sag, was willst du?« fügte er hinzu und wies mit dem Kopf auf den Alten. »Fürchte dich nicht, Dummkopf.«
Der Alte reckte seinen dunkelbraunen, runzligen Hals, öffnete schief die bläulichen Lippen, sprach mit heiserer Stimme: »Nimm dich unser an, Herr!« und berührte mit der Stirne den Boden. Der junge Bauer verbeugte sich gleichfalls. Arkadij Pawlytsch blickte mit Würde auf ihre Nacken, warf den Kopf zurück und spreizte die Beine.
»Was ist das? Über wen beschwerst du dich?«
»Erbarme dich, Herr! Laß uns aufatmen . . . Wir sind zu Tode gequält.« Der Alte sprach nur mit Mühe.
»Wer hat dich zu Tode gequält?«
»Sofron Jakowlewitsch, Väterchen.«
Arkadij Pawlytsch schwieg.
»Wie heißt du?«
»Antip, Väterchen.«
»Und wer ist der da?«
»Mein Sohn, Väterchen.«
Arkadij Pawlytsch schwieg wieder und bewegte seinen Schnurrbart.
»Nun, wodurch hat er dich zu Tode gequält?« fragte er, den Alten durch den Schnurrbart hindurch anblickend.
»Väterchen, er hat mich ganz zugrunde gerichtet. Zwei Söhne hat er außer der Reihe unter die Rekruten gesteckt, und nun will er mir den dritten nehmen. Gestern, Väterchen, hat er mir meine letzte Kuh weggeführt und meine Alte verprügelt – das hat seine Gnaden getan.« Er zeigte auf den Schulzen.
»Hm!« versetzte Arkadij Pawlytsch.
»Laßt nicht zu, daß er uns ganz zugrunde richtet, Ernährer!«
Herr Pjenotschkin runzelte die Stirn. »Was soll das heißen?« fragte er den Burmistr halblaut mit unzufriedener Stimme.
»Er ist halt ein Trinker«, antwortete der Burmistr, indem er zum erstenmal das Wort ›halt‹ gebrauchte: »Ein arbeitsscheuer Mensch. Seit fünf Jahren ist er mit dem Zins im Rückstand.«
»Sofron Jakowlewitsch hat für mich die Rückstände bezahlt, Väterchen«, fuhr der Alte fort. »Es ist schon das fünfte Jahr, daß er sie bezahlt hat, aber dann machte er mich zu seinem Knecht, Väterchen, und . . .«
»Warum warst du aber im Rückstand?« fragte Herr Pjenotschkin streng.
Der Alte senkte den Kopf.
»Du liebst wohl zu trinken und in der Schenke zu sitzen?«
Der Alte öffnete den Mund.
»Ich kenne euch«, fuhr Arkadij Pawlytsch zornig fort, »ihr versteht nur zu saufen und auf dem Ofen zu liegen, ein guter Bauer muß aber für euch aufkommen.«
»Er ist auch frech«, fiel der Burmistr seinem Herrn in die Rede.
»Nun, das versteht sich von selbst. Es ist immer so, ich habe es schon mehr als einmal bemerkt. Das ganze Jahr ist er besoffen und grob und dann wälzt er sich zu meinen Füßen.«
»Väterchen Arkadij Pawlytsch«, begann der Alte in seiner Verzweiflung, »erbarme dich! Wann bin ich denn frech gewesen? Ich spreche wie vor dem Angesicht Gottes, es geht über meine Kraft. Sofron Jakowlewitsch mag mich nicht, warum er mich aber nicht mag, darüber ist Gott Richter! Er richtet mich ganz zugrunde . . . Meinen letzten Sohn, auch den . . .« In den gelben, runzligen Augen des Alten glänzten Tränen. »Erbarme dich, Herr, schütze mich . . .«
»Und nicht uns allein . . .«, fing der junge Bauer an.
Arkadij Pawlytsch fuhr plötzlich auf: »Wer hat dich gefragt? Wenn man dich nicht fragt, so sollst du schweigen. Was ist denn das? Halt’s Maul, sage ich dir! Halt’s Maul . . .! Ach, mein Gott! Das ist ja eine Revolte! Nein, Bruder, ich rate dir, nicht zu revoltieren . . . ich . . .« Arkadij Pawlytsch machte einen Schritt vorwärts, erinnerte sich dann wohl an meine Anwesenheit, wandte sich weg und steckte die Hände in die Taschen . . . »Je vous demande bien pardon, mon cher«, sagte er mit einem gezwungenen Lächeln und senkte merklich die Stimme. »C’est le mauvais côté de la médaille . . . Nun, ist schon gut, ist schon gut«, fuhr er fort, ohne die Bauern anzublicken: »Ich will Befehl geben . . . ist schon gut, geht.«
Die Bauern standen nicht auf.
»Ich hab’ euch ja gesagt . . . ist schon gut. Geht doch, ich werde Befehl geben, sage ich euch.«
Arkadij Pawlytsch wandte ihnen den Rücken zu. »Immer Unannehmlichkeiten«, sagte er zwischen den Zähnen und ging mit raschen Schritten ins Haus. Sofron folgte ihm. Der Gemeindeschreiber glotzte mit den Augen, als wäre er im Begriff, einen großen Sprung zu machen. Der Schulze verscheuchte die Enten aus der Pfütze. Die Bittsteller standen noch eine Weile auf dem gleichen Fleck, sahen dann einander an und schlichen, ohne sich umzuschauen, nach Hause.
Zwei Stunden später war ich schon in Rjabowo und bereit, mich mit Anpadist, einem mir bekannten Bauern, auf die Jagd zu begeben. Pjenotschkin hatte bis zu meiner Abreise auf Sofron geschmollt. Ich sprach mit Anpadist von den Schipilowschen Bauern und von Herrn Pjenotschkin und fragte ihn, ob er den dortigen Burmistr kenne.
»Den Sofron Jakowlewitsch . . .? Das glaube ich!«
»Was ist er für ein Mensch?«
»Er ist ein Hund und kein Mensch, einen solchen Hund findet man bis Kursk nicht wieder.«
»Wieso?«
»Schipilowka gehört ja doch nur auf dem Papier diesem, wie heißt er noch, Pjenkin; es gehört aber gar nicht ihm, sondern Sofron.«
»Wirklich?«
»Es gehört ihm wie ein eigenes Gut. Alle Bauern ringsherum sind bei ihm verschuldet; sie arbeiten für ihn wie die Knechte: Den einen schickt er mit einer Fuhre hierhin, den anderen dorthin . . . sie kommen bei ihm nie zur Ruhe.«
»Ich glaube, sie haben wenig Land?«
»Wenig Land? Bei den Chlynowschen allein hat er dreißig Desjatinen gepachtet und bei den unsrigen – hundertzwanzig; das sind schon gleich hundertfünfzig. Aber er handelt nicht nur mit dem Boden, er handelt auch mit Pferden, mit Vieh, mit Teer, mit Öl, mit Hanf und mit allem . . . Gescheit, furchtbar gescheit und reich ist die Bestie! Einen Fehler hat er nur: Er haut gleich drein. Er ist ein Tier und kein Mensch, wie ich gesagt habe: ein Hund, ein wahrer Hund.«
»Warum beschweren sie sich nicht über ihn?«
»Ach! Was kümmert es den Herrn! Rückstände gibt es nicht, also geht es ihn nichts an. Geh einmal hin«, fügte er nach kurzem Schweigen hinzu, »und beschwer dich! Nein, er wird dich . . . versuch es nur . . . Er wird dich gleich . . .«
Ich erinnerte mich an Antip und erzählte nun, was ich gesehen hatte.
»Nun«, versetzte Anpadist, »jetzt wird er ihn auffressen; er wird den Menschen mit Haut und Haar fressen. Der Schulze wird ihn totprügeln. So ein unglücklicher armer Teufel! Und wofür leidet er . . .? In einer Gemeindeversammlung hat er sich einmal mit dem Burmistr gestritten, er konnte es nicht länger aushalten . . . eine große Sache! Seitdem hat er angefangen, den Antip zu verfolgen. Jetzt wird er ihm ganz den Garaus machen. Er ist doch solch ein Hund, solch ein Hund, Gott verzeih’ mir die Sünde, er weiß, wen er anpackt. Alte Männer, die reicher sind und viele Söhne haben, die rührt er nicht an, der kahlköpfige Teufel, hier hat er aber freies Spiel! Antips Söhne hat er ja außer der Reihe unter die Rekruten gesteckt, der unbarmherzige Schuft, der Hund, Gott verzeih’ mir meine Sünde!«
Wir begaben uns auf die Jagd.
Salzbrunn in Schlesien, Juli 1847.
Das Kontor
Es war im Herbst. Seit einigen Stunden schon streifte ich mit dem Gewehr durch die Felder und wäre wohl nicht vor Abend in die Herberge an der Kursker Landstraße zurückgekehrt, wo mich meine Troika erwartete, wenn mich nicht der außerordentlich feine und kalte Regen, der mir vom frühen Morgen an so unablässig und unbarmherzig wie eine alte Jungfer zusetzte, schließlich gezwungen hätte, irgendwo in der Nähe eine wenn auch vorübergehende Zuflucht zu suchen. Während ich noch überlegte, welche Richtung ich einschlagen sollte, fiel mein Blick plötzlich auf eine niedere Strohhütte neben einem Erbsenfeld. Ich ging auf die Hütte zu, blickte unter das Strohdach und sah einen so altersschwachen Greis, daß mir sofort jener sterbende Bock in den Sinn kam, den Robinson in einer der Höhlen seiner Insel gefunden hatte. Der Alte hockte auf dem Boden, kniff seine dunkelgewordenen, kleinen Augen zusammen und kaute eilig, aber vorsichtig, gleich einem Hasen (der Arme hatte keinen einzigen Zahn im Mund) an einer trockenen und harten Erbse, die er unaufhörlich von der einen Seite in die andere rollen ließ. Er war in seine Beschäftigung dermaßen vertieft, daß er mein Erscheinen gar nicht bemerkte.
»Großvater! Du, Großvater!« sagte ich.
Er hörte zu kauen auf, zog die Brauen in die Höhe und öffnete mit Mühe die Augen.
»Was denn?« lallte er mit heiserer Stimme.
»Wo ist hier ein Dorf in der Nähe?« fragte ich.
Der Alte fing wieder zu kauen an. Er hatte mich nicht gehört. Ich wiederholte meine Frage lauter.
»Ein Dorf . . .? Was willst du denn?«
»Ich möchte mich vor dem Regen schützen.«
»Was?«
»Vor dem Regen schützen!«
»Ja!« Er kratzte sich seinen sonnenverbrannten Nacken. »Nun, geh mal so«, begann er plötzlich, die Worte durch unordentliche Handbewegungen begleitend. »So . . . wenn du am Wäldchen vorbeikommst, wenn du da vorbeikommst, so ist ein Weg; du sollst aber diesen Weg beiseite lassen und dich immer rechts halten, immer rechts, immer rechts . . . So kommst du nach Ananjewo. Oder du kommst auch nach Sitowka.«
Ich konnte den Alten nur mit Mühe verstehen. Sein Schnurrbart hinderte ihn am Sprechen, auch die Zunge wollte ihm nicht recht gehorchen.
»Wo bist du denn her?« fragte ich ihn.
»Was?«
»Wo du her bist?«
»Aus Ananjewo.«
»Was tust du denn hier?«
»Was?«
»Was du hier tust?«
»Ich bin hier Wächter.«
»Was bewachst du denn?«
»Die Erbsen.«
Ich mußte lachen.
»Aber ich bitte dich, wie alt bist du?«
»Das weiß Gott allein.«
»Du siehst wohl schlecht?«
»Was?«
»Du siehst wohl schlecht?«
»Ja, schlecht. Es kommt auch vor, daß ich nichts höre.«
»Wie kannst du dann Wächter sein, ich bitte dich?«
»Das ist Sache der Vorgesetzten.«
Die Vorgesetzten! dachte ich mir und sah den armen Alten nicht ohne Bedauern an. Er betastete sich, holte aus dem Busen ein Stück trockenes Brot hervor und fing an, daran zu saugen wie ein Kind, die ohnehin eingefallenen Wangen mit Mühe einziehend.
Ich ging in die Richtung zum Wäldchen, bog nach rechts ab, immer nach rechts, wie mir der Alte geraten hatte, und erreichte endlich ein großes Dorf mit einer steinernen Kirche im neuen Geschmack, das heißt mit Säulen und einem ausgedehnten, gleichfalls säulengeschmückten Herrenhaus. Schon aus der Ferne hatte ich durch das engmaschige Netz des Regens ein Haus mit einem Schindeldach und zwei Schornsteinen bemerkt, das höher als die andern Bauernhäuser war, anscheinend das Wohnhaus des Schulzen. Ich richtete dorthin meine Schritte in der Hoffnung, bei ihm einen Samowar Tee, Zucker und nicht ganz saure Sahne zu finden. In Begleitung meines vor Kälte zitternden Hundes betrat ich die kleine Treppe, kam in den Flur, öffnete eine Tür, erblickte aber statt der gewöhnlichen Einrichtung einer Bauernstube mehrere, mit Papieren beladene Tische, zwei rote Schränke, bespritzte Tintenfässer, zinnerne Sandfässer, von denen ein jedes wohl einen Pud wiegen mochte, furchtbar lange Federn und dergleichen. Auf einem der Tische saß ein etwa zwanzigjähriger Bursche mit gedunsenem und kränklichem Gesicht, winzigen Äuglein, einer fettigen Stirne und unendlich langen Schläfen. Er trug, ganz wie es sich gehört, einen grauen Nankingkaftan mit Fettglanz auf Kragen und Bauch.
»Was wünschen Sie?« fragte er mich und fuhr mit dem Kopf in die Höhe, wie ein Pferd, das nicht erwartet hatte, daß man es an der Schnauze packen würde.
»Wohnt hier der Verwalter . . . oder . . .«
»Hier ist das herrschaftliche Hauptkontor«, unterbrach er mich. »Ich sitze als Diensthabender da . . . Haben Sie denn das Schild nicht gelesen? Dazu ist doch das Schild angebracht.«
»Wo könnte ich mich hier trocknen? Hat hier jemand im Dorf einen Samowar?«
»Wie sollte kein Samowar dasein«, entgegnete der Bursche im grauen Kaftan sehr wichtig: »Gehen Sie einmal zum Geistlichen P. Timofej oder in die Gesindestube oder zu Nasar Tarassytsch oder zur Geflügelwärterin Agrafena.«
»Mit wem redest du da, Dummkopf? Du läßt einen gar nicht schlafen, Tölpel!« erklang eine Stimme aus dem Nebenzimmer.
»Da ist ein Herr gekommen und fragt, wo er sich trocknen könnte.«
»Was für ein Herr?«
»Ich weiß es nicht. Einer mit einem Hund und einem Gewehr.«
Im Nebenzimmer knarrte ein Bett. Die Tür ging auf, und herein trat ein Mann von etwa fünfzig Jahren, dick, kleingewachsen, mit einem Stiernacken, hervorstehenden Augen, ungewöhnlich runden Wangen und glänzendem Gesicht.
»Was wünschen Sie?« fragte er mich.
»Ich möchte mich trocknen.«
»Hier ist nicht der Ort dafür.«
»Ich wußte nicht, daß es das Kontor ist; übrigens will ich gerne bezahlen . . .«
»Vielleicht wird es auch hier gehen«, antwortete der Dicke. »Wollen Sie sich vielleicht hierher bemühen?« Er führte mich ins Nebenzimmer, aus dem er soeben gekommen war. »Werden Sie es hier bequem haben?«
»Ja . . . Könnte ich nicht auch Tee mit Sahne haben?«
»Bitte sehr, sofort. Wollen Sie sich indessen ausziehen und ausruhen, der Tee wird im Moment fertig sein.«
»Wem gehört dieses Gut?«
»Der Frau Jelena Nikolajewna Losnjakowa.«
Er ging hinaus. Ich sah mich um: An der Bretterwand, die mein Zimmer vom Kontor trennte, stand ein riesengroßes Ledersofa; zwei gleichfalls lederne Sessel mit ungeheuer hohen Lehnen standen zu beiden Seiten des einzigen Fensters, das auf die Straße ging. An den mit grünen, rosagemusterten Tapeten beklebten Wänden hingen drei große Ölbilder. Auf dem einen war ein Hühnerhund mit blauem Halsband und der Inschrift ›Das ist meine Freude‹ dargestellt; zu Füßen des Hundes war ein Fluß, und am gegenüberliegenden Ufer saß unter einer Fichte ein Hase von ungewöhnlicher Größe, das eine Ohr gespitzt. Auf dem zweiten Bild verzehrten zwei alte Männer eine Wassermelone; hinter der Wassermelone war in der Ferne eine griechische Säulenhalle mit der Inschrift ›Tempel der Befriedung‹ zu sehen. Das dritte Bild stellte eine halbnackte Frau in liegender Pose en raccourci dar, mit roten Knien und sehr dicken Fersen. Mein Hund verkroch sich unverzüglich mit ungeheurer Mühe unter das Sofa und fand dort anscheinend viel Staub, denn er hörte gar nicht zu niesen auf. Ich trat ans Fenster. Schräg über die Straße waren vom Herrenhaus zum Kontor Bretter gelegt; eine höchst nützliche Vorsichtsmaßregel, da es ringsum, dank unserer russischen schwarzen Erde und dem anhaltenden Regen ein entsetzlicher Schmutz war. In der Nähe des Herrenhauses, das mit der Rückseite zur Straße stand, spielten sich Szenen ab, wie sie sich immer neben den Herrenhäusern abspielen: Mädchen in verschossenen Kattunkleidern liefen hin und her; Leibeigene wateten durch den Schmutz, blieben ab und zu stehen und kratzten sich nachdenklich den Rücken; das angebundene Pferd eines Zehentmannes bewegte träge den Schweif und nagte mit hocherhobener Schnauze am Zaun; Hühner gackerten; schwindsüchtige Truthennen riefen einander fortwährend etwas zu. Auf der Freitreppe eines dunklen, durchfaulten Gebäudes, wahrscheinlich der Badestube, saß ein kräftiger Bursche mit einer Gitarre und sang nicht ohne Schwung das bekannte Lied:
»Ich fli – iehe in die ferne Wü – üste
aus diesem wu – underschö – önen Ort!«
Der Dicke trat zu mir ins Zimmer.
»Da bringt man Ihnen den Tee«, sagte er mir mit einem angenehmen Lächeln.
Der diensthabende Bursche im grauen Kaftan stellte auf einen alten Lombertisch den Samowar, die Teekanne, ein Glas mit zerschlagener Untertasse, ein Töpfchen Sahne und einen Kranz Bolchowscher Kringel, die so hart waren wie Kieselsteine. Der Dicke ging hinaus.
»Wer ist das?« fragte ich den Diensthabenden. »Der Verwalter?«
»Zu Befehl, nein: Er war bisher erster Kassierer und ist jetzt zum ersten Sekretär befördert.«
»Habt ihr denn hier keinen Verwalter?«
»Zu Befehl, nein. Wir haben einen Burmistr, Michailo Wikulow, aber einen Verwalter haben wir nicht.«
»Aber einen Gutsinspektor habt ihr doch?«
»Gewiß, einen Deutschen, Karl Karlowitsch Lindamandol, aber er redet nichts drein.«
»Wer redet denn drein?«
»Die Gnädige selbst.«
»So . . .! Nun, habt ihr im Kontor viele Menschen sitzen?«
Der Bursche dachte nach.
»Sechs Menschen sitzen da.«
»Wer denn?« fragte ich.
»Nun, da ist zuerst Wassilij Nikolajewitsch, der Hauptkassierer, dann der Schreiber Pjotr, Pjotrs Bruder Iwan – ein Schreiber – und ein anderer Iwan, auch ein Schreiber, Koskonkin Narkisow, auch ein Schreiber, dann ich – alle kann man gar nicht aufzählen.«
»Eure Gnädige hat wohl viele Leibeigene?«
»Nein, das kann man nicht sagen . . .«
»Wieviel sind es immerhin?«
»An die hundertfünfzig Seelen werden es sein.«
Wir beide schwiegen eine Weile.
»Nun, hast du eine schöne Handschrift?« fragte ich von neuem.
Der Bursche grinste mit dem ganzen Gesicht, nickte mit dem Kopf, ging ins Kontor und brachte ein beschriebenes Blatt.
»Das da ist meine Handschrift«, versetzte er, immerfort grinsend.
Ich sah hin – auf einem Viertelblatt grauen Papiers stand mit einer hübschen und großen Schrift geschrieben:
Verordnung
von dem herrschaftlichen Haupt-Hauskontor zu Ananjewo
an den Burmistr Michailo Wikulow. Nr. 209.
Es wird dir befohlen, sofort nach Empfang dieses zu untersuchen, wer in der vergangenen Nacht in betrunkenem Zustand und mit unanständigen Liedern durch den Englischen Garten gegangen ist und die französische Gouvernante, Madame Eugenie, geweckt und belästigt hat. Wie haben die Wächter aufgepaßt und wer war Wächter im Garten und hatte diesen Unfug zugelassen? Über alles Obenerwähnte hast du eine genaue Untersuchung anzustellen und dem Kontor unverzüglich Meldung zu erstatten.
Der erste Sekretär Nikolai Chwostow
Dieser Verordnung war ein ungeheures Wappensiegel mit der Inschrift ›Siegel des herrschaftlichen Haupt-Hauskontors zu Ananjewo‹ beigefügt; unten stand der Vermerk ›Genauest auszuführen, Jelena Losnjakowa.‹
»Das hat wohl die Gnädige selbst hingeschrieben?« fragte ich.
»Gewiß, sie selbst; sie tut es immer selbst. Sonst hat die Verordnung keine Wirkung.«
»Nun, werdet ihr jetzt diese Verordnung dem Burmistr zuschicken?«
»Nein. Er wird selbst herkommen und sie lesen. Das heißt, man wird sie ihm vorlesen; er versteht nicht zu lesen.« Der Diensthabende machte wieder eine Pause. »Nun«, fügte er grinsend hinzu, »es ist doch hübsch geschrieben?«
»Gewiß.«
»Aufgesetzt habe ich es, offen gestanden, nicht selbst. Darin ist Koskenkin Meister.«
»Wie . . .? Werden denn die Verordnungen bei euch erst aufgesetzt?«
»Wie denn sonst? Man kann sie doch nicht gleich ins reine schreiben.«
»Wieviel Gehalt bekommst du denn?« fragte ich.
»Fünfunddreißig Rubel und fünf Rubel für Stiefel.«
»Und bist damit zufrieden?«
»Natürlich bin ich zufrieden. Bei uns findet nicht jeder Anstellung im Kontor. Mich hat, offen gestanden, Gott selbst dazu bestimmt, mein Onkel ist der Haushofmeister.«
»Und hast du es gut?«
»Ja, gut. Um die Wahrheit zu sagen«, fuhr er mit einem Seufzer fort, »bei einem Kaufmann zum Beispiel hat es unsereiner besser. Bei einem Kaufmann hat es unsereiner sehr gut. Zu uns ist gestern abend ein Kaufmann aus Wenjew gekommen, sein Knecht hat es mir erzählt . . . Bei dem hat man es gut, da ist nichts zu sagen, sehr gut.«
»Zahlen denn die Kaufleute mehr Gehalt?«
»Gott bewahre! Er wird einen hinauswerfen, wenn man Gehalt verlangt. Nein, beim Kaufmann lebt man auf gut Glauben und in der Furcht des Herrn. Er gibt einem zu essen und zu trinken, gibt die Kleider und alles. Stellt man ihn zufrieden, so gibt er noch mehr . . . Was ist Gehalt? Man braucht gar kein Gehalt . . . Auch lebt so ein Kaufmann einfach nach russischer Sitte wie unsereins: Ist man mit ihm auf der Reise, und trinkt er Tee, so bekommst auch du Tee; was er ißt, das bekommst du auch. Der Kaufmann . . . wie kann man es nur vergleichen – der Kaufmann ist ganz anders als ein Gutsherr. Der Kaufmann hat keine Launen; wenn er böse wird, verprügelt er einen, und die Sache ist erledigt. Aber er schimpft nicht und brummt nicht . . . Mit einem Herrn ist es aber ein Unglück! Alles paßt ihm nicht, dieses ist nicht gut, und jenes ist schlecht. Reicht man ihm ein Glas Wasser oder eine Speise, so heißt es gleich: ›Ach, das Wasser stinkt! Ach, das Essen stinkt!‹ Man trägt es hinaus, steht eine Weile hinter der Tür: ›Nun, jetzt ist es gut, jetzt stinkt es nicht mehr.‹ Und erst so eine Gnädige! Oder erst ein gnädiges Fräulein . . .!«
»Fedjuschka!« ertönte die Stimme des Dicken im Kontor.
Der Diensthabende ging schnell hinaus. Ich trank mein Glas Tee zu Ende, legte mich aufs Sofa und schlief ein. Ich schlief zwei Stunden.
Als ich erwachte, wollte ich aufstehen, aber ich war zu faul; ich schloß die Augen, schlief aber nicht mehr ein. Hinter der Bretterwand im Kontor wurde leise gesprochen. Ich hörte unwillkürlich zu.
»Ja, so ist es, so ist es, Nikolai Jeremejitsch«, sagte die eine Stimme. »Ja. Das kann man nicht in Betracht ziehen; das geht wirklich nicht . . . Hm!« Der Sprechende hüstelte.
»Glauben Sie es mir, Gawrila Antonytsch«, entgegnete die Stimme des Dicken. »Wie sollte ich die hiesige Ordnung nicht kennen, urteilen Sie doch selbst.«
»Ja, wer sollte sie kennen, Nikolai Jeremejitsch; Sie sind hier, man kann wohl sagen, die erste Person. Wie ist es nun?« fuhr die mir unbekannte Stimme fort. »Was werden wir beschließen, Nikolai Jeremejitsch? Gestatten Sie mir die Frage.«
»Ja, was werden wir beschließen, Gawrila Antonytsch? Die Sache hängt doch sozusagen von Ihnen ab – Sie scheinen keine rechte Lust zu haben.«
»Aber ich bitte, Nikolai Jeremejitsch, was fällt Ihnen ein? Ich bin doch nur Kaufmann, unsere Sache ist der Handel. Wir leben ja davon, Nikolai Jeremejitsch, das kann man wohl sagen.«
»Acht Rubel«, sagte der Dicke langsam.
Ich hörte einen Seufzer.
»Nikolai Jeremejitsch, Sie fordern zuviel.«
»Es geht nicht anders, Gawrila Antonytsch; ich sage es wie vor Gott, es geht nicht.«
Ein Schweigen trat ein.
Ich stand leise auf und blickte durch eine Spalte in der Bretterwand. Der Dicke saß mit dem Rücken zu mir. Mit dem Gesicht zu ihm saß ein Kaufmann von etwa vierzig Jahren, hager und bleich, wie mit Fastenöl eingerieben. Er kratzte sich ununterbrochen den Bart, blinzelte sehr schnell mit den Augen und zuckte die Lippen.
»Wunderbar steht heuer die Wintersaat, das kann man wohl sagen«, begann er wieder. »Ich habe sie während der ganzen Fahrt bewundert. Von Woronesh an ist eine wunderbare Wintersaat, man darf wohl sagen, erster Sorte.«
»Die Wintersaat ist wirklich nicht schlecht«, antwortete der erste Buchhalter. »Aber Sie wissen doch, Gawrila Antonytsch, der Herbst kann noch so schön sein, alles hängt vom Frühjahr ab.«
»Es ist wirklich so, Nikolai Jeremejitsch; alles ist in Gottes Hand; Sie haben die reine Wahrheit gesagt . . . Ihr Gast scheint aber schon erwacht zu sein.«
Der Dicke wandte sich um . . . horchte . . .
»Nein, er schläft. Übrigens kann man auch . . .«
Er trat an die Tür.
»Nein, er schläft«, sagte er wieder und kehrte auf seinen Platz zurück.
»Nun, wie ist es, Nikolai Jeremejitsch?« fing der Kaufmann von neuem an. »Man muß doch das Geschäft einmal abschließen . . . Also meinetwegen, Nikolai Jeremejitsch, meinetwegen«, fuhr er fort, ununterbrochen mit den Augen zwinkernd, »zwei graue Scheine und einen weißen Schein kriegen Euer Gnaden, und dort«, er wies mit einer Kopfbewegung auf das Herrenhaus, »heißt es: sechsundeinhalb. Schlagen Sie ein?«
»Vier graue«, entgegnete der Buchhalter.
»Drei!«
»Vier graue ohne einen weißen.«
»Drei, Nikolai Jeremejitsch.«
»Dreiundeinhalb, keine Kopeke weniger.«
»Drei, Nikolai Jeremejitsch.«
»Kommen Sie mir nicht damit, Gawrila Antonytsch.«
»Wie unnachgiebig Sie doch sind«, murmelte der Kaufmann. »Dann schließe ich schon lieber mit der Gnädigen selbst ab.«
»Wie Sie wollen«, antwortete der Dicke, »hätten Sie das doch früher gesagt. Was sollen Sie sich beunruhigen . . .? So wäre es viel besser!«
»Ist schon gut, ist schon gut, Nikolai Jeremejitsch. Gleich werden Sie böse! Ich habe es doch nur so gesagt.«
»Nein, warum, im Ernst . . .«
»Ist schon gut, sage ich Ihnen . . . Ich sage Ihnen doch, daß es nur zum Spaß war. Nun, nimm deine dreiundeinhalb, was soll man mit dir machen.«
»Vier hätte ich nehmen sollen, habe mich aber, Dummkopf, übereilt«, brummte der Dicke.
»Also, dort, im Hause heißt es: sechsundeinhalb, Nikolai Jeremejitsch. Das Getreide wird also für sechsundeinhalb abgegeben?«
»Für sechsundeinhalb, das ist doch schon abgemacht.«
»Also, schlagen Sie ein, Nikolai Jeremejitsch.« Der Kaufmann schlug mit seinen gespreizten Fingern in die Handfläche des Buchhalters. »Mit Gott denn!« Der Kaufmann stand auf. »Ich gehe also jetzt, Väterchen Nikolai Jeremejitsch, zur Gnädigen, lasse mich anmelden und sage ihr: ›Nikolai Jeremejitsch hat zu sechsundeinhalb abgeschlossen.«
»Ja, sagen Sie es so, Gawrila Antonytsch.«
»Und jetzt wollen Sie es in Empfang nehmen.«
Der Kaufmann händigte dem Buchhalter ein kleines Päckchen Banknoten aus, verbeugte sich, schüttelte den Kopf, ergriff seinen Hut mit zwei Fingern, hob die Achseln, versetzte seinen Rumpf in eine wellenförmige Bewegung und verließ, angemessen mit den Stiefeln knarrend, das Zimmer. Nikolai Jeremejitsch ging zur Wand und begann, soweit ich sehen konnte, die Papiere, die ihm der Kaufmann eingehändigt hatte, durchzusehen. In der Tür erschien ein rothaariger Kopf mit dichtem Backenbart.