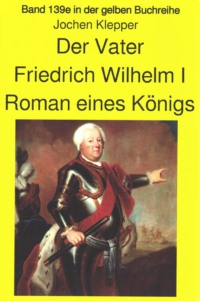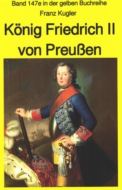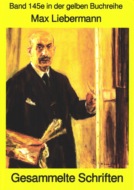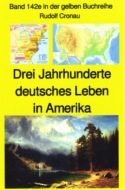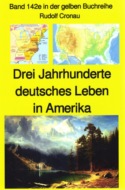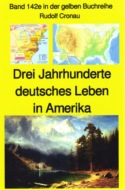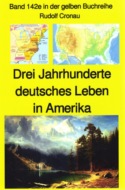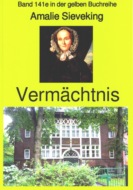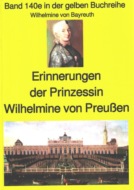Kitabı oku: «Jochen Kleppers Roman "Der Vater" über den Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I - Teil 2», sayfa 8
So unerträglich war es mit dem Herrn geworden. Alle meinten sie dasselbe, so verschieden auch die Absichten waren, die sie im Einzelnen verfolgten. Am klügsten gingen Seckendorff und Grumbkow vor. Sie gaben der Reise das Ziel. Grumbkow hatte dank des neuen Freundes keine Geldsorgen mehr; er hatte nunmehr einen freien Kopf; da konnte er alles so ruhig bedenken.
Er kannte des Königs seltsamen, unablässig sich steigernden Wunsch, einmal die Fäden der diplomatischen Gespinste zerreißen zu dürfen – wie ein Grumbkow recht pathetisch in der Modesprache sagte – oder einmal die Wälle der Pakte und Briefe beiseiteschieben zu können und mit den Partnern der Verträge von Angesicht zu Angesicht zu verhandeln. Am liebsten, und das wusste nicht nur Grumbkow, wäre Herr Friedrich Wilhelm zum deutschen Kaiser und zum König von England gefahren. Aber da könnte etwas Schönes angerichtet werden, meinten Seckendorff und Grumbkow. Um den Ausweg waren sie nicht lange verlegen.

König August I. von Sachsen – 1670 – 1733
Herr August der Starke, Kurfürst von Sachsen und König von Polen, war gerade in der rechten Schwebelage, die man brauchte, um dem Preußenkönig ein Exempel zu liefern. Gerade Herr August der Starke lavierte gar so geschickt zwischen Wien und Paris; zwischen Warschau und Dresden; zwischen reichsständischen Pflichten und den autonomen Herrscherrechten; zwischen den Rücksichten auf das protestantische Bekenntnis, das er verließ, und dem Eifer für den katholischen Glauben, den er annahm. Da war es wohl gut, wenn der Grübler und Querkopf Friedrich Wilhelm einmal sah, dass andere Regenten in viel schwierigerer Lage ihr Land doch keineswegs die eigenen Gewissenskonflikte oder taktischen Fehler, was meistens das Nämliche schien, ausbaden ließen... In Dresden war Glück und war Glanz! Aber auch wenn es nicht das politisch Vorteilhafteste gewesen wäre, kam kein Hof als Reiseziel so sehr in Frage wie der Dresdener.
König Augustus brauchte man nicht lange und umständlich dafür zu gewinnen, die Einladung an den Berliner Nachbarn ergehen zu lassen. Er war immer entzückt, Gastgeber sein zu können. Denn Dresden nannten sie Die Insel Cythere, das Freudeneiland Aphroditens.
Herrn von Grumbkow beschäftigte noch die Frage, inwieweit die Göttin Aphrodite wohl fähig sein könne, die tugendhafteste Fürstenehe Europas auseinanderzubringen; denn das wäre ein nicht unbeachtlicher Nebeneffekt und der halbe Sieg der Kaiserlichen gewesen. Er schien nicht völlig unerreichbar. Durch die Kammerfrau Ramen verlautete, dass die allertugendhafteste Fürstenehe wohl überhaupt nicht mehr bestünde.
Eigentlich hatte es auch niemand mehr angenommen, dass hier noch eine wahre Ehe sei; so, wie Ihre Majestät sich über die „mögliche Verstandesverrückung“ ihres Gatten äußerte... Ein Ehebruch aber musste den bigotten König innerlich vernichten und wehrlos machen gegen die, welche ihn zu kennen und zu leiten glaubten. Der Polenkönig und Sachsenkurfürst zu Dresden war im Bilde, was mit dem frommen Bruder Wilhelm zu geschehen hatte. Es sollte aber, war er instruiert, wirklich die Schönste am Hofe sein; denn des düsteren Königs Ragotin des Öfteren bemerkter Schönheitssinn sei geradezu fanatisch.
Die Dame heiße Formida, meldete August der Starke zurück.
* * *
Eines Tages bemerkte der Prediger Roloff, Majestät würden zum Mönch und suchten Gott durch Selbstkasteiung zu gefallen. Da nahm der König die Dresdener Einladung an. Er wollte ganz rasch reisen. Beinahe etwas wie Freude kam über ihn: Er war vierzig Jahre alt! Noch viele Jahre konnten ihm sehr vieles wandeln! Er sollte ein fremdes Land mit dem eigenen vergleichen, sollte zum ersten Male Gast an einem anderen Hofe sein! Was nur der Freund in Dessau zu dem plötzlichen Entschlüsse sagen würde! Kaum reichte noch die Zeit zu ein paar Zeilen. Er diktierte: „Ich gehe Dienstag nach Dresden, hoffe bald wiederzukommen. Da werde ich so viel Neues wissen. Ich freue mich, in eine andere Welt zu kommen, weil ich curieux bin und nach meinem Penchant die ganze Welt durchreisete.“
Aber niemals hatte er sich die Zeit genommen; immer hatte er nur die fremden Verfassungen studiert; immer hielt ihn ‚Der König von Preußen‘ im Dienst.
Übrigens wusste er noch gar nicht, dass er nicht allein fuhr.
In letzter Stunde hatte es Prinzessin Wilhelmine beim sächsischen Gesandten so zu arrangieren gewusst, dass der Kronprinz noch aufs dringlichste eingeladen wurde. Der Vater sollte ihn mit neuen Augen sehen lernen. Das war die große Hoffnung der Prinzess. Friedrich würde sich im kultivierten Dresden so sicher bewegen! Der Vater würde ihn als jungen Prinzen unter anderen jungen Prinzen betrachten!
Es war nichts von Diplomatie und Intrige in ihren Plänen; es war lediglich Zuneigung zum Bruder, der immer nur regieren lernen sollte.
Der Vater nahm es freundlich auf. Fritz sollte in Dresden gute Figur machen. Er befahl ihm, sich schleunigst einen goldbetressten blauen Rock und sechs Livreen für seine Dienerschaft anfertigen zu lassen.
Der Königin erschien es zu wenig. Aber im Ganzen war sie sehr zufrieden über diese Wendung. Wenigstens versicherte sie es dem französischen Gesandten Graf Rothembourg.
Umständlich legte sie ihm die Maßregeln dar, die ihr gut schienen, falls der König in Geistesumnachtung fiele; falls Dresden ihn doch nicht zu kurieren vermöchte.
Der französische Gesandte erwiderte, das seien zwecklose und gefährliche Unterhaltungen; und die geringste Indiskretion könne Ihre Majestät den härtesten Maßnahmen aussetzen. Zugleich aber gab er ihr Ratschläge.
„Die klügste Haltung ist fürs nächste, dem Kronprinzen gute Gesinnung einzuflößen und ihn dahin zu bringen, ebenso viel Güte gegen jedermann zu zeigen, wie sein Vater Härte zeigt, vor allem aber mit den Freunden der kaiserlichen Partei sich äußerlich gut zu stellen, damit sie dem König nicht mit einem Schein von Recht einblasen, man wolle eine Partei des Kronprinzen gegen ihn schaffen.“
Das Wort war gefallen: Partei des Kronprinzen; das Wort, von dem die Königin nun nie mehr loskam.
Ihren geliebten Jungen lud sie am Tage vor dem Aufbruch gleich nach Tisch zum Kaffee zu sich, für den Fall, dass er die Tragweite seiner Reise doch noch nicht ganz zu überschauen vermöchte.
„Es ist überaus wichtig“, begann die Mama, „in fremdem Lande mit den dortigen Gesandten jener Mächte zusammenzutreffen, mit denen man hier nur befangen zu verhandeln vermag. Der englische Gesandte, der französische Resident, der kaiserliche Bevollmächtigte in Dresden können dir dienlicher sein als die Vertreter dieser Höfe in Berlin. Jedes deiner Worte am sächsischen Hofe wird mit ungleich größerem Gewicht nach Wien, Paris und London gemeldet werden.“
Friedrich fand Mama nun doch erstaunlich weitblickend. Und als sie ihn, den Träger aller ihrer Hoffnungen, mit heißen Küssen bedeckte, war er bewegt. Wahrhaftig, es musste ja anders werden in Preußen! Und jetzt ergab sich vielleicht auch ein Weg. Jetzt kam er an Deutschlands glanzvollsten Hof. Und die Diplomaten warteten mit Spannung.
Halb lächelnd, halb weinend sprach die Mutter, ihn umarmend, etwas sinnlos, aber gerade darum rührend, auf ihn ein: „Tu etwas dagegen – versuche etwas, dass dir die schwarze Melancholie nicht derart aus den Augen sieht, wenn du in Dresden bist –!“
Aber Friedrichs Augen blitzten jetzt schon ganz vergnügt. Nur entsetzlich schwächlich sah er aus: ruiniert für 'Den König von Preußen'.
Er war nicht wie ein Sohn dieser blühenden Mutter.
* * *

Die Könige August von Sachsen und Friedrich Wilhelm I von Preußen in Dresden
Siebenmal war man nun schon zur Redoute, vierzehnmal war große Tafel, drei maskierte Schlittenfahrten hatten stattgefunden, zweimal waren sämtliche Paläste Dresdens illuminiert, fünfmal wurde die Komödie besucht – und da fragte dieser unglückselige Preußenkönig ein bisschen erstaunt, ein wenig traurig und doch wieder auch in dieser merkwürdig hochmütigen, schnarrenden Art, wann denn nun die versprochene Lust eigentlich angehe?
Einigen Herren seines Gefolges machte das allerdings einen mächtigen Eindruck. Plötzlich schnarrten und näselten die armen Brandenburger alle und vermissten die versprochene Lust, obwohl sie doch bis dahin den ungewohnten Champagner, den Pfropfentreiber, das Wunder der Abtei von Hautes Villers, gar so bestaunten und sich in ihren knappen, blauen, propren Röcken fast kindlich brav ausnahmen neben den lockenumwallten, seidenumrauschten sächsischen Herren und den Lateinisch sprechenden Polen in ihren langen Mänteln mit sehr weiten Ärmeln, den tief herabhängenden, dünnen Schnurrbärten und kahlgeschorenen Köpfen.
Die auswärtigen Gesandten zeigten ein reges Interesse an der Blasiertheit des Königs von Preußen; dies hatte man am wenigsten erwartet.
König Augustus war beunruhigt, dass zum ersten Male all die selbsterdachten Wunderwerke seiner Feste nicht bestrickten, überwältigten, betäubten. Weil ihm die Festesfolge der vergangenen Tage nicht genügte, hatte er nun für den späten Abend noch die Begegnung seines Gastes mit der schönen Formida angesetzt. Vielleicht war noch bestimmender gewesen, dass die verwöhnte junge Dame bereits unwillig war, erst so spät in Erscheinung zu treten und darum an all den Feierlichkeiten des Hofes noch immer nicht teilnehmen zu dürfen.
Die Elbe lag im Eis. Droben von den Palästen am Ufer her blitzten die Lichter über sie hin, wenn ein Portal sich öffnete oder Fackelträger einer Sänfte entgegeneilten, ihr den Weg zu erhellen.
Man begab sich in einen Flügel des Schlosses, der bis dahin den Gästen noch nicht aufgetan worden war. Die Türen hier waren noch weiter, die karrarischen Gesteine der Stufen noch reiner, die Kandelaber noch reicher und strahlender; und das Heer der marmornen Götter, die den Weg der Fürstlichkeiten säumten, wuchs von Saal zu Saal ins Unermessliche. Auf den Emporen der Galerien trommelten, pfiffen, trompeteten Hunderte von Janitscharen, schlugen Becken, schwangen Schellenbäume. Aus dem Gewirr der Säulen traten, Fleisch und Blut und süßer Duft geworden, die Göttinnen goldener Zeitalter, mitten im tiefen Winter der Menschen mit den Blumen arkadischer Gefilde umkränzt, Weinlaub um Brüste und Hüften. Die reichten den Irdischen ihre Schalen mit Nektar, dessen Hauch schon die Sinne entflammte und dessen Glanz die Feuer der ewigen Freude im Blute der Sterblichen aufschlagen ließ. Mohren, schlank und gewaltig, Söhne der Sonne, völlig in Silber gekleidet, trugen hoch erhoben über ihren Häuptern goldene Urnen, darin arabische Hölzer berauschend verglimmten. Aus allen Sälen drangen die Weisen der Geigen und Hörner; die edlen Knaben, die blühenden Frauen lösten sich aus dem Zuge der Schreitenden, traten in den Reigen, vermengten sich den Sarabanden und Chaconnen, entzückten sich und alle, die es sahen, an Courante und Gigue – es war ein Tanz ganz ohnegleichen: unendliche Begeisterung der Blicke, Herzen, Sinne.
Nacht und Jubel wurden immer tiefer. Es war nur noch ein enger Kreis von Männern, die miteinander durch die Hallen schritten: die beiden Könige, ihre Söhne und wenige Große ihrer Höfe. Seltsamerweise hatte Friedrich Wilhelm das Kostüm eines Bauern aus dem hohen Norden gewählt, indes Augustus in antikischer Toga einherschritt; er fand die größte Beachtung seines brandenburgischen Gastes, nur galt sie nicht seiner klassischen Maskerade: die römische Kühnheit seiner Stirn und Nase gab dem Nordlandsbauern zu denken.
Manchmal blieb der Römer Augustus stehen, denn sein rechtes Bein schien den Giganten gar nicht mehr recht zu tragen, und ein Augenlid sank ihm beim Sprechen und Lauschen müde herab. Das Lächeln, das um seine Lippen lag, ließ ihn noch älter erscheinen, als er war.
Vielleicht war es besser, als König im Bauernkittel über diese Erde zu pilgern.
Der schöne Graf Rutowsky, sein jüngster und heiterster Bastard, suchte dem Römer und seinem Gaste aus dem Nordland den Weg durch all die tausend Wunder; gerade zu diesem festlichen Tage hatte er es mit seinen zweiundzwanzig Jahren auf die gleiche Anzahl fröhlicher Bankette gebracht wie sein hoher Herr Vater. Er lachte und schwatzte, dass es die ernsten Brandenburger fast noch mehr als all die anderen bezwang.
Langsam verlöschten darüber die Kerzen.
Aus der Höhe der Pfeiler, von Spiegeln vertausendfacht, begannen Monde, Sterne und Kometen bläulich und silbern zu schimmern; und neue, nie gehörte Klänge schwebten in den Gewölben der leuchtenden Kuppeln auf. Weit in der Ferne, am Ende der Pforten und Stufen, schwoll Gesang an, steigerte Glanz und Schimmer sich zur Sonnenhelligkeit. Kaskaden von fließendem Feuer sprühten auf, und als sie zerrannen, ward Nacht, Nacht ohne Glanz und Gesang. Aber die Schwüle aller Sommerdüfte strömte aus den Alabasterbecken der versiegten Fontänen. Von Brunnen zu Brunnen wachsend, sich immer klarer aus silbernem Nebelhauch lösend, schwang sich die Mondessichel schmal und weit und edel von Schale zu Schale. In ihrer Tiefe ruhte die Göttin des Mondes, Selene. Perlengleich schimmerten ihre Glieder. Goldstaub glänzte auf den gesenkten Lidern. Alle Blumen der Nacht umschlossen ihren Schoss in sanftem, losem Kranz. Auf den Brüsten blitzte Tau der Diamanten. Aber lichter als die Edelsteine war der Glanz ihres Leibes.
Alle um den Preußenkönig wichen leise zurück. Allein stand er vor der Sichel Selenes, dem himmlischen Ruhebett am Saume der Ewigkeit. Lächelnd hob die Göttin des Mondes die Arme. Noch immer waren ihre Lider tief gesenkt.
„Sie ist sehr schön. Das muss man gestehen“, sagte der König von Preußen und betrachtete sie ruhig, so wie er auch die Brunnenbecken und die blühenden Gewinde zwischen den Säulen sich aufmerksam ansah. Aber plötzlich fuhr er zurück, riss Grumbkow den Hut unter dem Arm hervor und drückte ihn dem jungen Sohn vors Gesicht. Er stieß den Sohn zum Eingang zurück. Er wendete sich ab. Er schritt die Stufen zum oberen Saale empor. Noch schwebten Gigue und Courante, Chaconne und Sarabande durch den Palast. Die Treppe, von Fackeln und marmornen Göttern gesäumt, drangen die Züge singender Masken herauf und umschwärmten den König von Preußen. Er ging durch sie alle hindurch. Den Bauernkittel streifte er im Gehen ab. Er kehrte zu Fuß in Graf Flemmings Palais zurück, in dem er Aufenthalt genommen hatte. Er verschloss seine Zimmer.
* * *
Morgens ließ der König Herrn von Grumbkow holen. Der zog die Sache ins Scherzhafte. Aber der König nahm einen recht ernsten Ton an und befahl ihm, dem König von Polen in seinem Namen zu sagen, dass er ihn sehr bitte, ihn dergleichen Vorfällen nicht mehr auszusetzen, wenn er nicht wolle, dass er Dresden auf der Stelle verlasse.
Der Polenkönig und Sachsenkurfürst lachte sehr vergnügt darüber, ging sogleich zu Friedrich Wilhelm und entschuldigte sich bei ihm. Er nahm aber, wie er es auszudrücken pflegte, wahr, dass den König von Preußen seine ernsthafte Miene nicht verließ, und so brach er denn die festgefahrene Unterhaltung ab und fing ein anderes Gespräch an. Sofort war König Friedrich Wilhelm es zufrieden. Denn er suchte Diskurse mit König Augustus. Die Dresdener hatten erwartet, dass der Preußenkönig – der Pastorenwirt von Wusterhausen, der Korporal von Potsdam, der Wildschweinhändler von Königsberg – von Herrn August dem Starken eine Rechtfertigung seines Namens verlangen würde: Kanonenstrecken, Talerbrechen, Eisenbiegen. Und allenfalls mochte er sich wohl auch nach dem erheblichen Darlehen erkundigen, das der Bruder August von ihm erhielt.
Herr Friedrich Wilhelm aber hatte nur ernste Fragen an den Galant und Athleten zu stellen: Besitzen solche Feste wie die Dresdener Bacchanale einen Wert für das Volk? Kommen viel Fremde ins Land, sie zu sehen? Zirkuliert dann wohl neues Geld? Schaffen sie dem Handwerk Arbeit? Oder werden die Untertanen dadurch belastet? Endlich aber: Wird die Via regia von Dresden nach Warschau einen Schnitt durchs Deutsche Reich bedeuten, an dem es verblutet, oder wird sie ein Weg zum Frieden der Völker im Osten des erschütterten Europa werden?
Etwas an dem Nachbarmonarchen schien Herrn Friedrich Wilhelm groß trotz all des Verwerflichen, das Augustus umgab.
Schenkte nicht die Feierlichkeit seiner Bauten den Menschen das Bewusstsein einer neuen Würde und den Triumph erreichter Ziele, während sie noch mitten in den ersten Mühen standen? Warb seine Heiterkeit nicht dauernd um Liebe, während er noch Last um Last auferlegte? Breiteten nicht seine Feste alle Leichtigkeit des Lebens über seinem Lande aus, während es noch hingegeben war an die ungewisseste Zukunft? Das Leben des geringsten Mannes und des nüchternsten Werktags war ins Gefüge seiner Feste einbezogen. Die Menschen um Augustus sahen glücklich aus. Das presste dem König von Preußen das Herz ab. Er fand die Leichtigkeit des Lebens nicht. Ihm wies es überall nur Forderungen. Ihm gab es kein erreichtes Ziel. Die Menschen um Augustus wurden von einem lächelnden Zauberer in Wunderlande getragen. Friedrich Wilhelm aber erschreckte sein Volk, war Tyrann, Lastträger, Bettelkönig in einem. Klötze und Stämme musste er roden, Pfützen ausfüllen, der grobe Waldrichter sein, der die Bahn brechen und zurichten musste für etwas, das allein in seinem Denken bestand und das er niemals zu zeigen vermochte: Siehe, da ist es, Luthers Worte hatten sich ihm schmerzhaft eingeprägt.
Augustus war Verschönerer, Bezauberer, Beglücker. Über Schuld und Übel schritt und trug er hinweg; alle Welt um ihn war höchste, letzte Blüte. In Friedrich Wilhelm war die Schwere alles Wachstums und die verborgene Last der künftigen Fruchtbarkeit. Auch in dieser Stunde sank die Schwermut wieder über ihn. Ihm kam der Gedanke daran, wie er sich einmal Bußpredigten für den Polenkönig zurechtgelegt hatte, den er bis dahin immer nur den „Kleiderständer“ schimpfte. Nun stand er selbst als Büßer vor dem Strahlenden, „dem kein Schaden, kein Verlust noch Klage in den Gassen war“.
Er war geneigt, Augustus einen der größten Fürsten der Erde zu nennen.
Bitter neidete er ihm den Sohn, der die Verhandlungen des Vaters so ernst und streng verfolgte, seine Rechnungen prüfte und daneben auf der Einhaltung aller ärztlichen Vorschriften für den Vater bestand. Dass einer jeden Tag mit seinem ganzen Hause betete, das machte wohl nicht Söhne nach dem Willen Gottes; und ein nur geringer Trost lag darin, dass in Dresden, wie er hörte, „des preußischen Königs und Kronprinzen überall hervorleuchtender Religionseifer und Kirchengehen einen großen Eindruck gemacht habe“. Ach, über Brandenburgs vermessenen und gequälten Glauben! Hier, hier war die Verheißung zugleich schon Erfüllung: in diesem Lande blühte selbst der Stein als Akanthusgeranke, und alle klaren Wasseradern der Erde sprangen als Fontänen auf.
Er aber war der Herr und Knecht des Sandes und der Sümpfe.
König Friedrich Wilhelm war es kaum bewusst, dass er, wenn er aufgestört und beunruhigt war, immer wieder denselben Versuch unternahm, sich ein Gleichgewicht zu erkämpfen: er schrieb an den Dessauer Freund.
Sein letztes Dresdener Schreiben geriet sogar noch besonders ausführlich.
„Ich gehe nun nach Hause, fatiguieret von alle guthe Dage und Wohlleben, aber Gott ist mein Zeuge, dass ich kein Plaisir daran gefunden. Die hiesige Magnificence ist so groß, dass ich glaube, sie habe bei Louis XIV. ohnmöglich größer sein können. Und was das liederliche Leben betrifft, so kann ich in Wahrheit sagen, dass dergleichen noch nicht gesehen, und wenn der selige Francke lebte und hier wäre, würde er es nicht ändern können.
Was der Karneval und Weltgetümmel ist, hab' alles gesehen, dass ich davon sprechen kann, aber kein gusto gefunden; ich werde wiederkommen als ich hingegangen bin, Gott hat mir bewahret, die Verführung fehlet nit, das lasse ich mündl zu besprechen. Das Zeughaus ist gut fourniert, aber das bei uns ist tausendmal besser. Was das Grüne Gewölbe ist, cela éblouit, meinem Vater seine Juwelen ist nits dagegen –.“
Er erzählte und bestaunte, kritisierte und moralisierte, kritzelte und kleckste. Nur das eine, Wichtigste vermochte er auch vor dem Freund nicht zu erwähnen – nämlich, dass Fritz am Weltgetümmel und insbesondere am Prinzendasein „gusto fand“ und nicht mehr wiederkehrte, wie er hingegangen war. Der Vater hatte seinem Sohn bei dem Anblick Formida-Selenes den Hut vor sein Gesicht gepresst; aber vor manch anderem hatte er ihn nicht zu bewahren vermocht.
Nun wusste Friedrich, was einem Kronprinzen zukam. Er hatte Höflichkeiten erfahren, wie sie ihm selbst die Märchen der Mutter nicht beschrieben. Er hatte unter jungen Fürsten und fröhlichen Königsbastarden gelebt. Er hatte Töchter aus königlichem Blute in weißseidenen Knabenanzügen und kurzgeschnittenen schwarzen Locken umherlaufen sehen, sich als die Mätressen ihres Vaters rühmen hören und dabei der Schwestern gedacht, die auf Wusterhausen hinter dem mütterlichen Wandschirm lasen, lernten und Stickereien für Herrn Pastor Freylinghausens Waisenhaussaal anfertigten. Er hatte erfahren, wie man jedem seiner Worte ungeheure Bedeutung beimaß. Er hatte begriffen, was es hieß – der Neffe des Königs von England und vielleicht dereinst sein Schwiegersohn zu sein. Er hatte mit Diplomaten höchst doppelsinnig philosophiert und nannte sich in seinen Dresdener Briefen an die älteste Schwester „Frédéric le pfilosophe“. Aber „pfilosophe“ war er zurzeit am wenigsten. Er war ein junger Fürst, er war ein Diplomat geworden. Und philosophisch war er nur gestimmt gewesen, wenn er sah, wie sein harter Herr Vater den Königsbastarden zu Dresden mit so viel Höflichkeit und Güte begegnete.
Er fragte sich viel, als er von Dresden kam, der Prinz. Nur fragte er nicht danach, warum der Papa bei König Augustus den Flötenspieler Quantz für ihn ausbat, „Quantz, der die Querflöte spielt, einen großen Komponisten, der durch seinen Geschmack und seine erlesene Kunst die Flöte der schönsten menschlichen Stimme ebenbürtig gemacht hat“.
Es musste während des sächsischen Karnevals Stunden gegeben haben, in denen der Bettelkönig seinem Sohn ein fürstlicheres Dasein zuzugestehen bereit war; Stunden, in denen er ihn erfreuen wollte, wie Augustus seinen einzigen Sohn und seine Bastarde erfreute; und als Friedrichs edelstes Vergnügen sah er, ohne sich nur einen Augenblick zu bedenken, die Musik an. Außerdem fand er aber Friedrichs bisherigen Musikunterricht unzulänglich und erklärte, als er um den Meister Quantz bat, es müsse ein Ende haben mit dem abscheulichen Gepfeife daheim. Oder wollte er sich hinter solch rauer Wendung verbergen?
Der Kronprinz vermutete allein den Einfluss der Mama bei dem König von Polen; er hätte gern ihre Briefe an König Augustus gelesen, in denen sie einen Quantz von ihm erflehte. Auch in Dresden kam ihm alles Glück von Monbijou. Ohne Monbijou wäre der Gedanke an die Heimkehr unerträglich gewesen. Monbijou wenigstens war doch ein Hof.
In hundert Einzelheiten prägte Friedrichs Wandlung sich aus. Schon auf der Rückfahrt wurde es deutlich. Der Sohn war indigniert, dass der Vater sich nicht auf den Schlössern des Adels ansagte, sondern in öden Dorfkrügen Rast hielt.
Einem aber hatte Friedrich vorgebeugt. Er dachte gar nicht mehr daran, mit den derben, zweizinkigen Stahlgabeln zu essen, die in den deutschen Wirtshäusern üblich waren und eher einer Waffe ähnelten. Er hatte sich in Dresden ein Besteck mit dreizinkiger silberner Gabel besorgen lassen. Gemächlich nahm er es bei Tisch aus dem Etui. Alle in der Wirtshausstube blickten auf ihn; das ganze Gefolge gab acht, was wohl geschah. Denn alle waren sich im Klaren: Der Gebrauch der Silbergabel bedeutete die offene Kampfansage an die väterliche Lebensweise und allen altväterischen Brauch zu Potsdam und auf Wusterhausen.
Der König nahm dem Sohn die Gabel aus der Hand, so heftig, dass Böswillige sagen konnten: er schlug sie ihm aus der Linken.
Es schien einzureißen, dass man die Königliche Hoheit, die man zu Dresden so umworben sah, zu bedauern begann. Herr von Grumbkow, wie er sagte, suchte zu vermitteln. Er erklärte dem verstimmten Herrscher, des Kronprinzen Humeur sei doch nun einmal auf Generosität, Gemächlichkeit und Magnificence sowie auf eine glänzende Zukunft gerichtet. In einem einzigen Satze häufte er die Worte, die der König hasste: Generosität, Gemächlichkeit, Magnificence, glänzende Zukunft.
Was musste ‚Der König von Preußen‘ dazu sagen!
Nach Tisch beschloss der König, seine Reiseroute abzuändern. Der einzige Aufenthalt, der noch an einem Hofe vorgesehen war, sollte abgesagt werden. Der König schickte eine Eilpost nach Dessau, er würde Anhalt auf seiner Heimfahrt nun doch nicht berühren. Die Gründe konnte niemand erfahren. Selbst der Fürst von Anhalt-Dessau wurde mit der Erklärung abgespeist, es gehe nun wieder Hals über Kopf in die Arbeit. Die Wahrheit wollte König Friedrich Wilhelm ganz in sich verschließen: dass er gerade jetzt die Wärme des Familienlebens in diesem Fürstenhause nicht ertrug, in dem noch alles Wirklichkeit war, was sich auf Wusterhausen längst als Lüge erwies. Er wollte nicht zu den dessauischen Winterjagden, jetzt nicht. Er sah zu deutlich vor sich, wie die lachenden Riesensöhne, dicht um den herrlichsten Vater geschart, auf Schimmeln, Füchsen und Rappen all den anderen Jägern des Hofes voranstürmten. Er kannte die Strecke, die der Dessauer und seine Jungen zum Jagdschluss an den Waldsaum legten – wilde Reiter waren sie, verwegene Jäger, lustige Brüder, brave Junker, tapfere Offiziere allesamt, wie die Jahre sie auch trennen mochten: der Moritz, Wilhelm und Eugen, der Dietrich und der Maximilian Leopold, für den der König eine „personelle Liebe“ hatte.
Die „Weltlust“ war zu Ende. Schon auf der Heimfahrt musste Friedrich wieder die Regierung erlernen und mit dem Vater eine überaus umständliche Rückreise machen, in Dorfgasthäusern mit der zweizinkigen Gabel essen, öde Siedlungen und kahle Fabriken besichtigen und allerorts die Niederlassungen der aus den verschiedenen Ländern gekommenen neuen Einwohner selbst in Augenschein nehmen. Indessen ließ der Papa die Magnificence seiner Zukunft sich und ihm entgleiten, indem für eine Auswertung der diplomatischen Begegnungen, die der Kronprinz in Dresden gehabt hatte, keine Zeit mehr blieb.
Nun ja, fand der Kronprinz von Preußen, als er betrachtete, was der Vater ihm wies, es sind gewiss ganz schöne Erfolge eines kleinen Fürsten... Papa hatte einen unglückselig engen Zuschnitt gewählt. Aber er, der Thronfolger, wusste: Preußens Zukunft lag bei dem großen Hause der Mutter, entschied sich weit über dem Meer und nicht in diesen dürftigen Kolonien, die Papa so lächerlich wichtig nahm. Nur in gewisser Hinsicht waren die abscheulichen Reisen mit Papa ganz außerordentlich lehrreich und lohnend. Denn das wusste er nun fest: Der Vater war im Lande verhasst. Jeder Winkel seines Reiches litt – genauso wie der Hof – unter seiner Schwermut, seiner Bigotterie, seiner maßlosen Arbeitswut und tötenden Sparsamkeit.
Beamte, die nach Preußisch-Litauen versetzt werden sollten, weigerten sich sogar in offenem Widerstand; und selbst die Bauern wussten ihrem Wohltäter keinen Dank. Nach des Königs Weise sollte jahraus, jahrein gepflügt, gesät, geerntet und gedroschen werden, und das Lernen und Mühen nahm kein Ende.
Warum der Adel gegen den Vater rebellierte, warum die Geistlichkeit ihm opponierte, warum die Diplomatie ihn derart ablehnte, aus welchen Gründen die Wissenschaft seine ganze Existenz am liebsten kraft abstrakter Spekulationen und Schlüsse ableugnen wollte – dies alles war der jungen Königlichen Hoheit aus den Kreisen des mütterlichen Hofes bis in jede Einzelheit bekannt.
Nun aber, nach den ersten Reisen mit dem Vater, wusste Prinz Friedrich, wie es um den Papa und jene Leute stand, mit denen er tat, als wären sie anstatt des Adels die Träger seines neuen Staates. Nun erfuhr der Knabe, was es mit den Bauern, den Bürgern, den Soldaten auf sich hatte. Niemand in Preußen machte die Narrheiten des dicken, frommen Königs gern und aus freien Stücken mit. Die Stimmung war schlecht. Kein hartes, zorniges Wort, zu dem sie jemals den von Arbeit Erschöpften, von Sorgen Aufgeriebenen absichtlich, gereizt und herausgefordert hatten, war in Vergessenheit geraten. Sie kamen alle dem Sohne nun wieder zu Ohren.
„Sie sollen nach meiner Pfeife tanzen, oder der Teufel hole mich. Ich lasse hängen und braten wie der Zar und traktiere sie wie die Rebellen.“
So hatte der König gedroht.
„Wir sind doch Herr und König und können tun, was Wir wollen.“ So hatte der Bettelkönig geprahlt.
Verborgen blieb, was er dem Freunde schrieb, wenn ein Tag so harter Rede sich neigte: „Gott ist bekandt, dass ich es ungern tue und wegen die Berenheuter zwey Nächte nit recht geschlafen.“
Den französischen Gesandten Graf Rothembourg überschüttete Friedrich nach seiner Heimkehr mit Höflichkeiten, ihn verlangte danach, in Sparta fortzusetzen, was er auf der Insel Cythere begann. Er versicherte dem Grafen, er wisse, wie sehr er die Partei seines britischen Oheims ergreife.
Die Kaiserlichen wollten, als sie den Kronprinzen so oft bei dem Franzosen trafen – denn gesellschaftlich verkehrte man ja so reizend und so rege miteinander –, auch ein bisschen von den Reiseplaudereien Seiner Königlichen Hoheit profitieren. Sie umwarben Friedrich sehr. Aber leider hatte Graf Rothembourg nun für Frankreich schon die besseren Informationen. Die Pariser trauten ihren Augen kaum, als sie jetzt von seiner Feder lasen: „Der König ist nach den Worten seiner eigenen Untertanen ein Fürst ohne Plan und System, der sprunghaft verfährt und von einem Extrem ins andere fällt. Er ist bei allen Ständen seines Landes gleichmäßig verhasst. Um den Vater zu entwaffnen, müsste man dem Kronprinzen eine Partei schaffen und eine Anzahl von Offizieren auf seine Seite bringen. Ich glaube, das würde gelingen. Jedenfalls müsste man den jungen Prinzen in einer für Frankreich günstigen Gesinnung erziehen. Ich tue neuerdings so, als ob ich nie mehr mit ihm spräche. Aber ich habe mehrere sichere und zuverlässige Wege, um ihm alles zukommen zu lassen, was ich will, und um Nachrichten von ihm zu erhalten.“