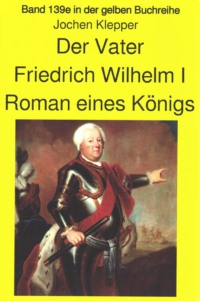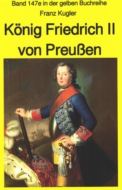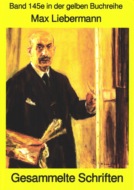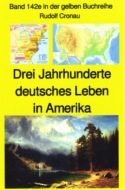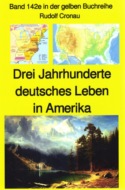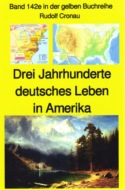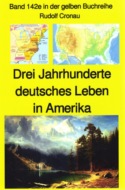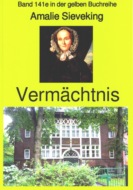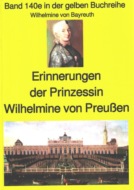Kitabı oku: «Jochen Kleppers Roman "Der Vater" über den Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I - Teil 2», sayfa 7
„Budopöhnen ist abgebrannt – die Haushaltung ist sehr schlegt – aber ich frage nits mehr danach – wenn dieses jahr vorbey ist höre auf zu wirdtschaften –“, so las der Fürst im Briefe des Königs, „in die vierzehn Jahre nits gemacht zu haben und alle meine Mühe, Sorge, Fleiß, Geld, alles umsonst – itzo das Geld und Zeit verspillert und ins Meer geworfen, gehet mir nahe. Wenn die vierzehn Jahre wieder hätte, à la bonheur, aber die sein fort, ohne was zu tun. Wenn ich es veroperiert und Redouten, Komödien gemacht hätte, so wüsste noch wovor, aber ich habe nits als chagrin, Sorgen gehat, das Geld auszugeben, ergo ich mich sehr prostituieret habe vor die Welt und ich vor fremde Leute nit gerne höre von Preußen sprechen, denn ich mich schäme.
Gott hat mir bewahret, sonste hette ich müssen nerisch werden vor simf und mockerie vor die ganze Welt – mit Gottes hülfe so werde mir doch wieder herraußen helfen das die Machien nicht übern hauffen gehe – aber adieu verbessern das bissgen was ich zu lehben habe will in stille lehben und von die weldtl Sachen nur so wenig meliren als mein Schuldigkeit und ehre es leiden wierdt. Lottum trinkt vor Kummer und Sorgen und beseuffet sich teglich den chagrin sich zu Passier, da bewahre Gott mir davor.
Anfein ist es als wen Gott nit haben wollte, das das arme Landt in flohr komen sollte, wenn ich die Wasserfluhte selber nit gesehen ich es nit geglaubet hatte den ich meine Dage nit so wahs gesehen, dieses Wetter ist die leze Öllung vor Preußen.
Ich bin meine Preußische Haushaltung mühde ich kriege nichts an contrer erschoppe mich und mein übrige lenter mit Menschen und Geldt.
Dieses nun baldt aufhöhren oder mei Bankeruht ist da.
Es ist da alles so desperat und miserable das ich nicht weiß ander zu sagen als das Gott ein Fluch über das Landt gesicket habe.
Will Gott nit – ich meretiere es nit besser – ich gehe in mich, denn ich habe große Ursache dazu.“
Er glaubte, der König von Preußen habe den Kurfürsten von Brandenburg vernichtet. Und er wusste: Alle Könige Europas und alle Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation würden von nun an Sorge dafür tragen, dass der König von Preußen und der Kurfürst von Brandenburg auf immer Widersacher blieben. Nun war der Herr ein Bettelkönig. Der Hunger war im Land.
Da entschloss er sich zur ersten Lüge, den furchtbaren Zwiespalt, der in ihm vollzogen war, zu verbergen –. Er warb von neuem Riesen, jeden für Tausende von Talern. Er zog in Potsdam neue Straßenzeilen. Aber es war nicht mehr das Wachstum, die Entfaltung, die Festigung. Etwas Fremdes und Geängstigtes kam in sein Handeln. Tiefer denn je war er von Gedanken verwundet; und der Blick der Leidenden ist anders. Seine eigene geliebte Stadt, die ihm im Havelsumpf erstand, begann ihm mehr und mehr zur quälenden Frage zu werden. Was an ihr war Wille zur Tat, Bereitschaft zum Dienst, Erkenntnis des Auftrags? Was war Lüge, Maske, Eitelkeit, Vermessenheit, Willkür?
Die Menschen, die Gott am stärksten zu sich ziehen will, müssen zuvor am tiefsten alles Menschliche erfahren; und einer, den Gott sucht, muss sich selbst zuvor als verloren erkennen. König Friedrich Wilhelm ward zum Bankerotteur und Hasardeur. Das Unbegreifliche war nur, dass der Bankerotteur und Hasardeur nach seiner Rückkehr von der Leidensfahrt vor seiner täglichen Tafelrunde zu predigen begann. Da waren die Zeiten noch besser gewesen, in denen er die alten Geschichten aus Flandern und Pommern, von Malplaquet und Stralsund immer wieder von neuem erzählte! Die großen Kinder durften sich bei Tische nicht ansehen, sonst war es um ihre Fassung geschehen, und der Vater merkte ihr Lachen. Er war ein närrischer König geworden, aber sie sollten seinen biblischen Worten lauschen, als spräche sie der Mund eines Apostels. Sie fanden jedoch entzückende Möglichkeiten, ihre Sarkasmen und Satiren zu umschreiben. Mama hatte ihnen gerade einen hypermodernen Roman aus Paris kommen lassen. Für dessen Figuren konnte man ganz ohne weiteres den König und seine Günstlinge einsetzen. Es war zum Totlachen, wenn man sich in der allerhöchsten Gegenwart vom Buche unterhielt und die Wirklichkeit meinte!
König Ragotin im Buche war ein bigotter, weinerlicher, dicker Mann, ein trauriger König Vielfraß und grämlicher Herr Dickwanst. König Friedrich Wilhelm, der Schlaflose, aß unmäßig viel, als gäbe es nur noch das eine, dem Verfall in sich zu wehren; auch trank er gierig. Aber nach dem zweiten, dritten Glas geschah es immer, dass er es weit und heftig von sich schob und in dumpfem Brüten vor sich hin sah.
Die Königin, auffallend wenig geschwätzig, beobachtete es mehrere Tage hindurch. Dann war sie genügend davon überzeugt, dass die Geschicke Preußens ihr allein anvertraut wären. Sie konnte den Hubertustag nicht mehr erwarten. Denn der erlöste sie aus Wusterhausen, das seit des Königs Reise nicht verlassen worden war.
Der König tanzte dieses Jahr am Jägerfest nicht einen Tanz mit den Generalen. Es schien, als wären die Sieger von Malplaquet vergessen. Vielleicht war aber König Ragotin auch nur zu dick geworden –?
Sobald die Kinder ihn nicht auslachten, sprachen sie sich höchst gereizt darüber aus, dass ein paar verhagelte Felder im öden Osten diesen Geizhals von einem Gatten und Vater derart außer Fassung brachten. Der Königin kam sogar der Gedanke, ob es mit dem Gemahl nicht ganz richtig wäre. Welcher König hatte denn je gepredigt! Gott sei Dank, dass ihr und ihrer Kinder Geschick nicht über dem Pregel, sondern jenseits des Nordmeers entschieden wurde!
Als sie nun nach Berlin zurückkehrten, hatte jeder seinen eigenen Plan; die großen Kinder: die strengen Maßnahmen eines so törichten Vaters nun aber wirklich nicht mehr ernst zu nehmen; die Königin: Einfluss zu erlangen auf sämtliche auswärtige Affären, denn ihr Gatte war nur noch ein Junker nach der Missernte; der König: dem furchtbaren Ernste Gottes alles zu beugen, was ihm als Statthalter Gottes auf diesem einen armen Stück Erde untertan war; der Präsident und Freiherr von Gundling: den Einfluss der Pastoren Roloff und Freylinghausen abzustellen, und sei es, dass er zu solch hohem Zweck die gesamte Kirche samt allen theologischen Fakultäten der Universitäten aufrufen müsste; Prinz Hulla: den entsetzlich traurigen Papa doch einmal wieder zum Lachen zu bringen. Er hatte sich das Schwerste gewählt.
Die königliche Familie bewohnte während des Winters überwiegend den von König Friedrich Wilhelm zu Ende gebauten Spreeteil des Berliner Schlosses.
Die Stimmung im Königshause war trostlos. Die Christtage waren ohne alle Festlichkeit vorübergegangen, nur dass Familie und Hof drei Tage hintereinander im Gottesdienste zu erscheinen hatten. Heitere Bescherungen, Knecht-Ruprecht-Umzüge und den Rundgang der Heiligen Drei Könige hatte Majestät als unfromme Alfanzereien verboten. Die Krönungsgedenk- und Neujahrsfeiern waren ja nun eigentlich schon seit seinem Regierungsantritt immer sehr düster gewesen. So groß waren Mühsal, Ernst und Widerstand und oft auch Mangel in vielen Jahren gewesen, dass der König die Wiederkehr des väterlichen Krönungstages am 18. Januar nur noch mit Predigten zu feiern gestattet hatte. Alles andere sagte er ab; nur die Armen des Friedrichshospitals erhielten etwas Geld, aber es wurde ihnen kein Festessen mehr gegeben.
Um die Neujahrsempfänge suchte der König möglichst durch eine kurze Abwesenheit von Berlin herumzukommen. Am Neujahrstag hatte er weder von dem Hof noch von den Kollegien die üblichen Gratulationskomplimente annehmen wollen, auch die Aufwartung der wenigen, noch beibehaltenen Kammermusikanten mit dem Ständchen seit der Thronbesteigung nicht mehr verlangt, wiewohl er ihnen und den anderen Hofbedienten im Parolezimmer ein Neujahrsgeschenk reichen ließ. Sie lebten, klagte man, im Schlosse wie die Trappisten. Um den König durfte niemand lachen oder lustig sein. Zudem schien nun die Armseligkeit der Wusterhausener Haushaltsführung zum ersten Male die königliche Familie auch ins Berliner Residenzschloss begleitet zu haben, das eine letzte Zuflucht gewesen war. Auf Wusterhausen hatte man Berlins damastbespannte Schlafzimmer, Marmorkamine und Deckenmalereien schätzen gelernt.
Nach seinen großen Verlusten war der König so entsetzlich sparsam geworden, dass er selbst die Kerzen auf den Leuchtern zählen ließ und für jedes Appartement und jede Galerie ein ganz genaues Kerzendeputat bemaß. Jede der Prinzessinnen bekam ein einziges Altarlicht für den Tag, und in der Finsternis, die nun angeblich im Schlosse herrschte, waren die vielen dunklen Treppenkammern und die Zugänge zu den Küchen im großen Portal zu unheimlichen Winkeln geworden, wie es sie auf Wusterhausen in so beängstigender und verwirrender Fülle gab. Man trachtete nur noch danach, möglichst rasch zu Mama zu gelangen, denn in den Räumen der Königin, die sich ja erst spät erhob, brannten auch morgens die Kerzen sehr lange. Nur in dem Vorzimmer, in dem die Töchter auf die Mutter warteten, wurde ebenfalls gespart. Dort saßen sie nun artig um den ungeheizten Kamin gruppiert, auf dessen Sims zur Rechten und Linken je eine Kerze auf vielarmigen Leuchtern angezündet war. Meist nahm die Königin den Morgengruß der jüngeren Kinder erst nach zehn Uhr entgegen, dann konnte man endlich ihre schönen Zimmer betreten; freilich hatten die Prinzessinnen, wie die raue Friederike Luise zu sagen pflegte, nun den ganzen Vormittag bei der Mutter zu verseufzen, während der Tafel zu schweigen und des Nachmittags der Reihe nach der Königin vorzulesen. Das war der Königin ein Ersatz dafür, dass sie nicht in dem Maße, das ihr angebracht schien, Hof halten durfte; denn abgesehen von den beiden Kleinsten, Ulrike und der fünfjährigen Anna Amalia, waren die brandenburgischen Prinzessinnen ja nun wirklich schon zu kleinen Hoffräulein um die dreizehn und zwölf und elf Jahre herangewachsen, von der Ältesten, Wilhelmine, gar nicht zu reden.
Für die Königin selbst begann der Tag seit Jahren mit der gleichen Frage nach englischer Post; und je nach Eingang und Inhalt der englischen Briefe wechselte nun ihre Laune; aber die Prinzessinnen fanden doch bei ihr in jedem Fall, wie nun der Morgen verlaufen mochte, vom frühen Nachmittag an lichterstrahlende Räume vor, hörten gewandte Konversation und speisten nette kleine Dinge von Silbergeschirr; Wilhelmine gar musizierte mit den Damen der Mutter und vertrieb sich in ihrem Kreise die schleppenden Stunden dieses Winters mit Kartenspielen; vor allem: um Mama stand nicht, wie um den Vater, alle Zeit in Schwere still, obwohl er immer so gehetzt war. Bei Mama war immer nur von künftigen, leichteren und angenehmeren Zeiten die Rede. Zehnmal in einer Unterhaltung fiel der Satz von einer „Zeit, in der es nicht mehr so wäre“. Das war schon eine feste Redensart der Königin geworden, die ungemein überzeugend und tröstlich wirkte. Einmal – und das war nun doch erschreckend – vernahm Prinzessin Wilhelmine sehr deutlich Worte der Mutter über eine „Zeit, wo der König nicht mehr wäre“. Und was dann an weiteren Ausführungen noch folgte, verriet die unbefangenste Freude und Hoffnung auf fortan ungetrübte Lebenslust und Ungebundenheit, vor allem auf die Stellung einer wirklichen Königin.
Erst fühlte sich die Tochter im Vater getroffen, dann aber empfand sie gerade für die Mutter etwas wie Rührung. War die Mutter nicht älter als der Vater? Hatte sie nicht die vierzig Jahre überschritten? Hatte nicht eine Frau schon um die Mitte ihrer dreißig Jahre mit ihren Lebensfreuden nahezu abzuschließen? Aber welches Feuer, welches Vorwärtsdrängen, welche Ungebrochenheit und Unauslöschlichkeit aller in zwanzig Jahren ihrer Ehe niedergekämpften Wünsche beschwingten die Mutter!
Manchmal fühlte die Tochter sich älter, als sie die Mutter neben sich empfand. Denn Wilhelmine graute vor der Zukunft, wenn sie daran dachte, wie Vater und Bruder sich immer mehr voneinander entfernten. Sie kannte die Welt ihres Bruders. Er war ohne Freunde. Er hatte nur den alten Erzieher seines Vaters um sich und zu junger Freundschaft keine Zeit. Auf ihn war der Ernst des Königs in fast erdrückender Schwere gesammelt. Er sollte seit dem Misserfolg des Vaters im Osten und seit der Entdeckung seiner heimlichen Bibliothek – zwei Ereignissen also, die doch überhaupt nicht in Beziehung zueinander standen – gar nichts mehr treiben als „die Regierung“ zu erlernen. Und am fremdesten, bedrückendsten und unheimlichsten war, dass der Vater von dem König von Preußen, zu dem er seinen Sohn erzog, nur noch wie von einem Dritten sprach. ‚Dem König von Preußen‘, dem sie beide, Vater und Sohn, untertänig seien wie die Sklaven! Wie sollte es enden! Der Bruder war so zart, seine Sehnsüchte waren so groß und unbezähmbar, sein Geist schien unersättlich nach allem, was Weite, Glanz und Klarheit war! Der Vater aber redete nur noch biblisch; und in der Bibel fand er noch unbekannte, unergründliche und harte Worte, die alles Leben erstickten –.
Ein beklommenes Gefühl legte sich Wilhelmine aufs Herz, wenn sie an die große Zukunft dachte, die ihre Mutter ihr schon binnen kurzem zu bescheren versprach. Ihr blieb als Vorbereitung für das herrliche „Morgen“ der Mutter nur die Zähigkeit des Lernens. Sie war verdammt, das unschöne Mädchen zu sein, das sich seiner großen Zukunft nur gewachsen zeigen konnte, wenn es imstande war, durch Klugheit zu bestricken. Der Gedanke freilich, durch Klugheit eine Krone zu erwerben, gab ihr manchmal doch ein ungeheures Selbstbewusstsein; und dass die Mutter, die dauernd – unter Londoner Aspekten – an ihr herumtadelte, sie so eisern fest in ihrem politischen Spiel hielt, sagte solch kluger Tochter genug. Ach, dass sie aber über all das Unschöne an sich nicht durch Eleganz hinwegzutäuschen vermochte! Sie litt unter den Schulden der Mutter. Mama hatte sich mit achtzigtausend Talern im Jahr zu begnügen und davon noch die Kleidung und die Wäsche dieser riesigen Familie zu bestreiten. Dass der Vater alljährlich zum Christfest der Gattin und den Töchtern Kleider aus den Stoffen seiner Manufakturen überreichen ließ, es wirkte eher als ein Hohn auf sie denn als Freundlichkeit: Berliner, Potsdamer Stoffe! Die Kammerfrau Ramen würde sich spöttisch bedanken, wenn man die Gabe an sie weiterreichte!
„Wir arme Teufel müssen uns nun nach der Decke strecken.“ Das hatte der Vater zur Mutter gesagt. Schrecklich, dass Mama sich in ständigen Geldverlegenheiten befand. Aber noch schrecklicher war, dass alle ihre Unterhaltungen mit den fremden Gesandten ein ständiges Klagelied waren. Darin verstand die Tochter ihre Mutter nicht; darin fand sie ihre Mutter ohne allen Stolz. Doch war es unmöglich, ihr etwas zu sagen. Friedrich allein ging manchmal erstaunlich frei mit Mama um. Der Bruder hatte für die Mutter eine ganz reizende Ironie, zum Exempel, wenn diese ihn lobte, nun habe er das Ziel einer dem Londoner Hofe angemessenen Bildung erreicht trotz aller einengenden Beschränkungen von Seiten des Vaters.
Niemand wusste es besser als Wilhelmine, wie die von der Mutter gesteckten Grenzen längst gesprengt, die von ihr erstrebten Ziele längst überschritten waren. Wenn Friedrich an die Bücher und Noten geriet, an Globen und Zirkel und Bilder – es war, als baue der Vater sein Potsdam, als werbe der König für sein Heer, als kaufe er Güter; so ohnegleichen und so unaufhaltsam war das Wachstum jenes geistigen Reiches ihres Bruders, Eroberung und Entfaltung in einem. Und dass er nicht nachgab, wie sehr ihn auch der Vater mit dem Erlernen „Der Regierung“ bedrängte! Eine Zähigkeit war in dem Schwärmer, die schon an Gehorsamsbruch grenzte. Er behauptete die Weite seiner eigenen, lichten Welt gegen das enge, dunkle Unglücksland seines Vaters. Er stand als König gegen den König.
* * *
Der Präsident von Creutz schrieb wieder Zahlen mit eigener Hand wie einst in kalter, sandbestreuter Amtsstube am Pult. Er diktierte nicht seinen drei Sekretären. Er saß beim Kamin am mächtigen Schreibtisch, zwei herrliche Leuchter zur Seite, im großen Mittelsaale seines Palais. Er schrieb allein und heimlich. Aber er befasste sich nicht mit den Zahlen, in denen das neue Unheil über Preußen bisher allein zu fassen war. Die Dokumente des Elends, die aus dem preußischen Osten eingegangen waren, waren schon überholt. Dem Herrn von Creutz schien noch erheblich wichtiger, welche völlige Stockung die russische Handelskompanie in ihrem gesamten Export aufwies und in welch eigentümliche und bedrückende Undurchsichtigkeit die Zustände im Moskowiterland sich hüllten. Der Tod war als ein Dreigestirn über dem Ostreich erschienen; nun lasteten die Schatten der drei unglücklichen Toten – Zarewitsch, Zar und Zarin – über dem zum Raube preisgegebenen Lande.
Aber auch der Zusammenbruch des gemeinsamen Werkes des Bruders Peter und des Bruders Friedrich Wilhelm veranlasste einen Herrn von Creutz noch nicht dazu, dass er selbst wieder einmal zur Feder griff. Was er da allein und heimlich niederschrieb, Generalfiskal mehr denn Plusmacher, Späher mehr denn Rechner, war eine stets wiederkehrende Frage, die nur in Zahlen beantwortet werden konnte: Welches Gehalt bezieht Herr von –? Welchen Etat erfordert seine Lebenshaltung? Woher erhält er den Betrag der Differenz –? Es waren Bestechlichkeitslisten.
Sonderkonten, die der kaiserliche General Graf Seckendorff führte, stimmten ganz auffallend damit überein. Überhaupt bestanden die lebhaftesten Wechselbeziehungen zwischen den Berechnungen der beiden Herren. Herr von Creutz war sich nur noch nicht im Klaren, wem er seine geheimen Rechnungen nun zum Schluss gesammelt überreichen sollte, dem König von Preußen oder dem kaiserlichen General. Seine Bedenken gegen König Friedrich Wilhelm wuchsen; an dessen neuerdings wahnwitzigen Unternehmungen beteiligte er sich nicht mehr; der Chef gefiel sich ohne Frage darin, eine noch einigermaßen sichere Gegenwart für eine überaus ungewisse Zukunft hinzugeben. Denn zu des Rechenmeisters Creutz großem Bedauern und Unwillen hatte der König leider gar nicht, wie erst angekündigt, daran gedacht, die Hände von seiner preußischen Unglückswirtschaft zu lassen.
„Von Preußen“, sagte König Ragotin beharrlich, „trägt das Königreich den Namen.“
Das Wort vom „König Ragotin“ war längst herum. Es sei auch ein gar zu reizender Einfall, meinte Monbijou.
Immerhin war König Ragotin doch noch imstande, die Diplomatie samt ihrem geheimen Generalkontrolleur von Creutz in Atem zu halten. Manchmal verwirrten sich den beiden Herren Creutz und Seckendorff ihre Kontoauszüge. Dann wussten sie: La Chétardie und Rothembourg, die neuen Pariser Gesandten, sind am Werk; oder Du Bourgay aus London bemüht sich um diesen und jenen. Im Allgemeinen aber konnten die Herren sich versichern, dass England und Frankreich, sein diplomatischer Vasall, nicht so großzügig und emsig Mittel daran setzten, die preußisch-englische Heirat zustande zu bringen, wie Österreich, sie zu verhindern. Denn die Kaisermacht war im Zerfall; die habsburgische Monarchie war furchtbar bedroht; und der Kaiser hatte nur Maria Theresia, die Tochter.
Alles drückte sich in Zahlen der Bestechungslisten aus: der Wert des Geschaffenen; die Fehlspekulation im Osten; der Ehrgeiz der Königin; der Zwiespalt zwischen Hauspolitik, Reichspolitik und Religionspolitik, unter dem der König so namenlos litt; denn alle Partner waren miteinander verwandt; und alle waren auch miteinander verfeindet; und obendrein noch alliiert.
König Friedrich Wilhelm aber war fromm.
Da wurde das gemeine, kalte Spiel und Gegenspiel zur Qual des lebendigen Herzens.
Wie aber kam es, dass der kaiserliche General Graf Seckendorff über den wankelmütigen, hin und her gerissenen König Ragotin an den Wiener Hof berichten musste: „Man macht sich von des Königs Gemüt eine ganz falsche Vorstellung, wenn man glaubt, dass solches von irgendjemand könne regiert werden!“?
In seinen Berichten nach Wien vergaß der kaiserliche General leider noch hinzuzufügen, welch neuartige Erfahrung er durchgehend in Preußen machte: Des Königs neuen Militärs durfte man keine Dukaten mehr anzubieten wagen. Die Offiziere der neuen Armee zeigten sich unbestechlich. Ihnen gab der kaiserliche General allwöchentlich ein großes Gastmahl mit fünfzig Flaschen Wein.
Mit dem König ging er zur Parade und zur Kirche.
* * *
Einmal, gänzlich gegen die Gepflogenheit, verabschiedete sich der König, gleich nachdem man den Kirchenstuhl verlassen hatte, von Seckendorff, winkte unauffällig zu der Loge der Ärzte hinüber und begab sich sofort mit ihnen und einigen anderen Herren der Anatomie und des neuen Sanitäts-Rates zu einer außerordentlichen Sitzung ins Schloss hinüber.
Ein unheimliches Sterben in den Regimentern war angebrochen. Namentlich unter den Südländern ging es um, als vermöchten sie plötzlich die Witterung des fremden Landes nicht mehr zu ertragen; als bedeute der jähe Umschwung von dem lauen, trägen Winter in so grimmige Kälte eine unabwendbare Gefahr für sie.
Der König konnte sich gar nicht erklären, dass das Sterben unter seinen Grenadieren nahezu schon epidemisch auftrat. Scheinbar unterhielt er sich ganz wissenschaftlich oder allenfalls human darüber mit dem Sanitäts-Rat: Welches sind die Gründe? Welche Maßnahmen sind erforderlich? Welche Aussichten auf Abstellung des Übels bestehen? Aber die Pfeife in seiner Hand zitterte verräterisch. Und aus der Sitzung eilte er, allem Widerspruch zum Trotz, in die Lazarettbaracke seiner Grenadiere. Die Konferenzen wiederholten sich täglich. Allmählich gelangten die Ärzte zu der Meinung, Majestät sei selber krank. Aber der König winkte unwirsch ab – beinahe gequält.
Das Sterben griff um sich. An jenem Tage sah man trotz der Eiseskälte und des schneidenden Sturmes die Potsdamer Bürger in den Haustoren stehen, wie sie den gewaltigen schwarzen Schreinen nachsahen, in denen man des Königs tote Riesen auf den Friedhof vor die Stadt hinaustrug.
Hinter den Mauern um den Gottesacker ragten unheimlich die Gerüste des neu begonnenen Stadtteils, tief verschneit, wie böse Zauberbäume, übergroß und kahl, über verlassenem, unvollendetem Mauerwerk.
Der Einbruch der Kälte zwang, allen Bau im Stich zu lassen. Der König glaubte nicht mehr, dass er diesen Stadtteil je vollenden würde. Er fühlte sich zu hart an ihm gestraft. Es war, als sollte seine Lüge offenbar sein vor der Welt. Denn er hatte gelogen, als er spät im Jahr noch neuen Baugrund ausheben, Grundmauern ziehen, Gerüste aufrichten ließ. Er hatte über die Verluste hinwegtäuschen wollen, die er im Osten erlitt. Jetzt starb seine Stadt aus. Züge von Soldatenhäusern standen leer. Die Soldatenwitwen überkam Furcht. Sie zogen zueinander. Ganze Häuserreihen waren als vom Tode gezeichnet verschrien. Der Würgeengel ging durch die Stadt. Die Kinder im Waisenhaus starben auch. Der Grund des neuen Karrees war feucht und schlecht. Zu Hunderten holte der König alle erreichbaren Schlitten vors Waisenhaus. Aber die Schlitten durften keine Schellen tragen. Es war dem Herrn unerträglich geworden, das helle, leichte Klingeln unter den nicht mehr verstummenden Totenglocken zu hören. Lautlos gleitend, trugen die Schlitten die Kinder hinaus auf die Dörfer und in die alten, großen, festen Klöster der Mark, nach Lehnin und Chorin. Der Herr war überall zu finden; plötzlich war er da, ging unruhig umher, prüfte mit scharfen, düsteren Blicken jeden Vorgang; und ebenso jäh war er in fliegendem Schlitten auch wieder verschwunden.
Endlich war er selber krank. Es zerriss ihm die Glieder. Aber die Ärzte erfuhren nichts davon, bis sich der König einmal mitten in der – ach, wievielten – Konferenz am Stuhl festhalten musste, der am nächsten stand; sein Gesicht war entsetzlich verzogen. Nun war sein Leiden nicht mehr zu verbergen; aber untersuchen durften sie ihn nicht, ehe nicht gut an die zehn Eide geschworen waren, dass alles geheim bleiben werde.
In die alte Wunde von dem letzten Jagdunfall sei beim Frost eben etwas Rose gekommen; eine Lappalie; ein bisschen Salbe tue not. So sagte der Herr. Unter sich meinten die Herren vom Sanitäts-Rat lakonisch, in Berlin und Potsdam könne man es ja eine leichte Rose nennen. Anderswo heiße es Gicht.
Ein bisschen zu jung sei der Herr für die Gicht, fügten sie dann noch hinzu; er sei viel zu viel in der Kälte gereist; er habe auch zu wild gejagt; und auch sein unsinniges Waschen trage wohl Schuld: Tag für Tag den ganzen Leib mit frischem Brunnenwasser zu übergießen! Dann war noch an seinen Vergehen zu nennen das maßlose Essen, das schwere Getränk.
Damit fingen sie an: Er solle nicht mehr so viel essen.
Der König sagte schleppend: „Das muss ich aber. Das muss ich.“ Und dann kam es schrecklich. Er schrie es plötzlich heraus, nun wo Schweigen vergeblich war. „Diese Nacht habe ich zum ersten Male wieder eine Stunde geschlafen. Ich habe in zwölf Tagen nichts als grausame Schmerzen gehabt. Gott hat mich bewahrt, dass er mir den Kopf nicht hat zerspringen lassen. Bevor ich es wieder bekommen sollte, so mache der liebe, liebe Gott ein Ende mit mir. Denn Sterben ist sanft. Aber dies Leiden ist unerträglich, ist viehisch.“
Danach sahen sich die Ärzte an und meinten noch einmal: „In Berlin und Potsdam kann man es ja leichte Rose nennen. Anderswo heißt es die Gicht.“
Und das Schicksal des Großen Kurfürsten dämmerte herauf.
* * *
Als wolle er sich in der Hilflosigkeit, die über ihn gekommen war, verbergen, erließ der Herr ein Edikt gegen den Missbrauch, „Seiner Königlichen Majestät allerhöchste Person immediate mit Klagen zu behelligen, die vor die ersten Instantien gehören“.
Er hatte Einblick gewonnen, dass die Beamten und Offiziere bei dem neu anbefohlenen, gesteigerten Bauen oft ihr ganzes Vermögen zusetzten; und nun suchten sie um die Erlaubnis nach, die Häuser im Wege der Lotterie wieder veräußern zu dürfen, weil sich so viel Käufer, wie benötigt wurden, gar nicht fanden. –
So hatte den Herrn noch nie eine Schmähung getroffen wie nun dies furchtbare Wort „Lotterie“, angewandt auf seine Völkerstadt und seinen Gottesstaat Potsdam.
Wie eine Königin schritt die Ramen durch die Gassen ihrer Herkunft. Wie ein Engel schwebte sie durch die Hütten der Armut, der sie entronnen war. Sie bot des Königs leere Häuser aus.
Durch Potsdam ging indes der Würgeengel.
„Ihr werdet den König erfreuen, wenn ihr ihn um seine leeren Häuser bittet“, redete die Ramen. „Ihr müsst sagen: ‚Majestät, uns habt Ihr bisher noch vergessen trotz allen Eures starken Bau's und Eurer hübschen Schmuckkästchen für die Soldatenfamilien!‘ Gleich wird der Herr euch seine leeren Häuser öffnen.“ Es hilft ihm, seine Lügen zu verschleiern, dachte sie dabei.
Ewersmann führte dem König die Armen ins Schloss. König Friedrich Wilhelm hörte trotz der Schmerzen aufmerksam und sehr geduldig, wenn auch tief betroffen zu. Auf der Stelle schrieb er ein paar Zettel aus: Wohnungsanweisungen.
So kam das Gesindel nach Potsdam. So drangen die Heuchler ein, die er in seiner gegenwärtigen Aufgewühltheit nicht sogleich durchschaute. So machten sich die Diebe breit, die ihm noch immer entwischten. So nisteten die Hehler sich ein, die er noch nicht fand. So hatten nun die Huren eine gute Zuflucht vor der Dicken Schneider und die Trinker ein Versteck in der nächsten Nähe des Königs. Die Trägen zogen ein, die sich bis heute den Armenwächtern entzogen; die Räudigen gesellten sich dazu, die seine Armenärzte mieden. Die Ehrlichen, Redlichen hielten sich ängstlich von den Unglückshäusern des Königs zurück.
Zu dieser Zeit wurden nun im Magdeburgischen mehrere Dörfer mit ihrem ganzen Wintervorrat in Brand gesteckt – von Soldaten! Bald verlachte aber der König auch solche Untat, solches Unheil als geringfügigen Jammer und Frevel angesichts des größeren. Potsdam hatte zum zweiten Mal brennen sollen! Und die Franzosen unter den Grenadieren des Königs waren schon bereit zu Anschlag und Ausbruch. Wenige Stunden danach war auch ein Komplott von siebzig oder achtzig Dalmatiern, Polen, Illyriern, Kroaten, Ungarn, Russen, Engländern aufgedeckt.
„Für solches Pack verschwendet der König sein Geld“, sagten die Gassen und Schenken, die Amtsstuben und die Vorzimmer im Schloss.
Wer war der letzte Widersacher in dem nicht enden wollenden Kampfe? Was meinte Gott mit alledem? Das – immer – war die letzte Frage des Königs, der mehr als Brandstifter und Aufrührer der göttlichen Vergebung zu bedürfen glaubte, zerrissen von dem Zwiespalt, Herrscher und Büßer in einem zu sein. Und alle mussten spüren, was ihm durch den Sinn ging.
Der düstere Ernst von Wusterhausen lastete auf der ganzen Hauptstadt; er ergriff schon das Land.
Das Billardspielen in den Kaffeehäusern wurde verboten. Die neuen Kaffeehäuser waren dem König überhaupt viel zu sehr à la mode und darum schon ein Dorn im Auge.
Für die Pfingstzeit wurde bereits jetzt den Schützengilden und Innungen das Scheiben- und Vogelschießen untersagt.
An Glücksspielen blieben nur die erlaubt, deren Aufhebung die Königin bloßgestellt haben würde.
Er, der als Trinker geschmäht war, verfügte, dass Trunkenheit niemals ein Strafmilderungsgrund, sondern strafverschärfend sein solle.
Der Herr von Schlubhut wurde, nachdem der König am Sonntag weinend eine Predigt über die Barmherzigkeit angehört hatte, am Montag wegen der Unterschlagung von Siedlungsgeldern vor den Fenstern des Sitzungszimmers der Domänenkammer, vor den Augen seiner Kollegen, aufgeknüpft. Zum ersten Male hing ein preußischer Edelmann am Galgen wie sonst eine diebische Magd vor dem Hause ihrer Herrschaft. Eine neue Phase des Gerichtes hatte begonnen.
In den Kirchen sollte aller Schmuck der Altäre verschwinden.
Gestickte Behänge, Leuchter, Zierrat der Taufbecken und Abendmahlsgeräte durften nicht mehr sein.
Aber darin fiel bereits eine Entscheidung, die schon allem hoch enthoben war, was Edikt hieß. Preußen wurde zu einem Lande der Buße.
Als es so weit gekommen war, beschloss man, den Herrn auf Reisen zu schicken. Es war ein letzter Versuch, bevor man es endgültig aussprach, dass er in unheilbaren Trübsinn verfallen werde. Alle waren sie sich ganz merkwürdig einig darin, dass Majestät sobald wie möglich außer Landes gehen müssten. Wirklich waren einmal alle einig: Der Hof. Die Gesandtschaften. Die Familie. Die Geistlichkeit. Das Generaldirektorium. Die hohen Militärs. Der Sanitäts-Rat.