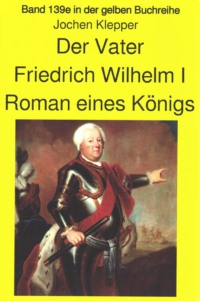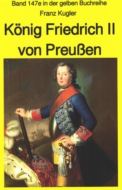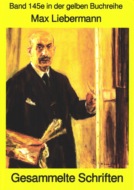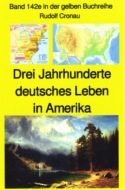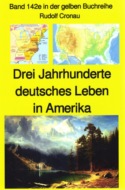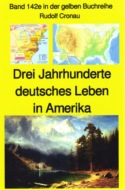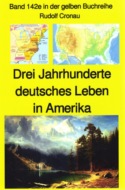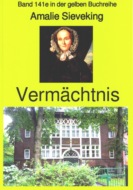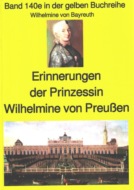Kitabı oku: «Jochen Kleppers Roman "Der Vater" über den Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I - Teil 2», sayfa 9
Soweit also waren die Dinge gediehen. Aber mehr durfte jetzt noch nicht gewagt werden. Graf Rothembourg kündigte Frankreich einen baldigen mündlichen Bericht über den preußischen Thronfolger an. Inzwischen sah er von Brief zu Brief den Umsturz immer näher und meldete in stets kürzeren Abständen, dass alles auf dem Wege dazu sei. Was sich der Abenteurer Clement einst in gefälschten Briefen ersann, war Wahrheit geworden. Er hatte König Friedrich Wilhelms späteres Geschick schon längst zuvor geahnt. Alles schien in Auflehnung. Neuerdings taten sich sogar die Bäcker gegen den König zusammen; sie verstünden es nicht, so schlechtes Brot zu backen, wie der Herr es verlange. Das Volk beklage sich; es wolle anderes Brot.
„Nein“, schlug der König ab, „sondern solch Brot wie die Musketiere essen und wie ich selber esse. Ich will den Anfang machen auf meinem Tisch.“
Er sah die dritte große Teuerung, seit er König war, über sein Land kommen.
Die königliche Tafel sollte es am ersten spüren.
Als krank ausgegeben, kam Friedrich tatsächlich um die neue Ostfahrt des Vaters herum, die sich sofort an seine Dresdener Reise anschloss. Aber er musste nun in Potsdam wohnen und durfte die Mutter nur zweimal in der Woche besuchen. Solche vom König verfügte Trennung ließ tief blicken. Fritz bekam sein festes Pensum Ingenieurwesen und Fortifikationskunde aufgetragen. Das war lästig, keinesfalls jedoch so schlimm wie die täglichen militärischen und ökonomischen Gespräche mit dem Vater, deren Inhalt dem Kronprinzen nun einmal nach wie vor nur als quantité négligeable erschien.
Vor allem: die zwei Tage jeder Woche in Monbijou glichen alles, alles wieder aus! Denn immer wieder noch einmal flackerte am Hof der Mutter eine Festesfreude, wie er sie aus den Dresdener Tagen kannte, empor. Ja, um die Zeit der Lilien und Rosen und der Brunnenspiele im Park brach in dem Gartenschloss Sophie Dorotheens eine wahre Musikleidenschaft aus. Denn König August hatte nicht nur dem König seinen Meister Quantz, sondern, wie er in den artigsten Schreiben versicherte, auch der Königin „die geschicktesten Musiker gesandt, so den berühmten Weiß, der ein Meister auf der Laute ist und nicht seinesgleichen gehabt hat, und Bufardin, der für seinen schönen Ansatz auf der Querflöte bekannt ist“. Sie durfte diese Musiker behalten. Ihre Sonderrechte erschöpften sich nicht nur mit dem Silberservice bei der Tafel.
Friedrich blieb allmählich drei und gar vier Tage bei Mama, spielte Flöte, Violine, Cembalo, trieb Politik, indes die Erzieher aufgerieben wurden von dem Zwiespalt zwischen Monbijou und Wusterhausen. Noch immer nahm der König nicht ihr Amt von ihnen, noch immer hielt er an dem Gedanken fest, den Sohn von seinen eigenen Gouverneuren erzogen zu wissen, solange Gott diese Treuen dem Hause Brandenburg ließ. Die Treuen waren zu rar.
An jenem Abend allerdings, an dem der Herr vergrämt, beunruhigt, überanstrengt, krank und völlig beschäftigt mit trüben Eindrücken und schwierigen Plänen aus Preußisch-Litauen zurückkam, das Schloss verlassen fand und – wollte er begrüßt werden – vom Personal nach Monbijou gewiesen wurde; an jenem Abend war er zu dem starken Eingriff entschlossen, Friedrichs Erziehung so spät noch einmal auf eine neue Grundlage zu stellen. Denn da saß nun wieder die ganze Clique bei einem Konzert beisammen und politisierte und schwadronierte und hörte nicht auf Harfen, Flöten und Gamben, sondern spielte, in politischen Anzüglichkeiten schwelgend, L'hombre und A-la-bassette, obwohl die Königin dem Gatten fest versprochen hatte, dies Hasardieren würde allmählich einschlafen, damit er es ihr nicht zu verbieten brauchte. Und fraglos war der Mittelpunkt des Konzertes, der Spielrunde, der eleganten Debatten und unausgesprochenen Komplottgedanken einzig und allein sein ältester Sohn; sein Sohn, das wusste König Friedrich Wilhelm längst, als der Neffe des Königs von England! Ach, all das Konzertieren war ja nur ein Vorwand! Da saß er nun, die Flöte unter die Achsel geklemmt, am Spieltisch der Mutter, obwohl heute nicht sein Monbijoutag war, griff schnell ins Spiel ein, mischte sich lebhaft in die Konversation und gab der Unterhaltung sofort die entscheidende, die gefährliche Wendung. Am Hofe der Mutter in Charlottenburg, dachte der König, war es doch, bei aller Ablehnung des Königs, immerhin nur um Monaden, inkommensurable Größen und prästabilierte Harmonie gegangen: um die philosophische Unterbauung des Königtums und Leibniz' große Pläne für die deutschen Fürstenhäuser, herrliche Möglichkeiten der Entfaltung, die man theoretisch diskutierte. Hier aber wurden andre Möglichkeiten für das Königreich Preußen erörtert.
Friedrich schien sich sehr heimisch zu fühlen und machte nicht gerade den Eindruck, als wolle er diesen Abend noch nach Potsdam zurückkehren. Perücke und Anzug, die der Kronprinz trug, waren dem Vater völlig unbekannt. Seit der Rückkehr aus Dresden hatte Friedrich Schulden nicht mehr nur für Bücher –.
Ach, und der König durfte nicht einfach mit seinem Sohn auf sein Jagdschloss gehen, sich fern von den Gesandtschaften allein mit ihm verbergen, ein paar tüchtige Männer für den Unterricht mitnehmen und all die großen Aspekte mit einer kühnen Geste und einem möglichst klaren Kraftausdruck beiseite fegen –; im Gegenteil: man musste den Knaben gerade in jene Verflechtung seiner stillen Schulstunden mit den bewegten Vorgängen der europäischen Zeitgeschichte tiefer und tiefer einweihen. Um ‚Des Königs von Preußen‘ willen kam der Vater nicht daran vorbei.
Es gab recht betretene, aber auch sensationslüsterne Gesichter, als der König so unerwartet im Halbrund der Spieltische erschien.
Der König bemerkte, dass Gattin und Tochter sich flüchtig verständigten. Die Königin bot ihm an, in dem Gelben Zimmer neben der Orangerie ihm und einigen der Herren rasch eine Tabagie zu arrangieren. Der König dankte. Dagegen erkundigte er sich unvermittelt, aber nicht unhöflich nach der Herkunft all der unzähligen neuen Dosen – er schätzte, es seien an die zwei- bis dreihundert –, die wie eine kostbare Sammlung auf den Möbeln umherstanden und die er vor der Reise noch nicht bemerkt zu haben glaubte: Dosen aus Gold, Perlmutter und Brillanten, Lapislazuli und Carneol. Er rückte an ihnen hin und her, was den Damen ungezogen schien. Eins der Kästchen griff er heraus.
„Achthundert Taler“, meinte der König, „wozu benötigt man dies?“
Es sei eine neue Mode, erfuhr er. Die Damen nähmen jetzt auch un peu du tabaque. Und zu jedem Kleide wähle man die passende Tabatiere. Das sei jetzt üblich.
Der König schob auf einem japanischen Lacktisch alles, was an Dosen über ihn verstreut war, zusammen.
„Damit können Sie Dörfer retten, meine Damen, in jenem Lande droben im Osten, das Sie zur Königin, zu Prinzessinnen, zu königlichen Hofdamen macht. Im alten Preußen droben ist jetzt Hungern à la mode.“
Mit kurzem Gruße ging er hinaus. Die Damen umflatterten aufgescheucht die sichtlich angegriffene Königin. Denn alle waren ja in alles eingeweiht. Keiner sah, wie mühsam und beschwerlich König Friedrich Wilhelm hinausging; keiner hatte bemerkt, dass er an dem Tisch mit den Tabatieren nur verweilte, weil er eines Haltes bedurfte. Auch als er seine Reise angetreten hatte, machte sich die Königin keine Gedanken, dass sein Aufbruch unter etwas besorgniserregenden Umständen erfolgte. Den vierten Platz in seinem Wagen hatte der Oberchirurg innegehabt; und außer dem leichten Feldküchenwagen war der offenen Königskalesche zum ersten Male ein völlig neuartiges Gefährt gefolgt: eine Feldapotheke auf Rädern, die getreue, wenn auch sehr verkleinerte Nachbildung der neuen Schlossapotheke aus Silber und Glas.
Sie fragten nicht nach den Zeichen seines Aufbruchs, seiner Heimkehr: Sie achteten auch heute nicht auf seinen Weggang. Sie waren bedrückt, wenn er kam, und atmeten auf, wenn er ging.
Auf dem Parkweg am Fluss musste der König immer wieder stehen bleiben; er lehnte sich gar an eine der Laternen. Aber seiner Traurigkeit und seinem Grimm entging es keineswegs, welch maßloser Überfluss an Beleuchtung um das Schloss der Königin herrschte, weil man ihn noch auf der Landstraße glaubte.
Im verlassenen großen Schlosse drüben stieg er so spät noch zu den Prinzenstuben empor und trat in seines Hulla Schlafgemach. Für einen unendlich schmerzlichen und unendlich seligen Augenblick erschien ihm jene kleine Kammer, ganz in Rosa und Gold, als ein Hort der Wärme und Liebe in der großen Öde und Kälte seiner Schlösser, des Römerpalastes sowohl wie des Jagdkastells. Jede der wenigen Stunden, die er in den Kinderzimmern verbrachte, war ihm gegenwärtig, und aus allen Erinnerungen trat das Bürschlein August Wilhelm: immer sanft und rührend aufmerksam, zuvorkommend und heiter, aufgeweckt und liebenswürdig, stürmisch in seinen Zärtlichkeiten und plötzlich wieder fast andächtig still. Der große Bruder spielte die Flöte – und Hulla stahl sich als begeisterter Zuhörer ins Zimmer. Der grämliche und kränkliche kleine Heinrich wurde im Gartenwagen ausgefahren – und Hulla lief, ihm schöne Schmetterlinge fangend, munter schwatzend nebenher. Die dicke, kriegerische Ulrike hatte in einer Treppenkammer ein vergessenes altes Jagdhorn aufgestöbert – und Hulla blies es ihr gleich unermüdlich, wenn auch ein wenig atemlos vor, um danach noch als eifriger kleiner Maler ihre Tuschereien zu bewundern: turmhohe Häuser und Bäume, riesenhafte Enten und höchst merkwürdig aussehende Menschen in winzigen Kähnen. Oder die große Schwester Wilhelmine las in ihren Büchern – und Hulla hockte neben ihr und malte ihr unzählige kleine Bildchen zu ihrer Geschichte, und überall fügte er nach Möglichkeit den Papa in seiner blauen Uniform ein. Der Vater, der große Bruder, der kleine Heinrich, Wilhelmine, Ulrike, Sanssouci, die raue Friederike Luise, die gesetzte Sophie Dorothea Maria – stündlich ergoss sich ein Strom von Hullas Zärtlichkeiten über sie. Nur vor der Mama blieb er befangen. Sanssouci und er schienen sie immer zu stören. Und Sanssouci Philippine Charlotte wünschte doch gar nichts so sehr, als ein Hoffräulein der herrlich parlierenden Mama zu sein; selbst das lange, lange Warten in dem Vorzimmer der Mutter Königin war ihr ein Fest!
Der König kämpfte um ein Reich, als er die Hand auf die Türklinke der Knabenkammer legte – er kämpfte um den Traum der bergenden, wärmenden Nähe, die Wusterhausen ihm bescheren sollte in den eisigen Weiten des Königtums. Der Kleine schreckte auf, aber er lächelte sofort und freute sich sodann ganz unbändig, dass der Papa so mitten in der Nacht mit einem Male wieder da war.
„Was hast du mir mitgebracht, Papa? Hast du es hier?“
„Ich habe heute nichts mitgebracht, mein Kleiner. Dein Papa ist ein armer Mann.“
Der Kleine wollte sich ausschütten vor Lachen. Der König rückte ihn im Bett zurecht und strich ihm liebkosend die Decke glatt.
„Morgen darfst du dir aber wieder Farben kaufen.“
Das versprach er seinem Hulla fest. Noch einmal streichelte er ihn: er streichelte ihn für alle seine Kinder, die nahen und die fernen, die lebenden und die toten, und darum sehr innig. Aber nun dachte er schon wieder nur daran, was mit seinem Ältesten zu geschehen habe.
Denn geschehen musste etwas; und bald.
Die Erzieher waren entlassen, mit hohen Ehren und Renten. Das hatte keiner erwartet.
Aber der König hatte nirgends Schuld gefunden, nicht bei sich selbst und nicht bei den Männern Kalkstein und Finckenstein. Ihm war ein liebster Plan gescheitert. Das war alles.
Am Hofe orakelte man im Zusammenhang mit den jüngsten Vorfällen in Monbijou und der Entlassung beider Gouverneure das Ungeheuerlichste über die Teufeleien, die der König sich nun aussinnen würde, den „Neffen des Königs von England“ zu treffen und ihm in Wusterhausen einen wahren Schreckensherbst zu bereiten; Korporale würde er ihm wohl zur Seite geben, Korporale!
Der König war entschlossen, seinen Ältesten noch einmal in Güte, Ernst und Versöhnlichkeit für ‚Den König von Preußen‘ zu gewinnen.
Ohne Frage musste er zwar seinen Sohn aus dem Umkreis der Mutter entfernen, ohne Frage jedes seiner angebahnten diplomatischen Rendezvous verhindern. Aber er wählte einen Weg, der nur nach behutsamster Erwägung und ernstestem Nachdenken, abseits allen Zorns und aller Härte, hatte gefunden werden können.
Er musste nun den Sohn eng an sich binden. Aber er gab ihm Gefährten: nicht mehr Männer, die schon die eigene Kindheit behüteten oder ihm selbst schon Waffenmeister und Waffenbrüder gewesen waren, sondern junge Menschen, die besten, die gebildetsten seiner Armee. Die Freundschaft sollte Friedrich sein Amt begreifen lehren; diese drei jungen Männer, die der Vater für ihn ausersah, hatten verstanden, welche Forderung von ‚Dem König von Preußen‘ an Junkertum und Offizierskorps gestellt war. Die sollten nun dem künftigen König allstündlich zur Seite sein. Als derart wichtigen Bestandteil seiner Königsaufgabe betrachtete der Herr die Erziehung des kommenden Königs, und im Gegensatz zu all den anderen Höfen suchte er den Thronfolger mehr und mehr zu den Geschäften heranzuziehen.
Der König holte seinem Sohn den jungen Herrn von Rochow, den jungen Grafen Keyserlingk und den Pagen von Keith. Diese drei sollten ihm, dem Vater, helfen den Kampf zu führen gegen das, was seinem Sohn allein noch „digne d'un prince“ war.
„Komödianten, maîtres de flûtes mit zwölf Pfeifen, Tanzmeister, Franzosen und Französinnen, Döschen, Etuichens, bernsteinerne und andere Bagatellen, das ist königlicher als eine Kompanie Grenadiere“, hatte der König zu seinen Helfern gesagt und sie noch schriftlich gebeten, seinem Sohne vorzustellen, „dass alle effeminierte, laszive, weiblichen Okkupations einem Manne höchst unanständig sind. Wer den Kopf zwischen den Ohren hängen lässt und schlotterig ist, der ist ein Lumpenkerl.“ Die Schlafmütze solle dem Prinzen aus dem Kopf vertrieben werden, dass er mehr Vivazität bekäme. Der Kronprinz neige zu Beschäftigungen, welche faul seien. Und auf ihren Abendkonzerten in verputzten Gartensälen hätten sie etwas überaus Artiges zusammenkomponiert, das verdammte Ähnlichkeit mit einem Kriegsmarsch besitze.
Der König legte dem jungen Oberstleutnant von Rochow sogar beide Hände auf die Schultern.
„Will es auch mit Ihm, dem Keyserlingk und dem Keith bei meinem Sohne nicht gelingen – so ist es ein Unglück.“
Und alles, was er nun noch sagte, war Entwurf einer völlig neuen Instruktion für einen erwachsenen Sohn.
„Der Ehrgeiz, der moderiert ist“, hob König Friedrich Wilhelm an, „ist recht löblich, hingegen die Hoffart stinkend; und ist gegen Gottes Willen und ein Abscheu der Menschen.“
Auf ihrer Reise schien er den Sohn zu jeder Stunde beobachtet zu haben: kein Fehler, keine Schwäche, kein Versagen, keine Unart, die er nicht an ihm kannte; und niemals war ihm der Eindruck geworden, als kämpfe Friedrich gegen sich selber an, so wie er selbst sich nahezu in Qualen überwunden hatte: immer stärker überwältigt von Gott. Es war, als erkenne er aus seinem eigenen Wesen und seiner eigenen Erinnerung heraus vieles wieder, das er an dem Sohn genauso hasste, wie er es an sich selbst hassen gelernt hatte, und wäre es nur die malpropre Art der äußeren Haltung.
Völlig unbegreiflich schien, dass der König zu diesem Zeitpunkt den militärischen Rang seines Sohnes erhöhte; er wollte ihm Vertrauen beweisen und all seinen guten Willen recht sichtlich bekunden.
Die Königin, von den Umbesetzungen der Gouverneursstellen und im kronprinzlichen Gefolge benachrichtigt, erklärte, nicht einer dieser neuen Herren sei wahrhaft von Familie. Selbst Graf Keyserlingks Mutter sei nicht eigentlich von Geburt, wenn sie recht unterrichtet wäre. Auch hieß es, ein simpler Leutnant von Borcke würde noch hinzugezogen werden. Die Königin glaubte sich nie an solche Enge gewöhnen zu können. Nichts schien ihr unerträglicher als kleine Verhältnisse. Und nun stand Wusterhausen dicht bevor. Frühling und Sommer waren über den Hoffnungen von Monbijou und der Wahl der neuen Prinzengouverneure dahingegangen. Die Menschen sprachen schon vom Sommerende. Das presste Frau Sophie Dorothea das Herz ab. Die kostbaren Vorhänge von weißgelbliniertem Atlas vor ihrem Fenster am Schreibtisch beiseite schiebend, blickte sie in ihren Garten hinaus – und sah das kahle Burgfenster ihrer Wusterhausener Kammer vor sich. Das sollte nun den langen Herbst über alle Freude ihrer schönheitsdurstigen Augen sein: grobes Mauerwerk ohne milde, bunte Verhüllung; und als einziger Ausblick aus den kalten, steinernen Nischen einige düstere Kiefern, wie sie sich im Herbststurm bogen.
* * *
Es war, als wittere die Bärin Grognonne die Ankunft des Herrn. Wie ein Hund lag sie im Tor an der Brücke und hielt Ausschau. Ganz gegen die Gewohnheit kam der König diesmal als der letzte. Die anderen waren alle schon im Jagdschloss eingetroffen. Der Herr war noch immer durch die schwierigsten Geschäfte in Berlin festgehalten.
Der Hof und seine Gäste richteten sich indessen auf Schloss Wusterhausen ein, lärmend und mit etwas nervöser Heiterkeit, dann mehr und mehr gereizt, jedenfalls soweit es die älteren Glieder der Familie betraf! Die Enge! Die Enge! Was half alle Bauwut des Königs! Auf Wusterhausen wurde nichts geändert; es blieb die alte Jagdburg, das alte Grenadierkastell aus seinen Knabenjahren. Der Kronprinz hatte nicht einmal ein eigenes Zimmer, einen Besucher zu empfangen.
Bis zum Eintreffen des Königs war es aber ganz erträglich. Prinzessin Wilhelmine wurde in den Kreis der jungen Männer einbezogen, man lernte einander kennen, entdeckte die gemeinsamen Interessen, und der Kronprinz schien sehr rasch imstande, sich ein Bild von den neuen Erziehern und Hofmeistern und Begleitern zu machen.
Den Kavallerieobristen von Rochow, einen schwerfälligen jungen Mann mit großen, grünen, ruhigen Augen, hatte Papa – um in seiner Sprache zu reden – ganz sicherlich wegen seiner ernsten Natur ausgewählt. Der Rochow sollte die Schar der Gouverneure führen und den ganzen Ton in ihrem Kreis bestimmen.
Schwerer war dem Prinzen schon die Wahl des jungen Grafen Keyserlingk verständlich, den Papa gelegentlich schon selbst einmal als sehr „alert“ bezeichnet hatte. Meinte er damit nur den schlanken, geschmeidigen Reiter? Es war ja wohl unmöglich, dass dieser König den ausgedehnten Studienreisen und Universitätsaufenthalten des jungen Grafen irgendwelchen Wert beimaß?! Und ausgeschlossen war es doch, dass Papa gar Keyserlingks lebhafte Klugheit erkannte oder sein modernes philosophisches Denken, durch das der junge Graf dem Königssohn so nahestand, auch nur ahnte?!
Am rätselhaftesten aber stand es um den Leutnant von Borcke; und gerade der hatte Tag und Nacht ständig um Friedrich zu sein. Ja, wusste Papa denn nicht, dass niemand ein eleganteres Französisch sprach und in der neuesten Musik vorzüglicher beschlagen war; dass niemand in der Konversation beschwingter sein konnte als der schmale, junge Offizier mit den auffallend langen, tiefschwarzen Wimpern über guten, klugen, grauen Augen?! Der sollte seinen stündlichen Aufpasser abgeben? Ach, welch ein schlechter Menschenkenner war doch König Ragotin! Und nun auch noch der Page von Keith, Musikant, Poet und Maler, zigeunerhaft dunkel, hochgewachsen, ein behender Spieler in jeglichen Dingen, so leicht, so gewandt, so vergnügt! Friedrich fand, die jungen Herren hätten den Papa mit ganz außerordentlichem Geschick überlistet. Wie mussten sie im Potsdamer Leibregiment den strengen König-Obristen hinters Licht geführt haben, ihr Amt bei Hofe zu erhalten und in die engste Umgebung des künftigen Königs zu gelangen!
Geschmeichelt dachte sich der Prinz das aus. Die Güte des Vaters begriff er nicht. Er dünkte sich so menschenkundig. Mit den neuen Gouverneuren glaubte er sich in geheimem, stillschweigendem Einverständnis, von dem die jungen Männer jedoch nicht das mindeste ahnten. Der Kronprinz hatte sie bei sich zu begeisterten Gefährten einer schwärmerischen, heimlichen Verschwörung erhoben. Weil er ihnen nun so aufgeschlossen begegnete, erschien ihnen ihr neues Amt, so verschieden sie an Temperamenten und Talenten waren, unverhältnismäßig leichter, als sie es erwartet hatten. Im Hirschsaal herrschte jetzt manchmal das munterste Schwadronieren, das sich einer nur vorstellen konnte; so glänzender Laune waren der Kronprinz und die älteste Prinzess. Auch warben sie nun geradezu bei der Mama für Friedrichs neue Herren. Daraufhin begann auch diese, vertraulich mit ihnen zu sprechen und zu erklären, das Land werde es ihr noch einmal danken, was sie an dem Kronprinzen getan habe.
Erst an dem Morgen, an dem die Bärin sich im Tor erhob, ihr Fell schüttelte und sich reckte, als der Wagen des Königs über die Brücke rollte, begann sich die Stimmung zu ändern.
Rochow, der seinen Vater früh verloren hatte, betrachtete den König mit stärkerer innerer Anteilnahme, als der bloße Respekt vor dem allerhöchsten Herrn sie verlangte. Aber dazu war er zu jung, um zu ermessen, wie verändert, von Jahr zu Jahr, König Friedrich Wilhelm zum Herbste seinen Einzug auf Schloss Wusterhausen hielt.
Er kam nicht mehr als der Blühende, Leidenschaftliche, der kühn und kraftvoll Neues plante, wirkte, ordnete und flüchtige Ruhe bei den Seinen suchte: Frau, Kindern und Jagdkumpanen.
Er kam als einer, der das längst Begonnene und zu vielen Malen schon Zerstörte immer wieder von neuem aufnahm: Das Heer. Den Staat. Die Stadt. Die Kassen. Die Felder. Die Fabriken. Die Provinzen. Die Erziehung des Einen. Die Ehe.
* * *
Der späte Sommer war wie ein großes Feuer im Verlodern. Der Himmel war gelb. Die Sonne stand stumpf und rot und abgegrenzt in der Leere. Die Hitze ließ die Wälder weithin brennen. Der Anblick der Gärten in ihrer Welkheit und Dürre war sehr niederdrückend. Vor Trockenheit fiel alles Obst, noch ungereift, von den Bäumen. Die Wiesen waren wie versengt. Selbst in den sonst so kühlen Gängen des alten Schlosses und seinem Saal war es dumpf. Den König vermochte nur noch ein Kirschwein zu erfrischen, den ihm der Dessauer in großen Korbflaschen schickte.
Allen ging der Tag fast allein nur damit hin, dass sie in den Fensternischen hockten und das Gewitter erwarteten. Die Adler rollten ihre Kugeln an den Ketten dicht am Gemäuer vorbei, als suchten sie Schutz. Die Bärin schien zornig, und die Nähe des Herrn beunruhigte sie, anstatt sie wie sonst zu beschwichtigen. Unbewegte Glut und fauchender Sturm wechselten rasch. Die Bären vom Zaren waren vor dem Stall der Meute auf einen Haufen zusammengekrochen und jappten wie durstende Hunde; die Zungen hingen aus den offenen Mäulern.
Dann, um den Feierabend, kam das große Gewitter herauf, seit Wochen täglich erwartet: in unruhigen Blitzen, ohne Windhauch, die Luft nur mit rötlichem Staube erfüllend. Nur einzelne Tropfen fielen. Immer wieder trat die Sonne glühend aus dem Schwefelrauch, und jeder Flecken Sandes oder Grases, der nur irgend Feuchtigkeit empfangen hatte, wurde wie von einem heißen Dunste überloht.
Binnen einer Stunde waren es viele Gewitter, Blitz um Blitz und starke Schläge. Aber Wind und Kühle und Befreiung brachten sie nicht, nur so jähe Wolkenbrüche, dass es klang, als führen viele Landwagen eine holprige Straße entlang. Solcher Regen war zu schwer, um helfen zu können. Er schlug die Früchte, die Glut und Dürre noch gelassen hatten, von den Bäumen. Aber der Ausbruch so gewaltiger Gewitter nach so unbarmherzig heißen, lastenden Tagen hatte etwas Feierliches.
Die Kammerfrau Ramen, in federleichtem, feenweißem, weitem Kleide sprengte aus einem Kupferbecken in der Kammer der Königin Wassertropfen auf die Dielen. Das Bett der Herrin bezog sie vor den schwülen Nächten alltäglich mit frischem, kühlem Leinen. Sanfter und dienstbereiter war sie denn je, behender und stiller; und das Dunkel ihrer Augen war noch tiefer.
Nun wohnten Herr und Herrin wieder Tür an Tür.
* * *
Nachts stand der König lange vor der Schwelle, die ihn von der Gattin und einer Vergangenheit trennte, die ihm sehr weit schien. Der Regen rauschte nun doch so schwer und voll und ebenmäßig, als vermöchte er die verbrannte Erde noch einmal fruchtbar zu machen.
Als dann der König vor die Gattin trat, den Leuchter über sie erhebend, gewährte diese Nacht ihm den letzten Irrtum seiner einstigen Liebe. Als hätte sie Monat um Monat auf diese Stunde gewartet, blickte Sophie Dorothea beseligt lächelnd zu ihm auf.
Noch sah er schwer und traurig auf sie nieder, wie einer, der die letzte Unentrinnbarkeit erkennt, in die der Mensch geworfen ist.
Immer ernster sah der König auf das Lächeln seiner Frau.
Es war zu viel gewesen zwischen Herbst und Herbst.
Er kam zu der lächelnden Frau, wie einer, der von Gott geschlagen und an der Welt gescheitert ist.
* * *
Es war um die tiefste Stunde dieser Nacht gewesen, als er an ihrem Bettrand saß, sehr still und sehr lange.
Wenige Tage danach, als zur Freude der Königin unter all den Jagdgästen endlich, endlich auch einige der fremden Gesandten in die Einöde von Wusterhausen hinauskamen, hielt Ihre Majestät es für angebracht, einem dieser Herren sehr eindeutige Bemerkungen darüber zu machen, dass sie eine Stunde besonderer Vertrautheit und eine ungewöhnlich günstige und lange nicht beobachtete Stimmung des Königs sofort benützt habe, um ihn auf die neuen Briefe aus England vorzubereiten und vor der Lektüre bereits zu einer den beteiligten auswärtigen Höfen genehmen Antwort zu bestimmen. Sie war beseligt, die fremden Diplomaten wieder zu sprechen. Die Aktionen durften ja keine Unterbrechung erfahren! Der Sommer von Monbijou hatte ja den Sieg noch nicht entschieden.
Hätte doch der König auf jene letzte Höflichkeit verzichtet, die fremden Gesandten wie alljährlich zur Jagdzeit nach Wusterhausen zu bitten! Was half es nun dem König, dass er um den Sonnenuntergang als der beste aller seiner Schützen heimkam, abgelenkt und sogar ein wenig vergnügter.
Was half es ihm, Wusterhausen war ja doch in Monbijou verwandelt, und er konnte nicht dagegen an. Ein zu großer Plan stand auf dem Spiel. Er vermochte die vorzeitigen Heiratsprojekte für seine jungen Kinder nicht mehr mit rascher, unbekümmerter Geste beiseite zu fegen. Die Politik Europas hatte sich dareingemischt, verwickelt, verbissen. Und das seltsamste war, dass Monbijou die glückliche Lösung der englischen Frage nicht heftiger und sehnlicher begehren konnte als der Jagdherr und Wirt von Wusterhausen.
Nein, richtig lenkte ihn auch die Jagd nicht mehr ab, trotz der hundertfünfzig Hühner den Tag und obwohl er es in diesem Winter gar auf tausend Wildschweine zu bringen gedachte. An den Abenden gab es ja in den alten Mauern der Jagdburg doch nur das eine Gespräch als Traum oder Wille, Hoffnung oder Notwendigkeit, Phantasie oder Überlegung, Intrige oder Gebet.
Dieses Jahr wurde zum Malplaquetfest nicht zu dem Tanz der Offiziere aufgespielt. Der König wusste von einem anderen Tanze zu sagen – aber der war wild und wüst und hatte nach Allianzen, Pakten und Traktaten seinen wirren Namen.
„Es ist ein englischer Kontertanz“, so zürnte der König, „wo jeder Herr jeder Dame nacheinander die Hand reicht; und nicht eher als am Schlusse weiß man, welche Paare zusammengehören.“
Von solcher Art war der Malplaquet-Tanz dieses Jahres.
Das Wild aber, das sie in diesem Herbst von Malplaquet bis Sankt Hubertus jagten, war König Ragotin selbst. Nun, nach dem Tode des alten Ilgen, war er ja ohne den Rat und Beistand des greisen Ministers, der nach seines eigenen Herrn Worten „so viele, viele Avantagen für dieses Haus zu Wege gebracht“. Außer als Manufakturist, als Landwirt und als Korporal nahm man den König nirgends mehr ernst. Aber der Agrarier, Fabrikant, Armeeinspekteur und -instrukteur und Generaldirektor war für fremde Zwecke auch weiterhin noch sehr begehrt. Und so ließ Europa den Verachteten nicht los, der mit dem selbstgewählten Namen „Bettelkönig“ wohl doch nur seinen argen Geiz verhüllte. Man sprach von ihm nicht mehr anders als mit Achselzucken und Köpfeschütteln. Er war schwerkrank. Er lebte in Zerfall mit seinem Hause. Er hatte sich in einen unglückseligen Reichspatriotismus verstrickt, den er mit dem Verzicht auf allen Aufstieg seines Hauses bezahlen musste. Er hatte sich im Osten in eine Fehlspekulation von noch nicht dagewesenem Ausmaß hineinreißen lassen. Er hatte die fremden Staaten und die eigenen Länder gegen sich. Aber seine alten Städte waren entschuldet und neue Städte wuchsen; seine Armee paradierte auf immer glanzvolleren Revuen in immer größerer Stärke. Seine Magazine, mochten sie Waffen oder Tuche und Stiefel bergen, waren immer üppiger gefüllt, und insbesondere schienen seine neuen Straßen gut zum Marschieren. Anfangs war König Ragotin wohl doch ein tüchtiger Mann gewesen. –
Es war noch ein Geheimnis um ihn; und verlockend war, es zu lösen; verlockender noch, den verwirrten und überanstrengten Mann bis zum Wahnsinn zu treiben und sich seines ängstlich geheimgehaltenen Besitzes zu bemächtigen. Peinlich und schwierig war nur, dass man noch so gar keine klare Vorstellung davon erlangen konnte, wer alles in dem Kuratorium würde mitbestimmen wollen, das dereinst – man hoffte: bald – den armen Kranken unter Kuratel zu stellen hatte.
Aber es galt, rasch zuzupacken. Sonst vergeudete er im Nu wieder alles Errungene und Erworbene an seinem wahnwitzigen Gedanken, sein ödes, krankes, unheilschwangeres Ostland – das wahrhaftig den Namen eines Bettelkönigs rechtfertigte – zum fruchtbaren Königreich zu machen, ebenbürtig den alten, schönen und gewaltigen Reichen Europas, denen zu dienen für das neue Preußen eigentlich höchste Ehre bedeuten musste.
Es galt, ihn schleunigst festzunageln. Denn wenn der Brandenburger in ihre Allianzen nicht mit eintrat, so war den anderen ihr Konzept und ihre Tabulatur verrückt.
„Europa ist von neuem in einer Krisis“, schrieben die fremden Gazetten, „wenn es in diesem Herbste nicht zum Krieg käme, müsste man staunen.“
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.