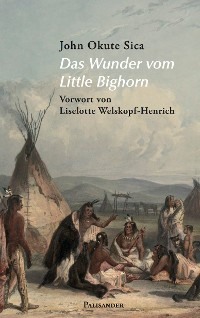Kitabı oku: «Das Wunder vom Little Bighorn», sayfa 2
Wood Mountain heute
Im Jahre 2007 betrug die Zahl der Stammesmitglieder der Lakota von Wood Mountain 218, von denen jedoch lediglich 13 auf dem Gebiet der Reservation leben. Seit 2005 ist Ellen LeCaine, eine Enkeltochter des Autors, Häuptling des Stammes. In Zusammenarbeit mit anderen traditionsbewußten Familien ist sie bestrebt, alte Bräuche, wie das alljährliche Powwow, aufrechtzuerhalten bzw. sie wiederzubeleben, und den Zusammenhalt der Stammesmitglieder zu stärken. Hierbei werden die Wood-Mountain-Lakota auch von Stammesgenossen aus den alten Reservationen in den USA tatkräftig unterstützt. Auf dem Powwow von 2008, an dem unter anderen ein Ururenkel Sitting Bulls teilnahm, haben die Nachkommen John Okute Sicas ihr Einverständnis zu diesem Buchprojekt erklärt.

Powwow auf der Reservation von Wood Mountain, 2008.
Zum Text
John Okute Sica verfaßte die in diesem Band vereinigten Erzählungen über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten in englischer Sprache. Von Kindheit an war er sich dessen bewußt gewesen, Zeuge des Untergangs der Welt der Sioux zu sein. Es war sein Wunsch, dieser Welt ein literarisches Denkmal zu errichten, indem er getreu davon berichtete, was er von den Alten erfahren hat. Auf diese Weise hat er eine Sammlung von Geschichten geschrieben, die in der indigenen Literatur Nordamerikas einzigartig dastehen dürfte. Die wenigen anderen indianischen Autoren, die selbst noch die traditionelle Lebensweise ihrer Stämme kennenlernten, haben zumeist vorwiegend autobiographische Schriften verfaßt. Auch beherrschten sie oft die englische Sprache nicht ausreichend, so daß sie auf die Hilfe weißer Autoren angewiesen waren. John Okute Sica hingegen verfügte über einen sehr reichen englischen Wortschatz, auch wenn seine Muttersprache Lakota war, und Autobiographisches spielt in seinem Werk nur eine untergeordnete Rolle. Seine Erzählungen stehen ganz in der Tradition der mündlichen Überlieferung seines Stammes und sind in deren kraftvollem Erzählstil verfaßt.
Mit der Erzählung »Maiden Chief« hat John Okute Sica den wahrscheinlich ersten (Kurz-)Roman der Sioux geschaffen. Er beruht auf der Geschichte »Amber Moon«, die ebenfalls in diesen Erzählband aufgenommen wurde und welche eine authentische Begebenheit wiedergibt, die sich wahrscheinlich im 18. oder frühen 19. Jahrhundert zugetragen hat. Der reichhaltige Stoff dieser Erzählung inspirierte den Autor dazu, die Handlung in die Endzeit seines Volkes zu verlegen, d. h., in die Zeit um 1860, ein Kunstgriff, der ihm eine detaillierte Darstellung des Lebens gestattete, das die Generationen seiner Eltern und Großeltern geführt haben und das er zum Teil selbst noch kennengelernt hat.
John Okute Sica und Liselotte Welskopf-Henrich
Ein mit dem Autor befreundeter Lehrer aus Wood Mountain, Michael O’Krancy, hat dessen Geschichten mit der Maschine abgeschrieben und behutsam lektoriert. In dieser Form hat die Witwe des Autors die Texte Liselotte Welskopf-Henrich übergeben, damit sie sie in deutscher Sprache veröffentlichen lassen könne. Trotz größter Bemühungen – die Schriftstellerin übersetzte z. B. drei der Erzählungen selbst ins Deutsche bzw. erzählte sie nach – gelang es Liselotte Welskopf-Henrich nicht, einen Verlag für dieses Projekt zu finden. Sie war jedoch so tief von der Persönlichkeit John Okute Sicas wie auch von seinen Geschichten beeindruckt, daß sie ihn in ihrem Roman »Nacht über der Prärie« in der Gestalt des »Harry Okute«, der in »Wood Hill«, Kanada, lebte, verewigte. Sie verwendete den Vornamen Harry, um die Verbindung zu ihrem Romanzyklus »Die Söhne der Großen Bärin« herzustellen, dessen Hauptheld von den Weißen Harry genannt wurde.
John Okute Sicas Erzählung »Ité-ská-wí« diente als Namensgeberin für ihren letzten Roman, »Das helle Gesicht«. In diesem Roman spielt ein Mädchen gleichen Namens eine wichtige Rolle, und die historische Ité-ská-wí aus der Erzählung wird als dessen Ururgroßmutter dargestellt.8
Das Typoskript der Erzählungen wurde im Nachlaß Liselotte Welskopf-Henrichs aufbewahrt und dem Palisander Verlag durch ihren Sohn, Dr. Rudolf Welskopf, übergeben. Es diente als Grundlage für die Übersetzung.9
Zur Übersetzung
Bei der Übersetzung der Erzählungen wurde größter Wert darauf gelegt, die kraftvolle und poetische Sprache des englischen Originals so getreu wie möglich wiederzugeben. Der Autor benutzt mitunter Begriffe, die heute nicht mehr als »politisch korrekt« gelten, so z. B., wenn er von »Wilden« und »Rassen«, vom »Roten Mann« und vom »Weißen Mann« oder von »Negern« spricht. Diese Begriffe wurden nicht verändert, um die Authentizität zu wahren.
Auch lehnen heute viele Lakota die Bezeichnung Sioux ab, da diese ursprünglich eine abwertende Bedeutung besaß.10 Für John Okute Sica sind »Sioux« und »Lakota« hingegen wertgleiche Synonyme.11
Die Schreibweise der Lakotabegriffe wurde auf vereinfachte Weise an diejenige im »New Lakota Dictionary«12 angepaßt. Für folgende Buchstaben sind Besonderheiten in der Aussprache zu beachten:
n – am Wort- und Silbenende wird das »n« nasal ausgesprochen, wie in »Balkon«
z – stimmhaftes »s« wie in »Silber«
s – stimmloses »s« wie in »Haus«
š – wie das »sch« wie in »Schulter«
č – wie das »tsch« wie in »Tschechien«
ž – stimmhafter Laut wie das zweite »g« in »Garage«
w – wie das englische »w« in »why«
ch – wie das »ch« in »Bach«
Des weiteren wurden Betonungszeichen über Vokalen gesetzt.
Der Autor hat in den meisten Fällen die englischen Namen der indianischen Protagonisten verwendet. Dies wurde in der deutschen Übersetzung beibehalten.
Frank Elstner, September 2009
I
Die Welt der alten Lakota

Die Pfeife des Weißen Büffelkalbs
Die Lakota aus der Nation der Sioux nannten Nordamerika Ikčé Wičáša Makóče, das Land des eingeborenen Menschen. Dieses Land wurde ihnen vor über tausend Jahren vom Großen Geist, Wakán Tánka, geschenkt, damit sie es sich zu eigen machten und es bewahrten.
Für die Indianer war Nordamerika buchstäblich ein »Land, wo Milch und Honig fließen«. Es war voll von Wild, Früchten und Wildgemüse. Wasser strömte aus zahllosen Quellen, und das ganze Land war von Flüssen durchzogen, die in Seen jeder Größe mündeten, welche von Fischen und Wassergeflügel wimmelten. Es war ein Paradies, in dem die Menschen sich nicht im Schweiße ihres Angesichts für Nahrung, Kleidung und eine Behausung abplagen mußten. Auch war es nicht erforderlich, feste Wohnstätten zu bauen. Was die Menschen brauchten, war ein Unterschlupf, der es ihnen ermöglichte, in allen Zeiten des Jahres Schutz vor den Elementen zu finden. Ein großes Lederzelt, das sie Tipi nannten, erfüllte all ihre Ansprüche an eine Unterkunft. Die Lakota lebten nie in Höhlen, denn sie liebten das Abenteuer. Stets lockte sie die Ferne, und sie pflegten ihrem Lockruf zu folgen. Auch Indianer aus anderen Stämmen konnten sie nicht davon abhalten, dort umherzustreifen, wo sie es wollten. Die Lakota kämpften mit jedem, der ihnen diese Freiheit zu verwehren versuchte.
Würde man einen Lakota fragen, woher er stamme, so würde er voll Ehrfurcht antworten: »Ich stamme aus dem Süden. Dort wurde unser Volk geboren.« Vielleicht werden Wissenschaftler eines Tages entdecken, daß der Rote Mann Nordamerikas aus Südamerika kam, und daß seine Spuren sich womöglich sogar bis Afrika zurückverfolgen lassen, wo der Große Geist zuerst die Sprachen der Menschen vervielfältigt hatte.
Natürlich war auch in Nordamerika, dem Garten Eden der Sioux, das Leben mit Not, Leid und Schmerz verbunden, doch dies wurde als ein geringes Übel hingenommen angesichts der Schönheit und der Freuden des Lebens. Früher besaßen die Indianer keine Pferde als Lasttiere, aber statt dessen hatten sie Hunde. Diese Hunde waren noch eng mit dem Wolf verwandt. Sie waren stark und zäh und verrichteten alle Arbeiten mit großer Ausdauer.
Der Sioux liebte seine Welt und sein Land von ganzem Herzen. Er kannte seinen Gott, den er den »Großen Geist«, Wakán Tánka, nannte, oder auch Até, Vater. Das Wissen von diesem Gott war ein natürliches, das ihm im Herzen und im Verstand eingeprägt war. Der Sioux verehrte seinen Gott und fürchtete ihn. Auf seine einfache und bescheidene Art sah und fühlte er seine Gegenwart auf der Erde, im Himmel und in allen Dingen.
Der Begriff der Sünde und alle Qualen, alle Raserei, die damit verbunden sind, waren dem Indianer unbekannt. Auch ohne das Wissen um Gut und Böse war seine Seele standhaft.
Der Himmel aber wollte nicht, daß seine unwissenden Kinder dereinst in die Hände des Bösen fallen könnten. Aus diesem Grund wurde eine Frau zur Nation der Sioux entsandt.
Die Erscheinung
Einst lag das Kerngebiet der Sioux dort, wo sich heute der Staat New York befindet. Zu der Zeit, da die folgende Geschichte sich abspielte, herrschte gerade große Not.
An einem schönen Sommertag verließen zwei junge Männer das Lager ihres Stammes, um zu jagen. Sie liefen über eine kleine Hochebene. Plötzlich wurden sie von einem grellen Blitzstrahl geblendet. Als sie wieder etwas erkennen konnten, erblickten sie in der Nähe eine schöne Frau. Vor Überraschung wie gelähmt starrten sie die Erscheinung an.
Einer von ihnen war von kühner Wesensart. Er fand als erster die Sprache wieder. »Verschwinde von hier«, sagte er zu seinem Gefährten, »ich werde zu der Frau gehen, ich habe etwas mit ihr vor.«
»Sag nicht so etwas«, schalt dieser. »Siehst du denn nicht, daß sie ein übernatürliches Wesen ist?«
»Übernatürlich? Unsinn!« antwortete der dreiste Jüngling. »Das ist eine von den Frauen, die aus unserem Lager weggelaufen sind. Geh mir aus den Augen, rasch!«
Der andere versuchte fortzugehen, aber er vermochte sich nicht zu bewegen. Er stand wie angewurzelt und hatte nur Augen für die Frau. Er sah, wie sein Gefährte sich der Erscheinung näherte. Doch kurz bevor er sie erreichte, stieg plötzlich eine Rauchwolke vom Boden auf und umhüllte beide. Als der Rauch sich verzogen hatte, war nur noch die Frau zu sehen, die genauso dastand wie zuvor. Sie sagte: »Komm her! Aber wenn du Böses im Schilde führst, wird es dir ergehen wie dem, der zu meinen Füßen liegt.«
Als der junge Mann nähergekommen war, sah er, daß vor der Frau die Gebeine seines Gefährten lagen. Sie waren weißgebrannt, und dennoch war keine Spur eines Feuers zu erkennen. Die Vegetation auf dem Boden war vollkommen unbeschädigt.
Wieder sprach die Erscheinung: »Fürchte nichts. Ich habe die Not deines Volkes gesehen, und ich bin gekommen, um ihm zu helfen. Geh und sag deinem Volk, daß es ein neues Tipi in der Mitte des Lagerkreises errichten möge. Dorthin werde ich kommen und zu ihm sprechen. Die Öffnung des Tipis soll nach Süden zeigen, und ein Adler mit gespreizten Flügeln, den Schwanz nach unten, soll über die gesamte Höhe des Tipis gemalt werden. Der Eingang soll sich mitten in seinen Schwanzfedern befinden. Sobald das Tipi fertig ist, werde ich kommen. – Du kannst jetzt gehen.«
Der Jüngling konnte sich später nicht daran erinnern, was er getan und empfunden hatte, bevor er das Ratszelt seines Stammes erreichte. Dort erzählte er seine Geschichte und kam dabei endlich wieder vollkommen zu sich. Man schickte ihn, begleitet von zwei Männern, an den Ort der Erscheinung zurück.
Aufmerksame Augen hatten den Jüngling zum Ratszelt rennen und ihn dann mit seinen Begleitern eilig von dort wieder aufbrechen sehen. So kam es, daß sich bei der Rückkehr der drei eine große Zahl Leute vor dem Zelt versammelt hatte.
»Wir fanden die weißgebrannten Knochen eines Jünglings, aber keinerlei Anzeichen für ein Feuer und auch sonst keine Spuren, außer zwei, die zu dem Ort hinführten und einer Spur, die von ihm wegführte«, berichteten die beiden Männer, die den jungen Mann begleitet hatten.
Große Aufregung herrschte unter den Leuten, als ein Stammesausrufer verkündete, was sich ereignet hatte und was geschehen sollte. Unverzüglich wurden frisch gegerbte Büffelhäute für das neue Tipi gespendet, und zahlreiche Frauen erklärten sich bereit, sie zusammenzunähen. Freiwillige unter den Männern wollten das Holz für Zeltstangen und Zeltpflöcke schlagen und bearbeiten. Sämtliche Künstler des Stammes erboten sich, den Adler für die Frau zu malen.
Der Jüngling, der die Botschaft überbracht hatte, fand keine Ruhe mehr. Er war zur wichtigsten Person im ganzen Lager geworden. Wieder und wieder erzählte er die Geschichte jedem, der ihn darum bat, bis er schließlich von einem Augenblick zum anderen vollkommen erschöpft in Schlaf sank.
In der Mittagsstunde des folgenden Tages war ein außergewöhnlich großes Tipi im Herzen des Lagers errichtet worden. Sämtliche Stammesmitglieder, selbst die Krüppel und die Kranken, hatten sich beim Zelt der Frau versammelt und warteten ungeduldig auf ihre Ankunft.
Plötzlich schrie jemand aus der Menge: »Dort kommt jemand!«
Im Süden, der Richtung, aus der die Bewohner Nordamerikas einst gekommen waren, stand eine Person und musterte die Szene, die sich ihr bot.
Ein Mann rief aus: »Es ist eine Frau, ein Mädchen!«
Alle beobachteten stumm, was geschehen würde. Es war vollkommen still, abgesehen von ein paar Leuten, die Gebete murmelten. Die Frau schritt langsam, doch kam sie dabei erstaunlich schnell voran. Sie hatte das Tipi in kürzerer Zeit erreicht, als es einem gewöhnlichen Menschen möglich gewesen wäre. Sie trug die Stammeskleidung der Sioux, doch das Leder war von feinerer Beschaffenheit als üblich. Das lange Haar trug sie gescheitelt und in Zöpfen geflochten. Ihre Haut war braun wie die der Sioux. Die dunklen Augen waren voll Liebe und Zärtlichkeit. Ihre ganze Erscheinung war ein Ausdruck der Vollendung, der Schönheit. Wen sie anblickte, dessen Herz hatte sie bereits gewonnen. Tatsächlich lächelte sie niemandem direkt zu, sah niemandem direkt in die Augen. Und doch schien es, als würde sie jedes einzelne Gesicht in der Menge wahrnehmen. Sie wirkte nachdenklich, als suchte sie nach Worten.
Die Frau stand nun mit dem Rücken zum Zelteingang und musterte die Leute, die sich vor ihr zu Boden gesetzt hatten. Als sie sprach, war ihre Stimme lieblich und weich und voll Mitgefühl. »Meine Verwandten«, sagte sie, »ich habe eure Bedrängnis gesehen und bin gekommen, um euch zu helfen. Die Art, wie ihr den Großen Geist verehrt, gefällt ihm nicht ganz. Aus diesem Grunde habe ich euch das hier mitgebracht.«
Niemand in der großen Menschenmenge hatte gesehen, daß sie etwas bei sich getragen hatte, bevor sie es in die Höhe hob, damit alle es sehen konnten.
»Diesen Gegenstand werdet ihr Čannúnpa, die Pfeife, nennen. Sie wird euch bei euren Gebeten an den Großen Geist sehr nützlich sein. Wenn ihr sie so verwendet, wie ich es euch zeige, dann werden eure Bitten an euren Gott leichter erhört und es wird euch größerer Segen zuteil werden«, erklärte die Frau. »Nach jeder Generation werdet ihr eine Kerbe in den Schaft dieser Pfeife ritzen. Fahrt damit fort, bis kein Platz für neue Kerben mehr vorhanden ist. – Zieht nun in Richtung Sonnenuntergang. Geht so lange, bis ihr nicht mehr weiterkönnt. Das Land, das ihr dort findet, werdet ihr zu eurer Heimat machen. Dort werdet ihr ein besseres Leben führen können.«
Sie wandte sich den Häuptlingen und Würdenträgern zu und winkte einen von ihnen zu sich. Sie sagte ihm: »Von nun an sei dein Name Elk’s Head. Du wirst der Bewahrer und Beschützer der Pfeife sein.« Daraufhin unterwies sie den Mann in der Art und Weise, wie die Pfeife zu benutzen sei. Schließlich wandte sich die Frau wieder den Leuten zu und fuhr fort: »Wenn der Hüter dieser Pfeife stirbt, so werdet ihr einen neuen bestimmen, dessen Blut rein und dessen Herz frei vom Bösen ist. Sein Name sei Elk’s Head.«
Dann erklärte sie: »Eure Regeln für die Heirat sind grundfalsch und mißfallen dem Großen Geist. Sie gefährden eure Rasse.« Sie erläuterte den Sioux die neuen Regeln und bestand darauf, daß diese unbedingt einzuhalten seien. Blutsverwandte durften hinfort nicht mehr wagen, einander zu ehelichen. – Bis zum heutigen Tag werden diese Regeln von vielen Sioux sorgsam eingehalten, und selbst eine entfernte Blutsverwandtschaft gilt als Grund, nicht heiraten zu dürfen. Die Frau sprach über viele weitere Dinge. Sie erklärte den Sioux, was sie in ihrem Alltagsleben ändern mußten und erteilte ihnen auch Ratschläge spiritueller Art.
Ohne ein Wort des Abschieds ging sie plötzlich mit vor Bekümmerung gesenktem Haupt fort. Wieder schritt sie langsam dahin und kam dabei erstaunlich schnell voran. Sie ging in Richtung Süden, von wo aus sie gekommen war. Viele begannen zu weinen, noch bevor sie außer Hörweite war. An der Stelle, wo sie zuerst erschienen war, blieb sie stehen, wandte sich um und betrachtete einige Augenblicke lang die Leute. Dann verschwand sie.
Wie Kinder, die den Verlust der Mutter beweinen, so vergoß das ganze Volk Tränen des Kummers und der Sorge. Tagelang trauerte man über den Weggang der Frau, die die Pfeife gebracht hatte.
Die Friedenspfeife
Von jenem Tag an kannte man die Pfeife und den Gebrauch des Tabaks. Da sie ein religiöser Gegenstand war, wurde die Čannúnpa ehrfurchtsvoll aufbewahrt und nur für Gebete und zur Meditation benutzt. Schon bald hatte man Kopien davon angefertigt, die die Familienoberhäupter nach den Regeln, die die Frau sie gelehrt hatte, verwendeten. Diese Pfeifen wurden abends geraucht, in der Stunde des Gebets. Niemand rauchte Tabak, um sein Verlangen danach zu befriedigen, wie dies später bei dem Weißen Mann der Fall sein sollte, nachdem er den Gebrauch des Tabaks erlernt hatte.
Man ging auf sehr feierliche Weise mit der Pfeife um. Ehrerbietig wurde sie mit Tabak gestopft. Dann wurde sie als symbolische Gabe emporgehoben, erst in Richtung Süden, dann in Richtung Westen, danach in Richtung Norden und schließlich in Richtung Osten. Daraufhin wurde sie dem Himmel dargeboten und am Ende der Erde. Währenddessen wurde ein Gebet gesprochen: »Vater, Großes Geheimnis, ich bitte dich, diese Pfeife wahrzunehmen und mir den Segen zuteil werden zu lassen, dessen ich und die meinigen bedürfen. Gewähre, daß kein Unheil über mein Volk komme.« Nun wurde die Pfeife mit Hilfe von brennendem geflochtenen Süßgras entzündet und geraucht. Waren mehrere Männer in einem Tipi versammelt, so wurde die Pfeife im Kreis herumgereicht, und jeder rauchte ein paar Züge.
Nachdem die Frau in den Hügeln verschwunden war, wurden zwei junge Männer ausgesandt, damit sie in Erfahrung brachten, wohin sie gegangen war. Unterdessen warteten alle Leute bei dem großen Zelt auf die Rückkehr der Kundschafter. Schon bald kehrten sie zurück. Sie erzählten: »Wir haben keine Spur von der Frau entdecken können. Alles, was wir gesehen haben, war ein Albinobüffelkalb, das in südliche Richtung lief. Es war genau dort, wo die Frau sich hätte befinden müssen, wäre sie mit ihrer Geschwindigkeit weitergelaufen.«
Ein Jahr darauf wurde bei einer Büffeljagd ein Albinokalb getötet. Es hieß, daß es menschliche Ohren gehabt habe. Die Sioux waren zutiefst bestürzt. »Das war die Frau, die uns die Pfeife brachte!« riefen sie schluchzend. Der Hüter der Pfeife ordnete an, daß die Ohren des Albinobüffelkalbs abgeschnitten und ihm gebracht würden. So geschah es. Die menschlichen Ohren wurden an die Pfeife gebunden, und den Körper des Kalbs ließ man verrotten.
* * *
Seit jenem Tag und bis heute wurde die Pfeife als die Pfeife des Weißen Büffelkalbs bezeichnet. Am Schaft dieser größten aller Reliquien der Sioux wurden bereits 14 Kerben eingeritzt, die 14 Generationen repräsentieren bzw. etwa 980 Jahre. Die letzte Kerbe wurde um 1870 angebracht, wenige Jahre bevor die Welt der Sioux zusammenbrach. Das heißt, daß die Tradition der Friedenspfeife heute über tausend Jahre alt ist.
Unter den Sioux, die gemeinsam mit Sitting Bull nach Kanada in die Gegend von Wood Mountain geflohen waren, befand sich Elk’s Head, der Hüter der Pfeife. Eine Zeitlang, von 1876 bis 1882, ist die Pfeife in Kanada geblieben. Später ist sie entweder in die Pine-Ridge-Reservation oder in die Cheyenne-River-Reservation gebracht worden, wo sie verborgen wurde und wo sie sich seither befindet. Bevor Elk’s Head, ihr letzter Hüter, starb, vertraute er die Pfeife seiner Tochter an und nicht einem seiner beiden Söhne, denn er kannte seine Kinder gut. Seine Tochter ist ihrem eingeborenen Glauben treu und furchtlos wie ein Krieger. Sie ist eine wahre Löwin.13
1931 beauftragte die Yale University Professor Scudder Mekeel damit, die Geschichte der Sioux zu studieren. Vier oder fünf Jahre lang lebte Mekeel auf verschiedenen Reservationen in den Vereinigten Staaten und in Kanada unter den Sioux. Der Professor erzählte mir: »Beinahe wäre ich der erste Weiße gewesen, der je die Pfeife des Weißen Büffelkalbs zu Gesicht bekommen hätte. Hätte ich 35 Dollar in bar bei mir gehabt oder hätte die Frau, zu der mich ihr Bruder geführt hatte, meinen Scheck über diesen Betrag akzeptiert, hätte ich die Pfeife sehen können. Aber dann begannen die Frau und ihr Bruder sich zu streiten. Da sie sich in der Siouxsprache stritten, konnte ich nichts verstehen und keine Hilfe anbieten. Schließlich ergriff der Bruder, der sehr wütend auf seine Schwester war, meinen Arm und sagte mir: ›Kommen Sie, wir gehen fort von hier. Sie hat nicht das Recht, eine Gebühr dafür zu verlangen, etwas zu zeigen, das ihr nicht gehört.‹ – Ich wußte, daß es keinen Sinn hatte zu widersprechen. Wahrscheinlich brauchte die arme Frau einfach Geld und war daher bereit gewesen, ihren Schwur zu brechen, die Pfeife niemals auszustellen oder jemandem zu zeigen.«
* * *
Dem Wunsch der Frau folgend, die die Pfeife gebracht hatte, wanderte das Volk der Sioux allmählich westwärts, immer in Richtung der untergehenden Sonne. Es war eine Wanderung, die sich über Jahrhunderte hinzog. Auf ihrem Weg trafen die Sioux auf mächtige Stämme, mit denen sie so lange kämpften, bis sie sie schließlich besiegten. Sie rangen mit den Naturgewalten und überquerten reißende Ströme. Nichts vermochte sie aufzuhalten. »Geht immer weiter in Richtung der untergehenden Sonne«, hatte die Frau gesagt, »bis ihr nicht weitergehen könnt.«
Während die Sioux nach Westen vordrangen, verbreitete sich die Geschichte der Pfeife auf unterschiedlichen Wegen. Freigelassene oder entflohene Gefangene der Sioux erzählten ihren Stammesgenossen davon, und von diesen gelangte das Wissen zu anderen Stämmen.
Es verging eine lange Zeit. Doch dann erschien im Osten der Weiße Mann. Er war ein haariges Wesen, das die Sioux Geistermann nannten, Wašíčun. Der Geistermann kam gemächlich und verstohlen ins Land, er war schlau. Mit einem Zauber, einem unwiderstehlichen Zauber belegte er die eingeborenen Menschen, so daß er fest im Lande Fuß fassen konnte. Dann begann er sie zu bekriegen.
Zu jener Zeit hatten die Sioux die Black Hills14 im heutigen South Dakota erreicht. Es war das verheißene Land. Ohne zu wissen, warum, blieben sie in diesem Gebiet. Ja, sie wanderten noch weiter westwärts, aber immer wieder kehrten sie zu den Black Hills zurück. Dort fanden ihre Herzen Frieden und Glück, und sie konnten nicht weiterziehen. Das Land um die Black Hills wimmelte von Büffeln, dem König der Prärie, von Wapitihirschen und vielen anderen Tieren. Früchte, Wildgemüse und Wildgeflügel aller Art gab es im Überfluß. Schon bald tauchte das Pferd, Šúnkawakán, auf. Es war aus den Gebieten der Weißen gekommen. Als den Sioux das Pferd in die Hände gefallen war, hatte sich das Versprechen der Frau erfüllt. »Das Leben wird dort für euch erträglicher sein«, hatte sie gesagt.
Doch es gab etwas in diesem »gelobten Land« der Sioux, das letztendlich den Untergang ihres Volkes und ihrer Welt herbeiführen würde: Silber und Gold. Im Leben der Sioux hatten diese Dinge keinen Platz. Man konnte sie nicht essen, sich nicht mit ihnen kleiden und sie nicht als Medizin verwenden. Es waren Metalle und damit nicht mehr wert als Steine. – Ein Fluch waren das Silber und das Gold! Die Black Hills waren voll davon, und das war der Grund, weshalb die Vereinigten Staaten die heiligen Verträge gebrochen haben, die sie unter Eid mit den Sioux geschlossen hatten. Die Sioux ihrerseits hatten auf die Pfeife des Weißen Büffelkalbs geschworen, sie einzuhalten.