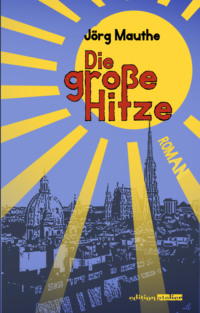Kitabı oku: «Die große Hitze», sayfa 3
ZWEITES
HAUPTKAPITEL
IN WELCHEM DR. TUZZI MITHILFE BEI DER
VERFERTIGUNG VON GESCHICHTE LEISTET
Meine Ergebenheit, Herr Legationsrat«, sagte der Portier Karneval und legte grüßend die Hand an die Kappe mit dem breiten Silberband, das ihn als einen den höheren Türsteherrängen der Republik angehörenden Beamten auswies. Herr Karneval war ein Ernster Bibelforscher und vertrat als solcher sehr entschieden die Meinung, daß die herrschende Große Hitze in unmittelbarem Zusammenhang mit der Schlechtigkeit und dem verworfenen Treiben der Menschen im allgemeinen, insonderheit aber der Politiker, hoher Beamter, Journalisten und überhaupt in irgendeiner Weise vorgesetzter Personen stehe; daß die Große Hitze ein nahes Armageddon ankündigte, lag für Herrn Karneval, der täglich die Aussagen des Wetterberichtes mit denen der Apokalypse verglich, auf der Hand, und der Gedanke, daß alle Herrschenden dieser Welt, Legationsräte eingeschlossen, zum Höllenpfuhl verdammt waren, er selbst aber als Gerechter ins Paradies aufsteigen würde, erfüllte ihn mit stiller Zufriedenheit. Aber auch unter dem Entsetzensschall der Gerichtsposaunen würde Herr Karneval Tuzzi nicht anders als in »Ergebenheit« grüßen, und wenn die göttliche Gerechtigkeit ihn dazu verpflichtete, die Glut unter dem Kessel eines zu ewiger Pein verdammten Tuzzi kräftiger anzuheizen – was durchaus in seinem Vorstellungsbereich lag –, würde er auch das nicht ohne ein submisses »Gestatten ergebenst« tun, denn das ist nun einmal die Anrede, die ein Portier einem Legationsrat Erster Klasse schuldig ist.
Der Mensch kann sich offenbar auch die Hölle nicht ganz ohne Regeln und Regulation vorstellen – vom Paradiese ganz zu schweigen. Und solcherart bietet der Portier Karneval einen schönen Beweis dafür, daß das in uns tief verwurzelte Ordnungsbedürfnis bis zu den Letzten Dingen hinein und hinüber reicht.
»Kompliment, Herr Doktor«, sagte hingegen der Ministerialrat Haberditzl, der stets als erster im Amte war, die Morgenpost bereits gelesen hatte und sich nun, die amtliche »Wiener Zeitung mit dem Amtsblatt« in der Hand, auf dem Wege zur Toilette befand. Er war im Range dem Legationsrat gleichgestellt und überdies der Ältere, hätte also ohne weiteres den Gruß Tuzzis abwarten und sich dann mit einem freundlichen »Grüß’ Sie Gott, Herr Kollege« revanchieren können; daß er dies nicht tat, sondern als erster und noch dazu mit einer verhältnismäßig subalternen Formel grüßte, hatte seine Ursache darin, daß er Tuzzi erstens mochte und ihm zweitens im Hinblick auf dessen höheren Intellekt und akademischen Grad freiwillig eine gewisse Überlegenheit einräumte. Der Legationsrat, der seinerseits den Ministerialrat Haberditzl sehr schätzte, bedankte sich infolgedessen, wie allmorgendlich, mit einem solennen »Respekt, Herr Ministerialrat!«, obwohl an sich ein »Kompliment meinerseits!« auch genügt hätte.
»Ich habe die Ehre!« sagte sodann der Amtsgehilfe Brauneis, beflissen die Tür zu Tuzzis Büroräumen offen haltend, wo er eben die interne Morgenpost abgelegt hatte.
»Morgen, Herr Brauneis!« antwortete Tuzzi und trat ein. Und obwohl er dicht an Brauneis vorüberschritt, bewegte er sich dabei doch in einem Abstand von geradezu interstellarer Dimension an ihm vorbei, denn jenes »Habe die Ehre!« und dieser schmucklose »Morgen!« markierten die äußersten Positionen der bis ans Unendliche heranreichenden Stufenleiter bürokratisch-hierarchischen Denkens2.
»Die Akten vom Herrn Ministerialrat bring’ ich dann herüber, wenn’s recht ist«, sagte Brauneis.
»Ist schon recht«, sagte Tuzzi, der es mit der Vertiefung in die Twarochschen Agenden wirklich nicht eilig hatte.
Um Punkt halb neun also betrat der Legationsrat das kleine Vorzimmer seines Amtsraumes, stellte enttäuscht fest, daß seine Bürodame auch heute nicht erschienen war (weil sie sich einen Urlaubstag oder Ausgleichsfreizeit genommen hatte oder weil sie an einer der vielen derzeit grassierenden Hitzemaladien litt oder aus irgendeinem anderen zutreffenden oder schwer widerlegbaren Grund; die Arbeitsmoral des Büropersonals ließ in letzter Zeit erschreckend nach), öffnete sodann die gepolsterten Türen zum Arbeitszimmer und sah auf seinem Schreibtisch tatsächlich schon das gelbe, zweifach versiegelte und mit den roten »Vertraulich!«- und »Persönlich!«-Klebemarken versehene Kuvert, in dem zweifellos die stenographische Mitschrift der gestrigen Ministerratssitzung steckte.
Tuzzis Stimmung pendelte sich, besänftigt von den ruhigen Gesetzmäßigkeiten des Hauses und beruhigt durch das vertraute Ambiente seines Zimmers, rasch auf das Normalmaß der bedächtigen Selbstverständlichkeit ein. Der moralische Schwächeanfall, den er vorhin im Hofburgdurchgang gehabt hatte, erschien ihm jetzt unbegreiflich, und der Gedanke daran beschämte ihn so sehr, daß er beschloß, eine kleine Buße dafür auf sich zu nehmen und sein Tagwerk nicht wie sonst mit der ersten Zigarette, sondern mit der sofortigen Übertragung des Ministerratsprotokolls zu beginnen.
Diese Arbeit gehörte zu den wichtigsten Pflichten, die der Legationsrat im Rahmen des Interministeriellen Komitees für Sonderfragen übernommen hatte, denn natürlich war hier nicht einfach eine stenographische Niederschrift in allgemein lesbare Schreibmaschinzeilen zu transponieren, sondern in der Tat eine wahre Übersetzung vorzunehmen, indem man das Protokoll von allen Zufälligkeiten, Subjektivitäten und Aktualitätsbezügen aufs gründlichste reinigte und das Übrigbleibende so lange einem veredelnden Abstraktionsprozeß unterzog, daß es am Ende, von allen menschlichen Schlacken gereinigt, unbesorgt veröffentlicht beziehungsweise im Haus-, Hof- und Staatsarchiv zum Nutzen späterer Geschichtsschreibung abgelegt werden konnte.
Eine schwierige und außerordentlich verantwortungsvolle Aufgabe also, die jedoch dem mit ihr Befaßten den Respekt seiner Kollegen und selbst Vorgesetzten sicherte.
Tuzzi spannte einen Bogen ein und schrieb in großen Lettern »PROTOKOLL DER MINISTERRATSSITZUNG« als Titel an den oberen Rand, setzte das Datum des Tages hinzu und machte sich an die Entzifferung der Kürzel des (ihm übrigens unbekannten) Bundeskanzleramtsstenographen.
»Begrüße Sie, Damen und Herren«, sagte der Kanzler munter. Er führte wie üblich den Vorsitz und war das einzige Regierungsmitglied, dem die Hitze offenbar bisher nichts anhaben konnte; gegen seine schon leicht verwelkten Minister wirkte er wie eine frische, wenn auch bereits bis zum Platzen angeschwollene Rosenknospe. »Ist wieder eine Mordshitz’ heut’. Alsdern, Herrschaften – was gibt’s schlechts Neues?«
Der Legationsrat übersetzte routiniert: Der Herr Bundeskanzler begrüßte die vollzählig erschienenen Mitgliederdes Kabinetts und gab sodann einen kurzen Überblick über die Lage aus seiner Sicht. Hierauf ersuchte er die Ressortchefs, sich zu anstehenden Problemen zu äußern.
»Alsdern, Herr Außenminister – wie war’s denn in Brüssel?«
»Kühl und regnerisch«, sagte der Außenminister. »Ausgesprochen erholsam.«
Die anderen Minister blickten genauso neidisch, wie der Außenminister es sich erhofft hatte. Er war Karrierediplomat, katholisch bis in die Knochen und verachtete seine sozialistischen Ministerkollegen zutiefst.
»Und was tut sich in der Ewege?« fragte der Kanzler.
»Das Übliche«, sagte der Außenminister, »die Franzosen mögen die Deutschen nicht und die Engländer schon gar nicht. Die Engländer mögen die Franzosen nicht und die Deutschen auch nicht. Die Italiener kümmern sich um gar nichts, mögen aber weder die Deutschen noch alle anderen.«
»Und die Holländer und die Belgier?«
»Weiter nichts, außer daß sie die Deutschen nicht mögen.«
»Hm, hm«, sagte der Kanzler. »Und die Deutschen?«
»Sind unglücklich, weil sie nicht und nicht dahinterkommen, warum keiner sie mag.«
»Hm, hm«, sagte der Kanzler. »Und wir?«
»Gott«, sagte der Außenminister, »was interessieren uns die Franzosen oder die Engländer? Wir lieben halt alle und damit habeat.«
»Auch die Deutschen?« fragte der Kanzler.
»Da gibt es in den gegenseitigen Beziehungen keinerlei Probleme«, sagte der Außenminister, der wirklich ein Diplomat von hohem Range war.
»Möcht’ wissen, warum wir damals in diese Ewege-G’schicht’ überhaupt hineingetreten sind!« sagte der Bundeskanzler grübelnd. »Wir hätten denen einen aktiv-neutralen Präsidenten anbieten sollen oder sowas, das hätt’ vielleicht auch genügt. Warum sind wir wirklich nach Brüssel gegangen?«
»Wegen der Mehrwertsteuer«, erinnerte der Finanzminister so kühl, als es ihm unter den gegebenen Wetterbedingungen eben möglich war; kühl zu antworten gehörte ja zu seinem Image. »… Anpassung an europäische Maßstäbe und so.«
»Die Steuer hätten wir anderswie auch zusammengebracht«, knurrte der Kanzler, »wegen dem …?!«
»Ich darf daran erinnern«, schaltete sich der Außenminister verbindlich ein, »daß du, verehrter Herr Kanzler, dazumals auf der Ewege-Assoziierung hauptsächlich deswegen bestanden hast, weil die Russen gar so dagegen waren.«
»Ach ja, richtig«, sagte der Kanzler versöhnt. »Mein Gott, die Zeit vergeht. Na ja, man konnt’ sich von denen auch nicht alles bieten lassen, nicht wahr? Man hat ja eine Würde, schließlich, eine nationale, mein’ ich.«
Die führende Schweizer Zeitung hat schon recht gehabt, dachte der Legationsrat Tuzzi, als sie den Kanzler den »Doyen der europäischen Realpolitik« nannte. Diese scharfe, ja geradezu dynamische Erfassung der Wirklichkeit! Diese bewunderungswerte Souveränität! Wie lautete doch die Antwort auf die populäre Scherzfrage, was wohl geschehen würde, wenn man diesen Kanzler in die Wüste schickte? – »Eine Weile g’schehert gar nix. Und dann würdert der Sand teurer!« In der Tat, das Volk hatte ein gutes Gefühl für die Größe dieses Mannes! Schade, daß man solche Dinge nicht wenigstens als illustrative Anmerkung ins Protokoll nehmen konnte; aber vom Standpunkt ernsthafter Historienschreibung aus waren sie natürlich belanglos. Und also schrieb er: Der Herr Außenminister gab einen kurzen, fundierten Bericht über die internationale Lage unter besonderer Berücksichtigung der Stellung Österreichs im Rahmen der europäischen Gemeinschaften. Der Bericht wurde vom Ministerrat zur Kenntnis genommen.
»Frau Wissenschaftsminister«, sagte der Kanzler, »darf ich dich um die Liebenswürdigkeit bitten, die Situation in deinem Ressort …«
»Mich laß in Ruh«, sagte die Ministerin, »ich hab’ Kopfweh. Ich vertrag’ diese Hitz’ nicht. Ich hab’ seit Tagen nicht geschlafen. Und nächste Woche fahr’ ich nach Schweden.«
»Zu was?« wollte der Unterrichtsminister wissen, der ressortbedingt auf die Aktivitäten des Wissenschaftsministeriums etwas eifersüchtig war.
»Um die kulturellen Beziehungen zu vertiefen«, sagte die Wissenschaftsministerin. »Vielleicht schaut ein Kulturaustauschabkommen dabei heraus oder so.«
»Seit wann haben wir denn mit denen kulturelle Beziehungen?« erkundigte sich der Bautenminister interessiert, obwohl ihn das gar nichts anging.
»Mindestens seit dem Dreißigjährigen Krieg«, sagte die Ministerin belehrend. »In der Wachau singen sie heute noch ›Bet, Kinderl, bet, morgen kommt der Schwed’, morgen kommt der Oxenstern, wird das Kinderl beten lehr’n.‹ Mit Oxenstern ist natürlich Graf Oxenstjerna gemeint; der Kanzler Gustav Adolfs war bekanntlich …«
»Komisch«, sagte der Unterrichtsminister, »bei uns im Burgenland singt man das anders. So: ›. . . san die Türken kumma, ham die Fenster zerschoss’n, ham Blei draus goss’n … ‹«
»Interessant. Die Frau Wissenschaftsminister sollte das erforschen lassen«, sagte der Kanzler, der den Unterrichtsminister nicht leiden konnte, weil er in ihm einen Konkurrenten witterte – fälschlicherweise, denn der Unterrichtsminister wollte gar nicht Kanzler werden, sondern so bald wie möglich wieder hinaus aus den pompösen Räumen am Minoritenplatz und zurück in die rauchigen Wirtshäuser des Burgenlandes und ihre vom Rotwein erhitzten Streitereien, die so schnell vom Deutschen ins Ungarische oder Kroatische oder einen der unergründlichen sonstigen Dialekte dieses Landes wechselten. Nur der erhebende Gedanke, daß durch seine Person endlich auch einmal das so lange vernachlässigte östlichste Bundesland über gesamtösterreichische Kulturbelange entscheidend mitreden konnte, hielt den tüchtigen und redlichen Mann vorderhand noch in Wien fest.
»Liebe Frau Minister«, sagte der Kanzler, »… das ist ja sehr interessant, diese Schwedengeschicht’, aber ich möcht’ dich doch höflich bitten: Verschieb deine Reise, gelt ja? Wir müssen dem Volk schließlich Vorbild sein, du verstehst – wenn wir alle Dienstreisen in kühlere Gegenden machen täten, während unsere Arbeiter und Angestellten in der Hitz’ daheimbleiben müssen …«
Dr. Tuzzi: Mit Befriedigung nahm das Kabinett den vom Wissenschaftsministerium vorgelegten Bericht über die Vertiefung der kulturellen Beziehungen zwischen Österreich und dem skandinavischen wie südosteuropäischen Raum zur Kenntnis.
Wieder einmal unergiebig, dieser Ministerrat, dachte er, man wundert sich manchmal, daß das Staatswerkel überhaupt weiterrennt; aber vermutlich ist es meistens ziemlich Wurscht, was die Regierenden machen, solange in allen Sektionen Leute wie ich sitzen, die geduldig dafür sorgen, daß der alltägliche Kleinkram durch bürokratische Abstraktion emporgeläutert wird zur Haus-, Hof- und Staatsarchivgültigkeit, bis er sich vor den gestrengen Augen der Geschichte sehen lassen kann oder diesen wenigstens nicht auffällt.
Jedoch irrte der Legationsrat mit diesen am Rande des geradezu Aufsässigen hinschwebenden Gedanken, denn das Ministerratsprotokoll begann sich plötzlich in unerwarteten Zickzackwendungen zum Bedeutenden, ja geradezu Dramatischen hin zu entwickeln.
Zunächst brachte der Unterrichtsminister die letzten Wetterberichte zur Kenntnis (aus unerforschlichen Gründen untersteht nämlich die bundeseigene Meteorologische Zentralanstalt dem Unterrichtsministerium, das diese wichtige Schlüsselposition natürlich eifersüchtig gegen Kompetenzübergriffe aus anderen Ressorts hütet). Der Minister ließ die erfreuliche Nachricht verlauten, daß es seinen Wetterwissenschaftlern gelungen sei, die ohnehin schon hohe Erfolgsrate ihrer Prognosen – sie hatte bis vor dem Eintritt der Großen Hitze immerhin bei 50 Prozent gelegen! – entscheidend zu steigern. Nach Auskunft der Bundesmeteorologen sei mit nunmehr 9o(!)prozentiger Sicherheit zu erwarten, daß das heiße Wetter weiterhin anhalten werde.
Diese Mitteilung rief leider nicht den verdienten Beifall hervor, sondern Empörung. Die hitzebleichen Gesichter der Kabinettsmitglieder liefen zornrot an, der Schweiß begann heftiger zu quellen, und die ohnehin schon gereizte Stimmung entlud sich grollend. Die Wissenschaftsministerin schien geneigt, die Wettervorhersage ihres Kollegen als persönlichen Affront zu betrachten, und ließ ein micky-mausartiges Quieken hören. Ihre Kollegin vom Gesundheits- und Umweltschutzministerium – eine Frau, die nicht nur in der Ministerrunde, sondern auch in der Bevölkerung hohe Popularität genoß, weil sie im unpassendsten Augenblick verläßlich etwas Falsches zu äußern pflegte – fragte schrill, was man wohl glaube, daß sie den mächtigen Initiatoren der »Bürgerinitiative zur Erhaltung des Donauwassers« sagen solle. Und die Staatssekretärin für Familienfragen sah endlich die Chance, auch einmal den Mund aufmachen zu können, und rief, sie pfeife auf eine solche Prognosenverbesserung, und früher wäre das ja doch besser eingerichtet gewesen, und da hätte man doch, wenn die Meteorologen für den nächsten Tag Sonne voraussagten, wenigstens zu fünfzig Prozent Regen und Kälte erwarten dürfen, und das Volk wäre ganz zufrieden gewesen, zu wissen, daß das Erscheinen des Doktor Kletter in der abendlichen Fernseh-Wettervorhersage stets Regen bedeutete und der Auftritt des Doktor Reutter immer Schönwetter, unabhängig von allen Tiefs über Südrußland und allen Hochs über dem Atlantik. Und das Kabinett möge gefälligst begreifen, daß der Geburtenrückgang ein beängstigender sei, weil die Hitze auf die Zeugungsbereitschaft vor allem der männlichen Bevölkerung außerordentlich nachhaltig einwirke (»Hört, hört!« rief die Gesundheitsministerin, während die Frau Wissenschaftsminister höhnisch lächelte), und wenn das nicht aufhöre, würde nicht nur sie selbst, sondern auch der Herr Unterrichtsminister bald in Pension gehen können. Aber anstatt endlich Wasser herbeizuschaffen, denn ohne Wasser sei ein ordentliches und geregeltes Liebes- und Eheleben wie auch eine anständige Kinderaufzucht nicht möglich, anstatt dessen verschärfe man die ohnehin schon unerträglichen Wasserrationalisierungsvorschriften noch mehr, und zum Schluß bezeichne man das ganze Hitzemalheur womöglich noch als großen Erfolg der Regierung, und ob die Anwesenden wirklich glaubten, daß die Wähler so blöd sein würden, das auch noch zu fressen?
Diese in gellendem Ton vorgetragene Philippika eines Regierungsmitgliedes, das im Kabinett noch niemals zuvor auch nur ein Wort geäußert hatte, erzielte umso nachhaltigeren Eindruck, als die mitgeteilten Tatbestände ihrem Wesen nach ziemlich richtig getroffen waren. Die anhaltende Wasserknappheit mit allen ihren Folgen – mangelnde Sauberkeit, austrocknende Landschaften, sinkende Industrieproduktion undsoweiter – versetzte, wie die Minister sehr wohl wußten, das Volk allmählich wirklich in Erregung; daß diese Erregung nicht bereits in Demonstrationen oder gar Tätlichkeiten umschlug, war eigentlich wiederum nur der Hitze zu verdanken, die auch ihre Ursache war.
»… wer is denn fürs Wasser eigentlich zuständig?« fragte der Kanzler, der als routinierter Taktiker den Zeitpunkt gekommen sah, Verantwortungen zu delegieren beziehungsweise einen Sündenbock zu finden.
Es entstand Unsicherheit. Einige Augenpaare wanderten zum Bauten-, andere zum Handelsminister, und auch die Gesundheitsministerin, der die Umweltschutzagenden zustanden, wurde von diesen und jenen nachdenklich gemustert. Doch vermochten diese drei Ressortleiter, indem sie gemeinsam ihre Blicke fest auf das langsam fahl werdende Antlitz des Landwirtschaftsministers richteten, die allgemeine Aufmerksamkeit auf diesen unglücklichen Mann umzulenken. Der Verteidigungsminister, froh, einmal nicht als das schwarze Schaf des Kabinetts dazustehen3, sagte schließlich laut in die verhängnisvolle Stille hinein: »Schlußendlich ist ja wohl der Kollege von der Landwirtschaft zuständig. Wasser, net wahr – es fließt ja doch durch die Landschaft, im allgemeinen.«
Der Landwirtschaftsminister, nicht eben ein überaus schneller Denker (langsam senkt sich der Keim in die Erde, in Ruhe reift die Frucht, ehe Ernte gehalten wird!), suchte krampfhaft nach einer passenden Antwort, doch schnitt ihm der Kanzler das Wort sozusagen schon im Munde ab:
»Natürlich. Also, Herr Kollege, sei so gut und tu was, ja?«
»Aber was?« fragte hilflos der Minister. »Bitte, was?«
»Zum Kuckuck«, sagte der Kanzler, »bin ich Landwirtschaftsminister? Oder bist du es?«
»Aber ich … ich kann’s doch net regnen lassen, Himmelherrgott noch amal!«
Die Wissenschaftsministerin gackerte höhnisch, und der Verteidigungsminister sah aus wie ein Frankenstein-Monster, das sich ausnahmsweise wohlfühlt. Dann trat eine Pause ein.
»Erstens«, sagte nach dieser Pause der Kanzler, »wollen wir, bitte schön, die Formen wahren. Wir sind ja hier schließlich nicht im Kuhstall.«
Die Minister zogen die Köpfe ein, denn jetzt setzte der Kanzler, ein Meister des psychologischen Kleinkriegs, seine berühmte und gefürchtete Terrorwelle in Bewegung. Hilflos und leichenblaß starrte der Landwirtschaftsminister auf das Bild des jungen Kaisers Franz Joseph, der ihn über den Kanzler hinweg mit großer Güte anblickte.
»Zweitens ersuche ich dich höflich, lieber Freund«, fuhr der Kanzler fort, »uns spätestens am übernächsten Montag über die von dir getroffenen beziehungsweise in Kürze zu treffenden Maßnahmen Bericht zu erstatten.«
Tiefe Stille herrschte nach diesen Worten.
Noch einmal versuchte der Mann der Landwirtschaft schwachen Widerstand.
»Aber was … ja, bitte schön: Was soll ich denn eigentlich tun?«
»Etwas Zweckdienliches«, sagte in kalter Wut der Kanzler. »Zu was sitzt du denn schließlich da?«
An dieser Stelle brach das Stenogramm ab. Offenbar hatte der Stenograph bis dahin halb schlafend mitgeschrieben und erst jetzt bemerkt, daß sich hier Emotionen entluden, die wahrhaft die Grundfesten des Staates zu erschüttern drohten, Emotionen, die nicht einmal in Einheitskurzschrift hätten verzeichnet werden dürfen.
Tuzzi schüttelte nervös den Kopf und strich sorgfältig mit schwarzem Filzstift die letzten Zeilen durch. Zwar würde er das stenographische Protokoll ohnehin gleich selber in den Akten-Reißwolf hineingeben, aber allergrößte Diskretion war hier ernstlich geboten.
Diese verdammte Hitze, dachte der Legationsrat – sie wirkt demoralisierend bis ins Innerste des Staates.
Tuzzis Übersetzung in die geschichtswürdige Abstraktion: »Abschließend beauftragte der Ministerrat den Herrn Landwirtschaftsminister, umgehend Maßnahmen zur Erleichterung der klimatischen Situation zu ergreifen.«
Nun, da er seine Morgensünde abgebüßt hatte, nahm Tuzzi endlich seinen normalen Arbeitsrhythmus auf. Er entzündete den Spirituskocher hinter dem Tisch seiner Sekretärin – der Strommangel hatte solch altmodische Geräte wieder zu Ehren gebracht –, füllte die kleine Espressomaschine mit Mineralwasser aus einer Zweiliterflasche sowie Kaffee und setzte sie auf. Mit dem restlichen Preblauer Heilquellenwasser befeuchtete er, jeden Tropfen achtend, seine Zimmerpflanzen. Er besaß deren eine ganze Menge, nicht nur die ordinären Philodendren und Monsterae, wie sie üblicherweise in der trockenen Wüstenvegetation zentralgeheizter Büroräume dahinvegetieren, sondern auch Anspruchsvolleres: Campanulae, Farne und zierliche Judenbärte, und als Rarität sogar eine Stanhopea, eine Orchidee, die den eindrucksvollen indianischen Spezifikationsnamen »Coazonte coxoahitl bednar.« trug und wenn sie blühte, was sie freilich schon lange nicht getan hatte, nach Zimt, Schokolade, Vanille und Blume an sich duftete. Tuzzi war fest entschlossen, sie über die Große Hitze hinwegzuretten, obwohl das bei den schnell steigenden Preisen für Mineralwasser ziemlich teuer sein würde. (Im Hause selbst durfte nur ein einziger Wasserhahn und auch dieser nur zur Trinkwasserentnahme benutzt werden.) Dann goß er den brodelnden Kaffee in eine Tasse, setzte sich an den Schreibtisch, brannte die in ihrem Genußwert beträchtlich erhöhte erste Zigarette an, lehnte sich in seinen Biedermeierarmstuhl zurück, streckte die Füße unter dem Schreibtisch aus und holte Atem für die Bewältigung des Kommenden.
Er hatte jenen Rang der Ministerialbürokratie erreicht, in dem der Beamte nicht mehr mit nüchternen Zweckgeräten, sondern bereits mit Möbeln aus dem ehemals kaiserlichen Hofmobiliendepot umgeben wird, mit rötlich gemasertem Kirschholz zum Beispiel und graziös geschwungenen Sesselbeinen, noblen und soliden Dingen also, die in aller Bescheidenheit Legitimität und Kontinuität bezeugen. Ein glücklicher Zufall hatte überdies bewirkt, daß die Tapeten und die Bezüge der Sitzgarnitur in Tuzzis Lieblingsfarben Goldgelb und Dunkelgrün beziehungsweise Tannengrün und Ährengold gehalten waren, was insgesamt ein Inventar ergab, das sehr wohl geeignet war, einen Menschen von Geschmack positiv zu stimmen.
Der Legationsrat entzündete seine zweite Zigarette, straffte den Rücken und nahm endlich Einblick in die Schriftstücke, die der Amtsgehilfe Brauneis kurz zuvor auf seinem Schreibtisch deponiert hatte.
Es war sehr ruhig im ganzen Haus. Die letzten Spuren morgendlicher Mißstimmung entschwebten in den stillen Büroräumen des Interministeriellen Komitees für Sonderfragen wie der Rauch der Zigaretten. Ohne Hast wanderten die Gedanken höherer Beamtengehirne auf verschlungenen Aktenpfaden den geheimen Punkten zu, an denen der tägliche Gang der Dinge mit dem Ablauf des Weltganzen zu annähernder Deckungsgleichheit gelangt. Nur manchmal ratterte gedämpft eine Schreibmaschine los wie das Maschinengewehr eines weit entfernten Vorpostens, der sich verzweifelt gegen den Einfall chaotischer Kräfte zur Wehr setzt.
Und natürlich konnte der Legationsrat auch jetzt noch nicht einmal ahnen, daß in der Ministerratssitzung, deren Protokoll er eben säuberlich faltete und kuvertierte, ein neues Glied an jene Kette von Ursachen und Wirkungen geflochten worden war, die sich wenig später schon würgend um seinen Hals schlingen würde.
2 Soviel an dieser Stelle über die domestizierende und ordnende Macht des Grüßens. Man erfährt mehr darüber auf Seite 53.
3 Der Kanzler selbst erzählte einmal in einer gemütlichen Fernsehsendung, man erzähle sich im Volke, daß ihm, dem Kanzler also, einmal fälschlich der Selbstmord dieses erfolglosen Ministers gemeldet worden sei; er, der Kanzler, habe jedoch nur aufgeblickt und gütig gemeint: »No ja …, wenn er sich’s verbessern kann …?«