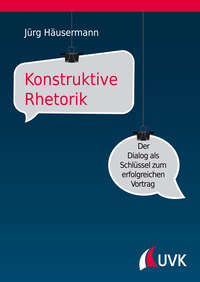Kitabı oku: «Konstruktive Rhetorik», sayfa 5
Der Monolog als Symbol
Das Schicksal von Jenningers Rede ist ein drastisches Beispiel für das Dilemma, das mit jeder öffentlichen Redeveranstaltung verbunden ist: Man will zwar zum Diskurs beitragen, aber das Modell, das dafür zur Verfügung steht, ist die One-Man-Show. Einer spricht, die anderen hören zu und interpretieren, was sie hören, nach Gutdünken. Und bei einer Gedenkveranstaltung ist der Spielraum für eine andere Vorgehensweise minimal klein. Als Vorlesung vor einem Publikum, das mitdenkt und mitdiskutiert, wäre diese Rede wohl möglich gewesen. Dass sie sogar vorgetragen werden konnte, ohne Anstoß zu erregen, demonstrierte ein Jahr später Ignatz Bubis, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland. Er las mit wenigen Abstrichen denselben Text bei einer Veranstaltung in einer Frankfurter Synagoge. Das Resultat: „Keiner hat was gemerkt.“66
Dies hat aber wohl nur deshalb funktioniert, weil die Funktion der Rede nicht auf einen symbolischen Akt reduziert war. Es war eine Bereitschaft da, vorurteilsfrei zuzuhören. Je ritueller aber die Veranstaltung ist, desto stärker die Distanz zwischen Redner und Publikum desto ausgeprägter der monologische Charakter. In vielen anderen Fällen, außerhalb der Festrede, lässt sich der Monolog aufbrechen, lassen sich dialogische Elemente einbauen. Das Problem dabei ist nur, dass das symbolische Reden von vielen als Vorbild genommen wird und auch auf andere Redeweisen übergreift, bei denen die abgeschlossene Form und der Verzicht auf den Austausch mit dem Publikum eher nachteilig ist.
Reden, ohne zuzuhören
Ungeachtet des feierlichen Rahmens versuchten Abgeordnete die Rede mit Zwischenrufen zu stören. Dass dies nicht gelang, gehört auch zur Tragik des extremen Monologs. Jenninger selbst berichtet es so:
»Schon nach den ersten fünf Sätzen meiner Rede kam es im Bundestag zu Zwischenrufen der Grünen an mich: „Sie Altnazi! Wie kommen Sie dazu, darüber zu reden! Hören Sie auf,“ hat damals eine Abgeordnete der Grünen gerufen — andere haben ähnliche Beleidigungen von sich gegeben. Ich habe dann die Abgeordneten der Grünen aufgefordert, die Zwischenrufe einzustellen und die Würde dieser Gedenkstunde nicht zu stören. Aber sie hörten nicht darauf.«67
Zwischenrufe begannen schon zu Beginn, als Jenninger begründete, warum das Parlament der BRD eine eigene Gedenkveranstaltung abhielt. Deutlich zu verstehen war der Satz: „Aber das ist doch alles gelogen!“68
Was sollte der Redner tun? Er wusste in der Situation nur eine Lösung: an die Disziplin zu appellieren: „Bitte lassen Sie diese würdige Stunde in dieser Form ablaufen! Ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass ich Sie herzlich bitte, jetzt äh sich ruhig zu verhalten.“69
Je monologischer die Rede, desto passiver ist die Rolle, die dem Publikum zugeschrieben wird. In der parlamentarischen Feierstunde sind keine Signale für Reaktionen aus dem Publikum vorgesehen, im Gegensatz zur parlamentarischen Verhandlung. Da sind Zwischenrufe zwar üblich, aber nicht als Diskussionsbeitrag, sondern als Signal an den Bürger, vor dem die Debatte zelebriert wird. Zwischenfragen werden nur nach strengen Regeln rituell durchexerziert. Problematisch ist, dass dieser Umgang mit Reden oft Vorbildcharakter hat. Man erwartet einen brillanten, ununterbrochenen Vortrag auch da, wo ein gemeinsamer Erkenntnisgewinn nützlich wäre, wo also ein Austausch nonverbaler oder verbaler Art beide Seiten weiterbrächte. Produktiv sind Veranstaltungen, bei denen z.B. eine Unterbrechung durch Fragen aus dem Publikum erwünscht ist und im besten Fall sogar einen fließenden Übergang zwischen Rede und Diskussion möglich macht.
Schriftliche Fixierung erschwert den Kontakt
Der Dialog wird häufig durch die schriftliche Ausarbeitung erschwert. Dies gilt vor allem, wenn Manuskriptreden Wort für Wort gelesen werden, damit die sprachlichen Feinheiten zur Geltung kommen. Dies erhöht den Schwierigkeitsgrad auf jeder Ebene: Beim Schreiben entstehen leicht längere, kompliziertere Sätze, die durch einmaliges Anhören schwerer zu verstehen sind. Zudem entsteht bei ungeschulten Sprechern oft ein einförmiger Vorleseton. Auf der nonverbalen Ebene ist beim Ablesen der Blickkontakt erschwert und die Gestik meist weiter eingeschränkt.
Jenningers Rede enthielt Passagen, die missverstanden werden konnten, weil sie nur mit den dazu gehörenden Satzzeichen eindeutig wurden. Mehrdeutigkeit aber braucht eine Absicherung – entweder durch den Dialog oder, wenn dieser wie in der Feierstunde nicht möglich ist, durch die sprecherische Gestaltung.
Beispiele für die Mehrdeutigkeit waren in diesem Fall viele Sätze in Frageform, zudem Rechtfertigungsfloskeln in Anführungszeichen, die Jenninger den Zeitgenossen des Holocaust in den Mund legte (in der 3. Person Plural, was die Distanzierung erschwerte) und zudem nazitypische Diffamierungen. Im Manuskript standen diese in Anführungszeichen. In der mündlichen Rede waren diese nicht mehr zu erkennen.70 Ein professioneller Sprecher oder eine Schauspielerin hätten stimmliche Mittel zur Verfügung, um sich von Zitaten zu distanzieren. In einem informellen Rahmen würde es mit anderen Mitteln geklärt, es würde mit Blickkontakt überprüft, ob die Distanzierung erkannt wurde. Im Zweifel könnte man gar eine kurze Erklärung einfügen oder auf eine Zwischenfrage reagieren. In einer während der Feierstunde zelebrierten Rede geht dies aber nicht, weil die Tendenz zum Monolog auch die Tendenz zum Perfektionismus ist.
In Manuskriptreden spiegelt sich auch der Perfektionismus, der mit monologischen Reden verbunden wird, wider. Rednerin wie Publikum erwarten kunstvoll geformte, grammatikalisch korrekte Sätze. Menschen, die als große Rednerinnen gelten, werden für die stilistischen Kunstwerke gelobt, die später in ihren gesammelten Werken nachgelesen werden können. Das erfordert eine perfekte Darbietung. Dafür gibt es aber spezielle Berufe – diejenigen der Schauspielerin und des professionellen Sprechers. Ein Handwerker, der aus seiner Werkstatt berichtet, eine Künstlerin, die ihre Plastiken präsentiert, oder auch ein schwäbischer CDU-Politiker, der über seine historischen Erkenntnisse referiert, ist mit einem zu raffinierten Manuskript überfordert.
Fragen, die keine Fragen sind
Kennzeichnend für das Angebot einer Interaktion ist traditionsgemäß die Frageform – außer es handelt sich um eine sogenannte rhetorische Frage. Die Zuhörenden sollen sich die Antwort selbst geben; meistens wird sie durch den Kontext insinuiert. Rhetorische Fragen sind auch im Alltag durchaus üblich. Dort ist es aber leicht, mit einer entsprechenden Intonation und Pause zu signalisieren, wie sie gemeint sind – und die Möglichkeit der Antwort oder sonstigen Reaktion ist gegeben. In der öffentlichen Rede demonstriert sie den Verzicht auf den Dialog, wenn sie nicht entsprechend eingebettet ist. Jenninger formulierte gar zehn Sätze in Frageform, die ganz unterschiedliches aussagten. Was fehlte, war die passende sprecherische Ausführung mit Intonation und Pausen, die dazu gehört, will man aus der rhetorischen Frage ein Instrument des Dialogs machen.
In den Jahren nach der Gedenkstunde sind unzählige Analysen der Rede erschienen. Die meisten stützen sich auf den Wortlaut. Einige aber weisen auch auf die besondere Stimmung im Saal hin, die von Anfang an ein Verstehen erschwerte. Der Linguist Peter von Polenz spricht von einer „weithin oberflächlichen, unaufmerksamen und neurotischen Rezeptionshaltung,“71 Jenninger selbst sprach in einem späteren Interview von der „Eiseskälte“, die er von den Parlamentariern zum Rednerpult hochkommen spürte.72 All das sind Ausdrücke, die das Destruktive illustrieren, das mit der Verherrlichung des Monologs einhergeht.
Die Verherrlichung des Monologs
Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen man mal die Klappe halten und zuhören sollte. Aber auf Dauer besteht erfolgreiche Kommunikation in Rede und Gegenrede, in wechselseitigem Zuhören. Klassische Monologsituationen werden denn auch selten aufgrund der Fähigkeit des Redners, auf sein Publikum zu hören, beurteilt. Man konzentriert sich stattdessen auf die kurzfristige Wirkung, die er ausübt oder auszuüben scheint. Erfolgreiches Reden wird als „Willensbeeinflussung“73 verstanden; es ist „auf Überzeugung ausgerichtet“74 – meist ohne zu fragen, ob es wirklich möglich ist, mit einer einzigen Rede die Menschen umzustimmen oder ob dies überhaupt wünschenswert ist.
Natürlich lassen sich monologische Botschaften am leichtesten inszenieren und je autoritärer der Rahmen ist, desto nachhaltiger wirken sie: Der Diktator ruft zum Krieg auf, die Zuhörenden schreien „Hurra“. Der Kommandant ruft: „Feuer!“, die Soldaten zünden die Geschütze.
Als Beispiele für gelungene Überzeugungsreden werden oft spektakuläre Beispiele genannt, die einen momentanen Stimmungswechsel bewirkt haben. In einer Gemeinschaft, die sich unter dem Zeichen der Gleichberechtigung trifft, ist dies jedoch wenig konstruktiv.
So bewundern viele die Rede des deutschen Außenministers Joschka Fischer beim außerordentlichen Parteitag der Grünen 1999. Die NATO bereitete sich vor, Serbien anzugreifen, um die Menschenrechtverletzungen, Ermordungen und Vertreibung zu beenden, allerdings, ohne dass der „Bündnisfall“, ein Angriff auf einen NATO-Staat, eingetreten wäre, und ohne UN-Mandat. Die rot-grüne Bundesregierung der BRD sah sich genötigt, bei diesem Krieg mitzumachen, nicht nur aus Gründen der Humanität, sondern auch um der eigenen Machterhaltung willen.75 In seinen eigenen Worten ging es darum, ob er „gestärkt aus dem Parteitag hervorging“76 oder nicht. In einer aufgeheizten Atmosphäre plädierte Fischer für die Unterstützung seiner Parteigenossen. Immerhin war es der erste deutsche Kriegseinsatz nach dem Zweiten Weltkrieg, und die Zeit, als Fischer noch selbst der Bundeswehr kritisch gegenüberstand, war noch nicht lange her.
Nach der Rede (mit dem später sprichwörtlich gewordenen Ruf: „Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz; nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus!“77) wurde seine Position mit 444 zu 318 Stimmen bestätigt.78 Fischers Taktik wurde später als unredlich bezeichnet, weil er wesentliche Informationen zurückgehalten hatte, die Gegenargumente geliefert hätten.79 Im Kabinett hatte man eine Entscheidung getroffen; die Meinungen der Basis sollte diese nicht mehr beeinflussen. Ein Angebot zum Dialog war die Rede nicht.
Karl-Heinz Göttert, Kenner der Rhetorikgeschichte und Verfasser eines Buchs über „Redemacht“, sieht sie in anderem Licht. Er versteht Fischer als Nachfolger des römischen Populisten Cicero und lobt: „Welche Rede soll besser sein als diejenige, die in fast hoffnungsloser Situation überredet?“80 Das Prinzip der Rhetorik ist für ihn „die fixe Idee des Überwältigens durch (Anwendung von) Kunst.“81
Wer einen solchen Monolog preisen will, braucht eine Vorannahme, nämlich die, dass „die Grünen“ insgesamt dem Krieg ablehnend gegenüberstanden. „Eine Mehrheit für die nachträgliche Befürwortung des NATO-Einsatzes schien unmöglich.“82 Dann kam Fischers Rede. Dann kam die Abstimmung, und die Mehrheit war dafür. „Fischer hatte den Umschwung mit überzeugenden Argumenten herbeigeführt, aber auch mit einer Sprache, die Autorität ausstrahlte,“ so Göttert.83 Genau dies gehört aber zum Mythos von der Macht der Rede: das „Überwältigen“ durch eine in den Saal gebrüllte, leidenschaftliche Rede (mit Pauschalverurteilungen, Halbwahrheiten und abstrusen Vergleichen, die einen zumindest aus der Distanz erschauern lassen können). Wenn es möglich wäre, mit einer Rede allein ein Nein in ein Ja zu verwandeln, wäre es nicht Kommunikation unter Gleichberechtigten, sondern Propaganda, Indoktrination.84
Monolog ist auf Wirkung fixiert
Es sind also zwei Dinge auseinanderzuhalten: Zum einen die sofortige Wirkung einer Rede, und diese wird oft magisch verklärt gesehen. Das Reiz-Reaktions-Schema, das diesem Denken zugrunde liegt, ist eine Illusion. (Die Fischer-Rede hat weder die Entscheidung der Delegierten noch die der Bundesregierung, die sich schon längst entschieden hatte, herbeigezaubert.)
Zum anderen gibt es die längerfristige Wirkung. Diese besteht zum Beispiel darin, dass sie später wieder aufgenommen und diskutiert wird, dass sie im Nachhinein selbst zum Mythos wird und in vielen argumentativen Texten behandelt wird. Fischers Ausspruch Nie wieder Auschwitz! aus dieser Rede, Martin Luther Kings I have a dream …, Angela Merkels Beteuerung: Wir schaffen das! – viele Redeausschnitte sind weiter zitiert und diskutiert worden. Diese Art des Weiterlebens einer Rede mag erstrebenswert sein und sie sogar zu einem literarischen Werk machen. Sie muss nur klar getrennt werden von der angeblichen sofortigen Wirkung. Diese ist in den wenigsten Fällen zu belegen, und wer auch nur ein wenig Sinn für demokratische Auseinandersetzung hat, wird keinen Wunsch nach solchen Reden verspüren.
Es könnten noch viele Reden zitiert werden, die deshalb als „erfolgreich“ gelten, weil der Redner sein Privileg, zu einer großen Menge zu sprechen, missbraucht hat, um mit Scheinargumenten, schönen Worten oder Ablenkungsmanövern zu brillieren. Deshalb sind die großen Vorbilder der destruktiven Rhetorik meistens politische Redner, Fernsehmoderatorinnen, Pressesprecher – Menschen, deren Beruf es ist, ihre eigene Position in der Auseinandersetzung mit anderen zu behaupten. Wenn sie aber nicht gerade reden, üben sie ihre Macht auf ganz andere Weise aus als durch rhetorische Kunstwerke.
Das Problem ist nicht, dass es Situationen gibt wie Feierstunden oder Wahlkampfveranstaltungen, bei denen eine Rede gehalten wird, um eine Stimmung zu produzieren. Das Problem ist, dass diese Art Rede als Ideal auch auf alle anderen Gelegenheiten des öffentlichen Redens übertragen wird. Dass manchmal versucht wird, dem politischen oder weltanschaulichen Gegner in einer Rede mit Verzicht auf rationale Argumentation eine Niederlage zu verpassen, ist nicht unser Thema, sondern dass diese Art des Redens verherrlicht wird und auch als Maßstab für die Ansprache des einfachen Referenten vor seinem Fachpublikum genommen wird.
 Daran zeigt sich die Tendenz zum Monolog
Daran zeigt sich die Tendenz zum Monolog
 Rahmen: Beiträge des Publikums sind nicht vorgesehen. Die Qualität der Rede wird unabhängig von der Redlichkeit ihrer Mittel beurteilt.
Rahmen: Beiträge des Publikums sind nicht vorgesehen. Die Qualität der Rede wird unabhängig von der Redlichkeit ihrer Mittel beurteilt.
 Diskurs: Die Rede versteht sich nicht als Beitrag in einem Prozess der gegenseitigen Verständigung, sondern als Wunderwaffe, die den Gegner in einem Zug schachmatt setzt.
Diskurs: Die Rede versteht sich nicht als Beitrag in einem Prozess der gegenseitigen Verständigung, sondern als Wunderwaffe, die den Gegner in einem Zug schachmatt setzt.
 Form: Gegenseitiges Zuhören ist erschwert. In der Rede werden keine Dialogangebote gemacht. Der Redner vermeidet den Kontakt mit dem Publikum.
Form: Gegenseitiges Zuhören ist erschwert. In der Rede werden keine Dialogangebote gemacht. Der Redner vermeidet den Kontakt mit dem Publikum.
 Argumentation: Rationale, plausible und emotionale Argumentation werden austauschbar behandelt.
Argumentation: Rationale, plausible und emotionale Argumentation werden austauschbar behandelt.
 Wirkung: Rednerin und Publikum rechnen mit einer unmittelbaren, unidirektionalen Wirkung der Rede.
Wirkung: Rednerin und Publikum rechnen mit einer unmittelbaren, unidirektionalen Wirkung der Rede.
Monologische Rhetorik bezieht ihren Nimbus durch die rhetorische Tradition, die einen Typ Rede in den Mittelpunkt stellt: die Überzeugungsrede vor Gericht oder im politischen Forum. Der Erfolg einer solchen Rede misst sich daran, dass die Rednerin die Mehrheit des Publikums auf ihre Seite zieht; es geht um Sieg oder Niederlage, die Mittel heiligen den Zweck. Eine Betrachtungsweise, die diese Art des Redens lehrt, verdient den Namen destruktive Rhetorik. Sie zählt auf den Missbrauch der asymmetrischen Rollenverteilung und auf deren Verherrlichung. Konstruktiv aber spricht, wer akzeptiert und erkennbar macht, dass seine Rede höchsten das zweitwichtigste Ereignis der Kommunikation ist. Ihr übergeordnet ist der Diskurs, in den sie sich einfügt.
8Rhetorik: Die Lehre vom Reden in der Öffentlichkeit
Wer im antiken Athen als Angeklagter oder als Kläger vor Gericht stand, musste seine Sache selbst vertreten. In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor Christus hatte Athen einen politischen und rechtlichen Wandel erlebt. Das erste demokratische Gemeinwesen war entstanden, und dazu gehörten auch die Gerichte. Eine große Gruppe von Bürgern hörte sich die Verhandlung an und entschied, ähnlich wie in einem Geschworenenprozess, dann über den Fall. Es gab keine Anwälte, keinen Staatsanwalt; um sich vor diesen Gerichten zu behaupten, waren die Beteiligten auf ihre rednerischen Fähigkeiten angewiesen.85
Aber es gab Rhetoriklehrer – Dozenten und Berater, die ihre Kunden darin unterrichteten, ihre Sache vor Gericht und auch in der Politik wirksam zu vertreten. Eine Vorstellung von ihrem Fach geben die Lehren der Griechen Protagoras, Gorgias oder Aristoteles aus dem fünften und vierten Jahrhundert vor Christus. Im antiken Rom, in der mittelalterlichen Gelehrtenwelt und in der Neuzeit entwickelte sich die Rhetorik weiter zu einer Wissenschaft, einem System der Vorbereitung, Planung und Durchführung von „Reden“ im weitesten Sinn. Diese klassische Rhetorik befasste sich längst nicht nur mit Anklage und Verteidigung vor Gericht oder mit politischen Debatten. Sie war aufgefächert in Lehreinheiten zu Recherche, Argumentation, Diskussion, Präsentation usw., und zwar in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens – gleich, ob es um die Welt der Gerichte oder des Handels, der Medizin oder der Kunst gehen mochte.
Der Anspruch des Fachs Rhetorik ist immer über den einer Kommunikationslehre hinausgegangen. Sie hat seit dem Altertum Aspekte der Philosophie, Psychologie und Sprachwissenschaft einbezogen, die später von eigenen Disziplinen (z.B. Linguistik, Psychologie, Kommunikationswissenschaft) übernommen wurden. Einige davon sind direkt aus der Rhetorik entwickelt worden, andere zumindest können ihre Verwandtschaft nicht leugnen.
Der heutige praktische Rhetorikunterricht umfasst nur noch einen kleinen Teil des klassischen Lehrgebäudes. Das hat aber durchaus seinen Sinn, eben weil es moderne Fächer gibt, die sie entlasten, weil sie Inhalte erforschen, die früher zur Rhetorik gehörten.
 Moderne Erben der klassischen Rhetorik
Moderne Erben der klassischen Rhetorik
 Linguistik
Linguistik
 Literaturwissenschaft
Literaturwissenschaft
 Psychologie
Psychologie
 Jurisprudenz
Jurisprudenz
 Theaterwissenschaft
Theaterwissenschaft
 Medienwissenschaft
Medienwissenschaft
Auch in diesem Buch wird der Begriff Rhetorik auf einen besonderen Aspekt der Kommunikation konzentriert. Rhetorik wird verstanden als die Lehre vom Reden in der Öffentlichkeit. Dass diese Lehre trotz ihrer klaren Einschränkung immer noch Rhetorik genannt werden soll, hat zwei Gründe.86 Der eine liegt in der Tradition des Sprachgebrauchs: Im deutschen Sprachraum hat Rhetorik sich als Bezeichnung für alle Formen des praktischen Redetrainings eingebürgert. Unzählige Angebote führen den Begriff im Titel, auch wenn sie keinen Zusammenhang zur wissenschaftlichen Rhetorik erkennen lassen. Deshalb sollte ein Buch wie dieses, das den Bezug zur Wissenschaft beibehält, den Begriff nicht über Bord werfen.
Der zweite Grund hat mit der Perspektive der Rhetorik zu tun, die sich von der anderer Wissenschaften der Kommunikation unterscheidet. Auch wenn uns in der Rhetorik bewusst bleibt, dass es Sender und Empfänger, Rednerin und Zuhörende gibt, nimmt der Ansatz in erster Linie die Rednerin in den Blick. Zwar ist das Publikum nicht rein passiv und das Gelingen hängt nicht zu hundert Prozent von der Rednerin ab. Dennoch werden wir immer wieder auf die Rednerinnenperspektive zurückkommen, weil es die Rednerin ist, an die sich die Ausbildung richtet.87
Dieses Buch enthält viele praktische Anleitungen. Aber es geht immer zunächst deskriptiv vor und setzt bei den Merkmalen des Redens in der Öffentlichkeit an, in seinen Unterschieden vom Reden im Alltagsgespräch. Dies ist der Ansatz, der sich in meiner Ausbildungspraxis bewährt hat.88 Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass das Reden im Dialog nicht nur leichter fällt, sondern dass auch bessere Resultate erzielt werden als in der monologischen Rede. Kooperation führt zu Lösungen, die alle mittragen können. Bei einer Präsentation oder einem Vortrag hilft ein dialogisches Vorgehen zumindest, rechtzeitig zu erkennen, ob die Zuhörenden noch dabei sind und wie weit sie bereit sind, zu folgen und die Botschaften zu akzeptieren. Es ist möglich, die Kommunikation in Präsentationen, Vorträgen oder Vorlesungen zu verbessern, indem man versucht, so viel wie möglich von der dialogischen Kommunikation in die öffentliche Rede zu übernehmen. Ich nenne dies konstruktive Rhetorik. Das nächste Kapitel skizziert dieses Programm.