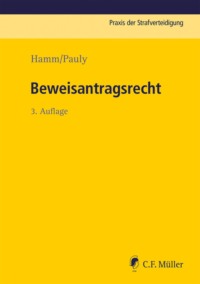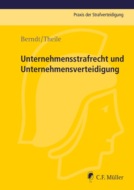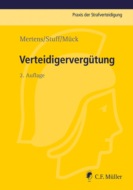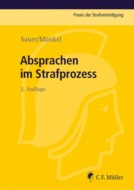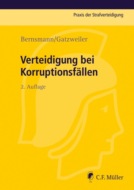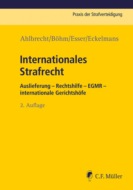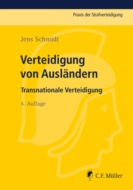Kitabı oku: «Beweisantragsrecht», sayfa 11
Zu beachten ist ferner, dass die Frage, ob der Antrag eine hinreichend bestimmte Beweisbehauptung enthält, nicht mit der Frage verwechselt werden darf, ob sich das benannte Beweismittel (Zeuge) dazu eignet, den Beweis für die angeführte Tatsache zu erbringen.[164]
cc) Kenntnisstand des Antragstellers
189
Neben der Bestimmtheit der Beweisbehauptung ist für die Antragstellung ferner von Bedeutung, welchen Kenntnisstand der Antragsteller von der Richtigkeit der Beweisbehauptung hat und ob er die Quelle seiner Kenntnisse preisgeben muss.
Da der Antragsteller, wenn er nicht der Staatsanwalt ist, in aller Regel selbst keine umfassenden Ermittlungen veranlassen kann, wird es ihm häufig nicht möglich sein, sich vor der Formulierung eines Antrages z.B. auf Anhörung eines Zeugen Gewissheit über das noch vorhandene Erinnerungsbild des Zeugen zu verschaffen. Weil das aber nicht verhindern darf, dass überhaupt Beweisanträge auf Anhörung von Zeugen gestellt werden, die noch nicht durch die Ermittlungsbehörden vernommen wurden, gelten weite Maßstäbe in Bezug auf die Frage, bei welchem subjektiven Kenntnisstand eine Beweisbehauptung aufgestellt werden darf. So hat der Verteidiger das Recht, eine Beweisbehauptung schon dann aufzustellen, wenn er lediglich annimmt oder für möglich hält, dass die beantragte Beweiserhebung zu einer bestimmten Feststellung führen wird.[165] Der Antragsteller muss nicht mehr an eigenem Wissen vortäuschen als er in seiner Situation vernünftigerweise haben kann.[166] Kern dieser Überlegung ist, dass es im Hinblick auf den Amtsaufklärungsgrundsatz und die Verfahrensherrschaft des Gerichts nicht darauf ankommen soll, welche Überzeugung von der Richtigkeit der aufgestellten Beweisbehauptung der Antragsteller hat, sondern darauf, welche Überzeugung das Gericht von der Richtigkeit dieser Behauptung hat.[167]
190
Dies lässt sich an Hand einer Entscheidung des BGH vom 17.2.1988 verdeutlichen. Der Antragsteller hatte in der Hauptverhandlung beantragt, zum Beweis dafür, dass der Angeklagte sich zum Zeitpunkt des Raubüberfalls zusammen mit einem anderen Angeklagten und ca. zehn weiteren Personen in einem Jugendclub aufgehalten hatte, neun namentlich benannte Personen sowie den Sozialarbeiter und die Sozialarbeiterin des Jugendclubs als Zeugen zu vernehmen. Auf die Frage des Vorsitzenden in der Hauptverhandlung, warum im Beweisantrag insgesamt zehn Zeugen genannt werden, antwortete der Verteidiger, dies sei deshalb geschehen, „weil er wegen der verstrichenen langen Zeit nicht sagen könne, welche der benannten Zeugen zu dem Vorgang dieses Beweisthemas etwas bekunden können“. Daraufhin lehnte die Strafkammer den Antrag mit der Begründung ab, es handele sich um einen Beweisermittlungsantrag, weil die Antragsteller, wie sie auf Befragen des Vorsitzenden ausdrücklich erklärt hätten, nicht wüssten, welcher der zahlreichen benannten Zeugen angesichts der bereits verstrichenen langen Zeit zu der Behauptung überhaupt etwas bekunden könne. Die Zeugen seien deshalb nur in der Hoffnung benannt worden, einer von ihnen könne über die Frage, wer an diesem Abend in dem Jugendclub war, etwas sagen. Der Verteidiger gab sich damit nicht zufrieden und stellte den weiteren Antrag, die Zeugen zum Beweis dafür zu vernehmen, dass sich der Angeklagte mit mehreren Personen in dem Jugendclub aufgehalten und dort mindestens ein bis zwei Stunden Karten gespielt habe bis der andere Angeklagte in den Jugendclub gekommen sei. Er schilderte sodann den weiteren Verlauf des Abends in dem Jugendclub und benannte zugleich auch Sozialarbeiter, die über Aufzeichnungen über den Abend verfügten. Die Kammer wies diesen Antrag mit der Begründung zurück, es handele sich um den bereits abgelehnten Beweisermittlungsantrag. Die Verteidigung sei nach wie vor nicht in der Lage, die Zeugen zu benennen, die trotz des Zeitablaufs noch Angaben zum Sachverhalt machen könnten.
191
Der BGH hob das Urteil auf und stellte klar, dass es sich bei den in der Hauptverhandlung gestellten Anträgen um Beweisanträge handelte, da der Nachweis einer ganz bestimmten Tatsache erbracht werden sollte. Er unterstrich, allein der Umstand, dass es zweifelhaft schien, ob sich noch alle oder auch nur einige der benannten Zeugen an die längere Zeit zurückliegenden Ereignisse würden erinnern können, nehme den Anträgen nicht den Charakter von Beweisanträgen.[168] Das macht deutlich, dass es nicht entscheidend darauf ankommt, ob der Antragsteller weiß, zu welchem Ergebnis die beantragte Zeugenvernehmung führen wird. Es ist ihm gestattet, einen Sachverhalt zum Gegenstand einer Beweisbehauptung zu machen, für dessen Bestehen es zumindest schwache Anhaltspunkte gibt.[169]
192
Diese Großzügigkeit in der Frage, auf welcher Tatsachengrundlage ein Beweisantrag formuliert werden kann, darf indessen nicht dazu verführen, das Stellen von Beweisanträgen als reine Formulierungskunst anzusehen. Ein erkennbar lediglich der Phantasie entsprungener Satz, eine aufs Geratewohl aufgestellte, aus der Luft gegriffene Behauptung ist nach herrschender Meinung keine zulässige Beweisbehauptung. Der Antragsteller muss für seine Behauptung eine faktische oder argumentative Grundlage haben.[170] So selbstverständlich dieser Grundsatz erscheint, weil er letztlich nicht mehr als das Einfordern von Sachlichkeit und rationalem Verhalten beinhaltet, so sehr ist er zugleich Ansatzpunkt für grundsätzliche Auseinandersetzungen über die Reichweite des Beweisantragsrechts. Meinungsverschiedenheiten über die Beweissituation in einem Strafverfahren lassen sich gerade hier festmachen. Schon weil das Beweisantragsrecht oft dazu dient, ein Vor-Urteil zu bekämpfen (s.o. Rn. 21), muss es geradezu zwangsläufig zu Situationen kommen, in denen das Gericht meint, der Antragsteller habe keine hinreichende Tatsachengrundlage für seine Behauptungen. Der rationale Umgang mit diesem in vielen streitig geführten Hauptverhandlungen zu Tage tretenden Grundkonflikt ist eine der wesentlichen Aufgaben nicht nur der tatgerichtlichen sondern auch der revisionsgerichtlichen Entscheidungen zum Beweisantragsrecht.
Der BGH hat in der Vergangenheit wiederholt betont, dass eine aus der Luft gegriffene Beweisbehauptung nicht zu einem zulässigen Beweisantrag führt, sondern zur Folge hat, dass der Antrag als Beweisermittlungsantrag zu behandeln ist.[171] In Einzelfällen hat die Rechtsprechung auch angenommen, dass es sich bei einer derartigen Konstellation um einen Scheinbeweisantrag handelt, der nicht einmal nach Maßgabe der Aufklärungspflicht zu behandeln sei.[172] Wird ein Zeuge zu mehreren Beweisbehauptungen benannt und widersprechen sich diese, so schließt der BGH hieraus, dass beide Beweisbehauptungen nur für möglich gehalten und nicht mit der nötigen Bestimmtheit behauptet werden, er behandelt den Antrag deshalb als Beweisermittlungsantrag.[173]
193
Von wesentlicher Bedeutung ist dabei für die Rechtsprechung der Umgang mit der Formel, eine Beweisbehauptung sei „aufs Geratewohl“ oder „ins Blaue hinein“ aufgestellt worden. Nachdem sie über lange Jahre zur Kennzeichnung von Anträgen verwendet worden war, denen nach Ansicht des BGH eine hinreichende Tatsachengrundlage fehlte, hat der 3. Strafsenat in einem Beschluss vom 19.9.2007 erwogen, diese Rechtsprechung aufzugeben.[174] Zur Begründung hat er insbesondere auf das Verhältnis zum Ablehnungsgrund der Verschleppungsabsicht verwiesen. Auf diesen Ablehnungsgrund kann das Gericht – ebenso wie auf die anderen Ablehnungsgründe in § 244 Abs. 3 S. 2 StPO – nur zurückgreifen, wenn es den gestellten Antrag zuvor als Beweisantrag bewertet hat. Eine der Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des Ablehnungsgrundes ist sodann aber, dass der Antragsteller um die Aussichtslosigkeit des Beweisantrages weiß (s. dazu unten Rn. 366 ff.). Wäre – was die Rechtsprechung zu den aufs Geratewohl aufgestellten Tatsachenbehauptungen fordert – die Beweisantragseigenschaft schon deshalb zu verneinen, weil die Beweistatsache ohne hinreichend sichere Tatsachengrundlage behauptet wurde, so verbliebe ein nicht auflösbarer Widerspruch.[175] In späteren Entscheidungen hat der 3. Strafsenat hierauf nochmals Bezug genommen, die Frage aber wiederum nicht entschieden.[176]
194
Zu einer abschließenden Klärung der Rechtsfrage ist es bislang nicht gekommen. Der 1. und der 2. Strafsenat des BGH haben in neueren Beschlüssen dargelegt, dass die Voraussetzungen einer Ablehnung des gestellten Antrages wegen nicht hinreichender Tatsachengrundlage jeweils im entschiedenen Fall nicht gegeben waren.[177] Der 4. Strafsenat hat in einem Beschluss vom 4.12.2012 die frühere Rechtsprechung zusammengefasst und im konkreten Fall beanstandet, dass sie vom Tatrichter fehlerhaft angewandt wurde.[178]
195
Die frühere Rechtsprechung hat damit insgesamt ihre praktische Bedeutung noch nicht verloren. Zu beachten ist dabei, dass die Frage, ob eine nicht ernstlich gemeinte Beweisbehauptung gegeben ist, primär auf der Grundlage der vom Antragsteller selbst nicht in Frage gestellten Tatsachen zu beurteilen ist.[179] Dass eine Beweisbehauptung aufs Geratewohl aufgestellt wurde, darf auch nicht damit begründet werden, die bisherige Beweisaufnahme habe keine Anhaltspunkte für die Richtigkeit der Beweisbehauptung ergeben.[180] Ebenso wenig kann dies darauf gestützt werden, die unter Beweis gestellte Tatsache sei objektiv ungewöhnlich oder erscheine als unwahrscheinlich, eine andere Möglichkeit habe näher gelegen.[181]
196
Diese Grundsätze werden indes nicht ausnahmslos angewandt. Mit ihnen steht es insbesondere nicht im Einklang, wenn ein Gericht es für die Herabstufung eines Antrages zu einem Beweisermittlungsantrag ausreichen lässt, die Bestätigung der Beweisbehauptung sei aufgrund der bisherigen Beweisaufnahme unwahrscheinlich, weil eine Mehrzahl neutraler Zeugen eine Tatsache übereinstimmend bekundet habe und, ohne Beleg für entsprechende tatsächliche Anhaltspunkte, das Gegenteil in das Wissen eines völlig neu benannten Zeugen oder eines Zeugen gestellt werde, dessen Zuverlässigkeit naheliegenden Zweifeln begegnet.[182] Insbesondere die damit geforderte Abwägung zwischen den bereits erhobenen Beweisen und dem voraussichtlichen Beweiswert des im Antrag bezeichneten neuen Beweismittels steht im Gegensatz zum Verbot der Beweisantizipation (zum Inhalt dieses Verbotes s. im Einzelnen unten Rn. 246 ff.).[183] Wird zur Begründung für die fehlende Beweisantragsqualität maßgeblich darauf verwiesen, es sei im Hinblick auf das „gesicherte Beweisergebnis“ unwahrscheinlich, dass der neu benannte Zeuge die aufgestellte Behauptung bestätigen werde, so unterläuft dies die aus der Systematik des § 244 StPO resultierende Schutzwirkung: Wird der gestellte Antrag als Beweisantrag gewertet, so gilt für seine Bescheidung das Verbot der Beweisantizipation jedenfalls in dem Rahmen, in dem es die Ablehnungsgründe enthalten. Wird dem Antrag hingegen diese rechtliche Qualität von vornherein abgesprochen, dann geht dieser Schutz insgesamt verloren.
197
So klar sich die beiden gedanklichen Extrempositionen gegenüberstehen, einerseits das Recht des Antragstellers, einen Beweisantrag bereits dann ausdrücklich auch mit einer als feststehend deklarierten Aussage zu formulieren, wenn er diese Aussage lediglich für möglich hält, und andererseits die Unzulässigkeit von Beweisbehauptungen, für die eine hinreichende Tatsachengrundlage fehlt, so unklar bleibt, wo die Trennungslinie verläuft.[184] Ein gewisser Schutz des Antragstellers geht noch davon aus, dass in den Fällen, in denen das Tatgericht ein Beweisbegehren zurückweisen will, weil der Antragsteller etwas aufs Geratewohl behauptet habe, das Tatgericht für seine Auffassung die Argumentationslast trägt.[185] Das Gericht muss belegen, dass der Antragsteller keine ausreichende tatsächliche Grundlage für die Richtigkeit der Beweisbehauptung hatte.[186]
Dieser verbliebene Schutz kann aber die systematischen Brüche nicht überdecken. Wird – wie von der Rechtsprechung teilweise zugelassen – die Beweisantragsqualität an Hand der Ergebnisse der bis dahin durchgeführten Beweisaufnahme und einer Bewertung der voraussichtlichen Beweiskraft der erwarteten Zeugenaussage beurteilt, so führt dies der Sache nach zu einer inhaltlichen Prüfung des Vorbringens, die dem Beweisantragsbegriff die Konturen nimmt. Ergibt sich in der Hauptverhandlung eine Situation, in der nach Ansicht des Gerichts Zweifel daran bestehen, dass der Antragsteller wirklich Grund zu der Annahme hat, das Beweismittel werde die Beweisbehauptung bestätigen, dann liegt es nahe, den Zurückweisungsgrund der Verschleppungsabsicht zu prüfen.[187] Der Umweg über eine Herabstufung des gestellten Antrages zum Beweisermittlungsantrag führt zu einer erheblichen und bedenklichen Einschränkung des Beweisantragsrechts.[188]
198
Nach zutreffender Ansicht hat der Tatrichter im Übrigen nicht die Befugnis, den Antragsteller nach seinen Wissensquellen oder den Gründen für seine Behauptungen zu fragen.[189] Dieser Grundsatz gerät durch die neuere Rechtsprechung zum Konnexitätserfordernis, auf die im Folgenden näher einzugehen sein wird, aber zusehends ins Wanken.
d) Die Verknüpfung zwischen Beweismittel und Beweisbehauptung („Konnexität“)
199
Die Rechtsprechung hat neben der Unterscheidung zwischen Beweistatsache und Beweisziel (siehe oben) ein weiteres Erfordernis für die Formulierung von Beweisanträgen aufgestellt. Sie verlangt eine als „Konnexität“ bezeichnete Verknüpfung zwischen Beweismittel und Beweisbehauptung.[190] Was genau dieses Erfordernis dem Antragsteller auferlegen soll, ist allerdings bislang nicht abschließend geklärt.[191] Die Anforderungen gehen in den Entscheidungen der Strafsenate des BGH unterschiedlich weit.
200
Dass ein Antrag nur dann als Beweisantrag anerkannt wird, wenn er neben der Beweistatsache und Darlegungen zur Wahrnehmungssituation auch Ausführungen zur „Konnexität“ enthält, hat der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs in einer Entscheidung aus dem Jahr 1997 ausdrücklich ausgesprochen. Darin ist festgehalten, dass ein Beweisantrag folgende Voraussetzungen hat:
| • | eine konkrete und bestimmte Behauptung einer Tatsache, |
| • | dass der Zeuge die behauptete Tatsache aufgrund eigener Wahrnehmung bekunden kann und |
| • | die so genannte Konnexität[192]. |
Dort wo es sich nicht „von selbst versteht“, dass ein bestimmter Zeuge eine Wahrnehmung gemacht haben kann, soll der Antragsteller darlegen, warum dies möglich war (zum Beispiel weil der Zeuge am Tatort war, in der Nachbarschaft wohnt oder eine bestimmte Akte gelesen hat).[193] Wenn „aus dem Inhalt des Beweisbegehrens ein verbindender Zusammenhang zwischen der Beweisbehauptung und dem benannten Zeugen nicht ohne Weiteres erkennbar“ ist, soll der Antragsteller generell verpflichtet sein, Ausführungen dazu zu machen, aus welchem Grund der benannte Zeuge etwas zu dem Beweisthema bekunden können soll.[194] Er muss dann die Wahrnehmungssituation des Zeugen hinreichend konkret darlegen.[195] Das Vorbringen des Antragstellers soll dem Gericht eine sachgerechte Prüfung und Anwendung der Ablehnungsgründe des § 244 Abs. 3 StPO ermöglichen,[196] wobei hier – anders als beim Erfordernis der Bestimmtheit der Beweisbehauptung – der Ablehnungsgrund der Ungeeignetheit des Beweismittels im Vordergrund stehe.[197]
201
Terminologisch wird dieses Erfordernis als die Konnexität „im weiteren Sinne“ bezeichnet, – im Gegensatz zur Konnexität „im engeren Sinne“, die auch als das Erfordernis hinreichend bestimmt formulierter Beweistatsachen verstanden werden kann.[198] Das Erfordernis der hinreichenden Bestimmtheit von Beweistatsachen ist dabei aus dem Beweisantragsbegriff ableitbar, einer gesonderten Kategorie der „Konnexität im engeren Sinne“ bedarf es insoweit nicht. Allenfalls für die Frage, ob zwischen dem benannten Beweismittel und der unter Beweis gestellten Tatsache eine hinreichende Verbindung besteht (ob m.a.W. der Zeuge die Tatsache wahrgenommen haben kann), erscheint auch der Begriff des „Konnexes“, bzw. der Konnexität terminologisch passend.
202
Der Sache nach wird dem Antragsteller durch das Erfordernis der Konnexität im weiteren Sinne eine Art „Substantiierungslast“ auferlegt, die in direktem Bezug zum Ablehnungsgrund der Ungeeignetheit steht. Fehlt es an der erforderlichen Konnexität (z.B. bei nicht evidenter „Wahrnehmungsmöglichkeit“ des benannten Zeugen), so macht dies die gestellten Anträge allerdings nicht unzulässig, sie sind lediglich als Beweisermittlungsanträge zu werten.[199]
Obwohl mittlerweile zahlreiche höchstrichterliche Entscheidungen hierzu ergangen sind, ist umstritten geblieben, welche Bedeutung dem zitierten Erfordernis zukommen soll. Verschiedentlich wird in der Literatur gefolgert, die Konnexität sei als „konstitutives Merkmal“ eines Beweisantrages anzusehen.[200] Zwar lassen sich Entscheidungen mehrerer Senate durchaus so interpretieren. Ein wirklich einheitliches Bild ergibt sich jedoch nicht.
Nachdem er mit seiner oben zitierten Entscheidung aus dem Jahr 1997 zunächst wesentlich zur Karriere des neuen Merkmals beigetragen hat, hat etwa der 3. Strafsenat im Jahr 2014 die Frage ausdrücklich offen gelassen, ob es sich um ein konstitutives Merkmal des Beweisantragsbegriffs handelt.[201] Nach wie vor werden hiergegen in der Literatur jedoch auch generelle Einwände erhoben.[202]
203
Jenseits aller grundsätzlichen Kritik, die sich insbesondere auf das wenig folgerichtige Verhältnis des Konnexitätsmerkmals zu den Ablehnungsgründen und die Verletzung des Beweisantizipationsverbotes stützt[203], zeigen die inzwischen entschiedenen Fälle auch, dass eine erhebliche Unsicherheit bei der Anwendung des Konnexitätserfordernisses besteht. Gerade weil die zitierten Formeln der Rechtsprechung eine Art „Evidenzvorbehalt“ enthalten (Nur wenn „es sich nicht von selbst versteht“, sind Ausführungen zur Konnexität nötig), fordern sie zu unterschiedlicher Anwendung geradezu heraus.
So bedurfte etwa der Klarstellung durch den BGH, dass die notwendige Konnexität gegeben ist, wenn Gesellschafter und Geschäftsführer als Zeugen zu der Frage benannt werden, ob ein Unternehmen als Subunternehmer tätig war.[204] Auch sind gleich zwei Entscheidungen dazu ergangen, dass es im Sinne der dargestellten Rechtsprechung keiner weiteren Darlegung der Wahrnehmungssituation bedarf, wenn ein Gesprächsteilnehmer für den Inhalt eines Telefongesprächs als Zeuge benannt wird, an dem er selbst teilgenommen hat.[205] Der Klarstellung bedurfte auch, dass ein Mitfahrer in einem Auto als Zeuge für Tatsachen benannt werden kann, die sich während der Fahrt ereignet haben.[206] Nach wie vor genügt die Benennung eines Zeugen vom Hörensagen den Bestimmtheits- und Konnexitätsanforderungen.[207]
Diese Entscheidungen des BGH belegen, dass das Konnexitätserfordernis in der Rechtsprechung der Instanzgerichte bisweilen zu großzügig angewandt wird, was nicht zuletzt für seine Unschärfe spricht. Wenn in der Literatur versucht wird, die „Wertungsoffenheit“ des Konnexitätsbegriffs hervorzuheben,[208] zeigt das letztlich nur, dass mit der Konnexität kein trennscharf konturiertes Kriterium benannt ist. Durch Einführung „wertungsoffener“ Kriterien werden die schützenden Formen des Beweisantragsrechts aufgelöst.
204
Das Konnexitätserfordernis gewinnt in den Fällen besondere praktische Bedeutung, in denen umstritten ist, ob ein Zeuge eine bestimmte Situation wahrgenommen haben kann.[209] Die Rechtsprechung verlangt vom Antragsteller die Darlegung von Tatsachen, die es plausibel machen, dass der Zeuge so aussagen wird wie in der Beweisbehauptung formuliert.
Besonders strenge Anforderungen hat dabei der 5. Strafsenat des BGH in seinem Urteil vom 10.6.2008 aufgestellt. Darin wird dargelegt, dass sich die an den Antragsteller zu stellenden Anforderungen erhöhen, wenn ein Beweisantrag erst zu einem späten Zeitpunkt in der Hauptverhandlung gestellt wird. Die Darlegung der Eignung des Begehrens für eine weitere Sachaufklärung habe, so heißt es in der Entscheidung, „auf der Grundlage des bisherigen Beweisergebnisses zu erfolgen“ und könne „beim Zeugenbeweis die Darlegung der Wahrnehmungssituation des Zeugen auf der Grundlage des Verständnisses des Antragstellers von der erreichten Beweislage erfordern, sofern sich dies nicht von selbst versteht.“[210]
Der Antragsteller soll also schildern, wie er das bisherige Ergebnis der Hauptverhandlung wertet und dann noch begründen, dass vor diesem Hintergrund die Möglichkeit besteht, dass der Zeuge die unter Beweis gestellten Tatsachen auch wahrgenommen haben kann. Trotz vielfältiger Kritik hat der 5. Strafsenat in späteren Entscheidungen bekräftigt, dass er an dieser Rechtsprechung festhalten will.[211] In einem Beschluss vom 24.3.2014 hat er allerdings einen tatrichterlichen Beschluss beanstandet, durch den ein Beweisantrag mit der Begründung zurückgewiesen worden war, es fehle die Konnexität.[212]
205
Der Versuch, den Umfang der notwendigen Darlegungen vom Verlauf der Beweisaufnahme bis zum Zeitpunkt der Antragstellung abhängig zu machen, ist jedoch von den übrigen Senaten des BGH bislang nicht aufgegriffen, sondern mit erkennbarer Distanz aufgenommen worden. Der 3. Strafsenat hat die in BGHSt 52, 284 aufgestellten Anforderungen schon kurze Zeit später als „sehr weitgehend“ bezeichnet.[213] In späteren Entscheidungen hat er ausdrücklich offen gelassen, ob der Rechtsansicht zu folgen ist oder ob sie nicht vielmehr als Abkehr von dem Grundsatz verstanden werden muss, dass der Antragsteller auch das unter Beweis stellen darf, was er nur vermutet.[214] Fraglich ist auch, ob es sich in das System des § 244 Abs. 3 StPO einfügt, wenn die Anforderungen an einen Beweisantrag vom bisherigen Ergebnis der Beweisaufnahme abhängig gemacht werden.[215]
Der 4. Strafsenat hat zunächst ebenfalls offen gelassen, ob den in BGHSt 52, 284 aufgestellten Grundsätzen allgemein zu folgen wäre und auf die Bedeutung des Antizipationsverbots hingewiesen.[216] Er hat in einer späteren Entscheidung dann die verschiedenen Anforderungen zusammengefasst und hieraus die Konsequenz gezogen, dass die Ausführungen zur Konnexität im weiteren Sinne dem Gericht insbesondere eine sachgerechte Prüfung der Ablehnungsgründe ermöglichen sollen. Im Vordergrund stehe dabei der Ablehnungsgrund der Ungeeignetheit. Da die Ungeeignetheit nur aus dem Beweismittel selbst begründet werden dürfe, seien auch die erforderlichen Angaben auf solche beschränkt, die die Wahrnehmungssituation des Zeugen betreffen. Ausführungen zur inhaltlichen Plausibilität der Beweisbehauptung seien hingegen nicht erforderlich.[217]
Der 1. Strafsenat hat anerkannt, dass sich neben der Angabe einer Beweistatsache und des Beweismittels je nach den Umständen des Einzelfalls als zusätzliches Erfordernis die Konnexität zwischen Beweismittel und Beweistatsache ergeben kann. Hierunter sei zu verstehen, dass der Antrag erkennen lassen muss, weshalb der Zeuge etwas zum Beweisthema bekunden können soll.[218]
Der 2. Strafsenat hat in einem Beschluss vom 22.8.2008 zu der Kontroverse nicht im Einzelnen Stellung genommen, sondern sich darauf beschränkt, festzustellen, dass das Tatgericht die gestellten Anträge zu Unrecht wegen fehlender Konnexität abgelehnt hatte.[219]
206
Eine in allen Belangen einheitliche Linie der Senate des Bundesgerichtshofs besteht danach derzeit nicht.[220] In der Literatur ist das Urteil vom 10.6.2008 – zu Recht – überwiegend auf Ablehnung gestoßen.[221] Gegen eine – je nach dem Fortgang der Hauptverhandlung – abgestufte Darlegungslast des Antragstellers spricht entscheidend schon ein systematisches Argument: Würde ein Antrag erst dadurch zum Beweisantrag, dass darin auf das bisherige Ergebnis der Beweisaufnahme eingegangen und dieses Beweisergebnis sodann den Wahrnehmungsmöglichkeiten des Zeugen gegenübergestellt wird, dann würde hierdurch nicht nur eine konkrete Begründungspflicht für den Beweisantrag eingeführt. Es würden zudem die gestellten Anträge einer Art „Vorprüfung“ unterzogen, die der Prüfung der eigentlichen Ablehnungsgründe des § 244 Abs. 3 StPO gedanklich vorgeschaltet wäre. Das ist in § 244 Abs. 3 und Abs. 6 StPO aber so nicht angelegt.
207
Die durch BGHSt 52, 284 postulierte Abhängigkeit des Umfangs der notwendigen Ausführungen vom Stand der Beweisaufnahme führt im Übrigen dazu, dass ein und derselbe Antrag zu Beginn der Hauptverhandlung als förmlicher Beweisantrag anerkannt, am Ende der Beweisaufnahme hingegen als Beweisermittlungsantrag gewertet werden kann. Schon das erscheint wenig folgerichtig.[222] Keine hinreichende Beachtung findet auch der Umstand, dass zwischen Antragsteller und Gericht regelmäßig unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf die Würdigung der bisherigen Beweisaufnahme bestehen. Sieht der Antragsteller es nach seiner Würdigung der bisherigen Beweisaufnahme als selbstverständlich an, dass der Zeuge die unter Beweis gestellten Wahrnehmungen gemacht haben kann, dann wird er möglicherweise schon aus diesem Grund auf Ausführungen zur Würdigung der einzelnen Zeugenaussagen verzichten. Erfährt er sodann aus dem weiteren Verlauf der Verhandlung, dass das Gericht seinen Antrag allein deshalb nicht als Beweisantrag wertet, weil die Konnexität nicht gegeben sei, dann muss er jedenfalls Gelegenheit haben, den Antragsinhalt „nachzubessern“.[223]
208
Der 5. Strafsenat hat dies in seinem Urteil berücksichtigt, indem er darauf hinweist, der Antragsteller müsse seine Sicht der Beweisaufnahme wiedergeben, er trete damit sodann in „eine Art Dialog“ mit dem Gericht und den übrigen Verfahrensbeteiligten über die Eignung des Beweismittels und die Notwendigkeit der Beweiserhebung ein.[224] Daran ist zutreffend, dass der Antragsteller auch nach Hinweisen auf Mängel seines Antragsvorbringens noch Gelegenheit haben muss, diese zu beseitigen. Zur Idee eines Dialogs passt aber schon nicht, dass die Rechtsprechung sonst immer wieder hervorhebt, es bestehe keine Verpflichtung des Tatgerichts, über gestellte Anträge auch alsbald zu entscheiden,[225] so dass der Antragsteller im ungünstigsten Fall bis kurz vor Schluss der Beweisaufnahme im Ungewissen darüber bleibt, wie das Gericht sein Vorbringen bewertet.[226]
209
Das Modell des Dialoges erscheint daneben an dieser Stelle aber auch deshalb als wenig geeignet, weil es mit den unterschiedlichen Rollen der Verfahrensbeteiligten kollidiert. Es geht von einer grundsätzlichen Informationspflicht des Antragstellers aus und gerät damit in Konflikt mit anderen Prinzipien. Weist das Gericht (in welcher prozessualen Form auch immer) darauf hin, es sehe in dem gestellten Antrag lediglich einen Beweisermittlungsantrag, weil der Antragsteller trotz des „eindeutigen“ Inhalts der bisherigen Beweisaufnahme keine konkreten Angaben dazu gemacht hat, aus welchem Grund der Zeuge die Tatsache wahrgenommen haben soll, dann wird dadurch nicht nur eine Begründungspflicht eingeführt, die es bislang nicht gegeben hat. Zugleich wird die Darlegungslast umgedreht: Bisher musste das Gericht begründen, dass es einen Zeugen für ein ungeeignetes Beweismittel hält und durfte dies nicht mit Erkenntnissen aus der Beweisaufnahme begründen.[227] Jetzt soll „umgekehrt“ der Antragsteller die Eignung des benannten Beweismittels jedenfalls plausibel machen, wenn nicht gar nachweisen. Durch so verstandene Anforderungen wird das Beweisantragsrecht aber entscheidend geschwächt. Zudem ist der Konflikt mit dem Schweigerecht des Angeklagten und der Schweigepflicht des Verteidigers greifbar.[228] Daran ändert auch die Einstufung der Darlegungslast des Antragstellers als bloße „Obliegenheit“[229] nichts. Entscheidend ist, dass ohne Erfüllung der Darlegungslast die durch das Beweisantragsrecht bewirkte Garantie verlorengeht.
210
Wie die Entwicklung der Rechtsprechung zeigt, hat mit dem Merkmal der Konnexität nicht nur ein schillernder Begriff in die Dogmatik des Beweisantragsrechts Einzug gehalten. Schon die Versuche, zwischen einer Konnexität im engeren Sinne, einer Konnexität im weiteren Sinne und einer Konnexität im noch weiteren Sinne zu unterscheiden,[230] machen das deutlich. Sie wirken im Ergebnis wenig überzeugend und deuten darauf hin, dass hier ein Gedanke überstrapaziert wird. Wenn der Antragsteller gezwungen werden soll, in seiner Beweisbehauptung nicht nur ein Beweisziel, sondern eine von dem Zeugen konkret beobachtbare Tatsache zu benennen, deutet das nicht auf die Erforderlichkeit eines neuen Kriteriums der Konnexität zwischen Beweismittel und Beweistatsache hin. Es lässt sich aus der prozessualen Funktion des jeweiligen Beweismittels ableiten und in begrenztem Umfang auch rechtfertigen. Die Unterscheidung zwischen Beweistatsache und Beweisziel ist geeignet, den Blick für die Grenze zwischen Wahrnehmung und Schlussfolgerung zu schärfen. Sie ist aber nicht gleichbedeutend mit der Grenze zwischen Beweisantrag und Beweisermittlungsantrag (s. oben Rn. 169).
211
Ähnliches gilt letztlich für die sonst unter dem Oberbegriff der Konnexität „im weiteren Sinne“ diskutierten Fragestellungen. Dass ein Zeuge die Wahrnehmungen, für die er im Antrag benannt wird, auch gemacht haben kann, ist Voraussetung für seine Eignung als Beweismittel. Kann er bestimmte Wahrnehmungen nicht gemacht haben, kann der Antrag wegen Ungeeignetheit zurückgewiesen werden. Schon weil das aber – wie jede Anwendung der Ablehnungsgründe des § 244 Abs. 3 StPO – voraussetzt, dass der Antrag zuvor als Beweisantrag gewertet wird,[231] können Überlegungen zur Eignung des Beweismittels nicht durch Einführung eines neuen, aus dem Antragsbegriff abgeleiteten Merkmals der Konnexität auf eine andere Prüfungsebene vorverlagert werden.[232] Haben mehrere Zeugen eine bestimmte Situation wahrgenommen, einige von ihnen die Beweisfrage in der Hauptverhandlung bereits verneint und wird sodann ein weiterer Zeuge aus der Gruppe benannt, der nach dem Antragsinhalt die Beweisfrage bejahen soll, dann kann nicht durch eine Art „kleine Eignungsprüfung“ im Rahmen des Konnexitätsmerkmals vorab geklärt werden, ob der Antragsteller konkrete Anhaltspunkte dafür benannt hat, dass gerade dieser Zeuge anders als alle anderen zu der Beweisfrage aussagen wird.[233] Der Mechanismus von Vorurteil und Sinnerwartung, dem das Beweisantragsrecht entgegenwirken soll, würde sonst geradezu zum Prinzip erhoben: Das Beweisantragsrecht existiert vor allem um vorzeitige Festlegungen zu verhindern. Würde sich ein Kriterium des Beweisantragsbegriffs an früheren Beweiserhebungen orientieren (wie dies nach BGHSt 52, 284 in Bezug auf das Konnexitätsmerkmal der Fall wäre), dann müsste schon vor Prüfung der Ablehnungsgründe eine vorläufige Würdigung der erhobenen Beweise stattfinden. Das würde die Begrenzungen der zulässigen Beweisantizipation, die sich aus der Dogmatik der Ablehnungsgründe ergeben, überflüssig machen. Das Beweisantragsrecht löst diesen Konflikt zu Recht auf anderer Ebene: Es ermöglicht dem Gericht, im Freibeweisverfahren Ermittlungen über den Zeugen und seine mögliche Aussage durchzuführen und auf der Grundlage dieser Ermittlungen zu prüfen, ob einer der Ablehnungsgründe des § 244 Abs. 3 StPO vorliegt.