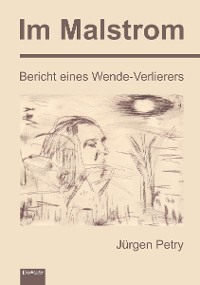Kitabı oku: «Im Malstrom», sayfa 3
V
Alles in allem ging es uns materiell ja eigentlich ganz gut im „real existierenden Sozialismus“. Zumindest solange wir die Landesgrenzen nicht überschritten. Taten wir das, zum Glück ging es ja nur nach Osten, begann unsere Diskriminierung. Wir konnten eben in keiner Beziehung mithalten, nicht einmal mit dem letzten Arbeitslosen von „denen da drüben“. Unvergesslich wird mir ein Erlebnis in einer Kleinstadt der hintersten polnischen Provinz bleiben. Das Ereignis fand an der Bar des einzigen Hotels in jenem Ort statt. Wir waren zur Montage dorthin geschickt worden und sollten Hochleistungsmaschinen aus unserer Firma in einem neu gebauten Werk anschließen und einfahren, wie das genannt wurde. Eines Abends langweilten wir uns, mein Kollege und ich. Wir saßen in der halbdunklen, einzigen Bar der ganzen Gegend. Das Etablissement war spärlich und nur von Männern besucht. Wir waren, glaube ich, beim sechsten oder siebenten widerlich warmen polnischen Wodka angelangt, der bekanntlich in jedem Land der Welt alle Frauen immer schöner werden lässt. Zu später Stunde, als wir schon alle Hoffnung auf ein interessantes harmloses Gespräch aufgegeben hatten, flogen doch noch ein paar Mädels ein, deren Passion in Polen mit „Möwen“ umschrieben wurde. Schnell teilten sie sich an den Tischen der wenigen Männer auf. Eine etwas korpulente exotische Schönheit schob einen Barhocker zwischen mich und meinen Kollegen und fragte mit einem bezaubernden Augenaufschlag, zuerst englisch, dann in gebrochenem Deutsch, ob wir ihr nicht ein Gläschen Krim-Sekt spendieren würden. Das taten wir natürlich gern. Nicht, dass ich auch nur im Entferntesten daran gedacht hätte, meine geliebte Jana hier im finsteren Polen mit einer einheimischen Möwe zu betrügen. Das hätte ich nie getan. Aber unterhalten wollten wir uns schon mit ihr. Doch gerade als wir sie zu einem zweiten Glas einladen wollten, entschloss sie sich, den Vorgang abzukürzen und fragte sehr direkt: „Kommt ihr aus dem großen, dem kleinen Deutschland oder Österreich?“ Als ich wahrheitsgemäß antwortete: „Aus dem kleinen“, denn ich nahm an, sie würde ehrlich erfreut sein, auf zwei Angehörige eines sozialistischen Brudervolkes getroffen zu sein, rutschte sie mit einem leisen Gemurmel, das mich an einen, auch bei uns gebräuchlichen, Fluch erinnerte, ohne ein weiteres Wort vom Barhocker. Nie werde ich den Blick tiefster Verachtung vergessen, den sie uns noch zuwarf. Völlig zu Recht, denn wir hatten sie unbewusst geschädigt, weil wir sie von der Arbeit abgehalten hatten, wie ich heute weiß. Eine Minute später hörten wir sie an einem nahen Tisch, mit drei betagten äußerst fiesen Typen, die gleiche Frage stellen. Die mussten die Typen wohl zufriedenstellend beantwortet haben, denn sie setzte sich zu ihnen an den Tisch. Der Barkeeper öffnete auf ein Fingerschnipsen des Fiesesten der drei Fieslinge den Kühlschrank, holte einen eiskalten französischen Champagner hervor, zumindest hatte die Flasche ein solches Etikett, und servierte ihn in devoter Haltung direkt am Tisch. Mehr wollten wir nicht sehen und hören auch nicht, deshalb verließen wir sofort die Bar. Unsere Ostmark nahm der Schnapsschüttler zwar, anstelle der beinahe schon wertlosen einheimischen Währung, steckte sie aber inklusive Trinkgeld mit einer beleidigenden Gleichgültigkeit und ohne zu danken ein.
Wem das geschah, der kann vielleicht unsere immer wieder aufflammende „Freiheitssehnsucht“, die uns schließlich um den Leipziger Ring trieb, besser begreifen. Sicher hat auch unser heutiger Herr Bundespräsident im Osten, bei den „Brudervölkern der DDR“, etwas Ähnliches erlebt. Seine schwer zu erforschenden Wege müssen ihn auch zu unseren Nachbarn und dort in eine Bar mit Möwen geführt haben. Irgendeine Erklärung muss es doch dafür geben, dass er bei jeder sich bietenden Gelegenheit gebetsmühlenartig die „Freiheit“ beschwört. Was damit gemeint ist, wissen wir ja jetzt. Kränkungen haben eben manchmal eine Langzeitwirkung und direkt spricht ja niemand gern darüber. Wir aber wissen, dass nach einem solchen Vorkommnis selbst dem an mehreren Parteischulen studierten treuesten Genossen Zweifel an der historischen Mission des „real existierenden Sozialismus“ kommen mussten. Uns jedenfalls fiel nach dem Barbesuch sofort wieder ein, wie sehr wir geknechtet waren im Osten und das Bedürfnis nach der Freiheit, die D-Mark hieß, stieg.
Ich hatte Elektriker gelernt, anschließend in Zwickau auf Ingenieur studiert und leitete in unserem Unternehmen eine Brigade Betriebshandwerker, genauer gesagt die Elektrikerbrigade „Stromschnelle“. Meine Frau Jana, ich erwähnte es bereits, war Slawistin an der hiesigen Universität und unser Sohn Dreher in einem metallbearbeitenden Betrieb der Stadt Leipzig. Eigentlich liefen unsere familiären Beziehungen bis dahin recht harmonisch. Irgendwann setzten dann aber auch bei uns, zunächst unmerklich, die Vorwendeturbulenzen ein. Jeder gegen jeden. Als ich es bemerkte, war es fast zu spät.
Bei seiner nunmehr festen Freundin Ilona hatte unser Sohn Waldemar Henry nicht nur wegen seines neuen „Sexy-Namens“ das Rennen gemacht, sondern vor allem, weil er ihr gleich am Anfang ihrer sich entwickelnden Beziehung versichert hatte, dass er im laufenden Jahr, also noch 1989, fest auf der Verteilerliste der AWG für eine Neubauwohnung stände. Das war eine „Super-Aussteuer“ für jeden künftigen Lebenspartner, vielleicht nicht nur in der DDR, dort aber auch. Als Ilona sich durch Nachfrage bei der AWG von der Wahrheit dieser frohen Botschaft überzeugt hatte, war ihre Entscheidung gefallen. Mehr bedurfte es nicht. Sie gab ihrem bisherigen Freund, der auf den Namen Günter Krause hörte, den Laufpass und zog zunächst zu uns. Das heißt in das bis dahin von Waldemar Henry allein bewohnte Kinderzimmer. Mich zu fragen, hatten sie aus Versehen vergessen. Zunächst schwieg ich, wenn auch verbissen. Doch als ich in der Folge davon innerhalb einer Woche zweimal meinen Bus verpasste, weil die Beiden schamlos gemeinsam unser Bad zu meiner gewohnten Aufstehzeit blockierten und ich mit dem Fahrrad zur Arbeit hetzen musste, lief das Fass über.
Das Verhalten Waldemar Henrys und seiner Ische überschritt meine ohnehin durch die Anspannungen niedrig gewordene Toleranzgrenze. Ich kündigte zunächst meiner geliebten Frau Jana an, dass ich die Beiden ratz patz auf die Straße zu setzen gedächte. Sie stimmte mir zu meiner Überraschung nicht zu, sondern fing an zu schmeicheln. „Sei doch nicht so borstig“, begann sie und strich mir demonstrativ mein unrasiertes Kinn. „Die sind nun mal jung und verliebt. Es ist ja auch nicht für lange. Dann haben sie ihre eigene Wohnung.“ Ich blieb hart. Da wurde meine Jana schnippisch. „Du bist nur neidisch“, fing sie an. Dann sich steigernd und meiner Meinung nach völlig aus dem Zusammenhang gerissen: „Denke ruhig einmal nach, bevor du dich aufspielst, wie lange es her ist, dass wir beide uns gemeinsam im Bad vergnügt haben.“ Als ich auf die Anspielung nicht reagierte, wurde sie richtig spitz: „Das sagt dir natürlich nichts mehr?“ Es sagte mir schon etwas. Ich wurde sogar verlegen, wollte aber das Thema nicht wechseln. Wütend gemacht hatte mich ja nicht allein die verschlossene Türe zum Bad, sondern alles zusammen. Deshalb schniefte ich nur, jede Vorsicht vergessend: „In meiner Wohnung gelten immer noch meine Regeln. Auch wenn ich schon nicht gefragt werde, bevor mein Sohn hier so etwas wie ein Stundenhotel einrichtet.“ Das war vielleicht etwas stark und traf, zugegeben, auch nicht genau den Kern. Sofort lief meine geliebte Jana rot wie die Arbeiterfahne an und holte zum Tiefschlag aus: „Unsere Wohnung meinst du wohl und unser Sohn ist es auch. Zumindest wahrscheinlich!“ Das saß bei mir und sie wusste, dass es gesessen hatte. Jana drehte sich um und knallte mir vor der Nase die Türe zu. Es war der erste wirklich böse Streit zwischen uns. Niemand war mehr darüber verblüfft als ich.
Entsetzt über den ungewohnten Ton und die Andeutung in der letzten Satzhälfte starrte ich ihr hinterher, bis ich ihr schließlich ins Wohnzimmer folgte. Rette, was noch zu retten ist, muss ich wohl gedacht haben. Auf jeden Fall machte ich alles falsch. Mein Eintritt ins Wohnzimmer besänftigte Jana nicht, sondern stachelte sie richtig auf. Messerscharf klang jetzt ihre Stimme: „Wann hätte dich der Kleine“, gemeint war unser 1,86 Meter große Lulatsch Waldemar Henry, „eigentlich dazu befragen sollen? Du hast wohl vergessen, dass du deine Zeit seit Wochen nur noch auf zweifelhaften Demos oder mit sinnlosen Palavern in deiner Firma, aber nicht hier, in der eigenen Familie, verbracht hast?“ Ich war so erschrocken, dass mir nicht sofort eine passende Entgegnung einfiel. Das legte Jana wahrscheinlich als Sieg aus, denn sie schmetterte mir wie eine Fanfare entgegen: „Wenn hier einer geht, dann bist du es!“ Nach diesem kategorischen Imperativ knallten wieder die Türen. Erst die vom Wohn-, dann die vom Schlafzimmer. Dabei blieb es nicht. Jana verbannte mich für die folgende Nacht auf unsere Wohnzimmercouch. Ich begann zu ahnen, dass etwas schief zu laufen begann in unserer Familie.
VI
Noch heute, unmittelbar vor meinem endgültigen Abgang, stelle ich mir immer wieder die Frage: Warum war es uns Ostdeutschen auf einmal, im Herbst ’89, so wichtig, spontan, sofort und geradezu kopf- und führungslos in die deutsche Einheit zu rennen? Gewiss, die Lage war angespannt in der DDR. Und die SED hatte ihren Kredit verspielt. Die Bevölkerung wollte nicht mehr, nicht mehr so. Alles richtig! Aber beginnt man deshalb ohne Führung eine Revolution? Immer vorausgesetzt, die „friedliche“ war eine solche! Selbst für den Zusammenschluss von zwei Handwerksbetrieben braucht man zumindest annähernd gleichberechtigte Verhandlungspartner. Das denke ich mir so als Nichtpolitiker und Nichtfachmann, aber vielleicht irre ich mich auch?
Wir, die Ossis, brauchten das bei der Aufgabe unseres Landes offenbar nicht. Wir hatten ja erfahrene Brüder und Schwestern da drüben. Die würden es schon richten. Was sie dann auch taten. Wir aber, wir wollten sie unbedingt und schnell, die Freiheit oder die D-Mark, was ein Synonym für das Gleiche war in den meisten unserer Köpfe. Na schön, heute wissen wir es besser. Ich auch. Man muss nur zuhören in den Wirtshäusern. Vielleicht erinnerst du dich an mein Erlebnis in der finsteren polnischen Bar. Das prägt. Jeder im Osten hatte damit Erfahrungen gesammelt, nicht nur im Ausland, auch im einheimischen Intershop, in den Nobelhotels und, zumindest in den letzten Jahren vor dem 3. Oktober 1990, sogar mit Handwerkern und anderen Dienstleistern. Die D-Mark war zur Zweitwährung im eigenen Land geworden. Wer sie besaß, war privilegiert, wer nicht … na, das hatten wir schon. Nein, so erzieht man keine Staatsbürger, im weitesten Sinne des Wortes.
Jeder, der in der DDR eine Schule besucht hatte, wusste, egal ob er es von Rousseau, Robespierre, Marx, Engels, Lenin, Napoleon oder sogar Stalin gelernt hatte, dass eine Revolution ohne Programm und Führung nicht gewonnen werden kann. Dafür gibt es tatsächlich kein Beispiel in der Geschichte. Doch das sind heute überflüssige Fragen. Damals hätten wir sie stellen müssen! Aber – niemand unter den „Deutschen Demokratischen Revolutionären“ war offen für kritische Überlegungen. Es gab nur eins, vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ich kann heute nicht mehr sagen, ob und wann bei einigen der Punkt erreicht war, von dem an sie die Veränderungen im Land kritisch zu sehen begannen. Falls überhaupt jemals. Auf jeden Fall war es zu spät. „Ist ein Pfeil einmal vom Bogen geschnellt, kann keine Macht der Welt ihn zurückholen“, sagte der große Mongolenführer Temudschin, der später zum Dschinghis Khan wurde. Und der wusste, wovon er sprach.
Ich jedenfalls fuhr von da an nur noch gelegentlich zur Montagsdemo nach Leipzig. Es war ja richtig, dass die Zeit reif für revolutionäre Veränderungen war. Nur die Ungeduld des immer unzufriedener werdenden Volkes war eine kaum noch zu beherrschende Triebkraft. Wer behielt da schon einen kühlen Kopf? Das fragte ich mich immer häufiger, bis es sich nicht mehr verdrängen ließ. Angst vor der Zukunft stieg in mir hoch. Niemand schien darüber nachzudenken, dass man bei einer eventuellen Wiedervereinigung nichts geschenkt bekommen würde. Kampf würde es bedeuten, nicht Kuschel-Kurs! Einen Einigungsvertrag aushandeln zumindest auf annähernder Augenhöhe! Wer sollte das tun, wenn alle Autoritäten und Fachleute des eigenen Landes unter Generalverdacht gestellt, beschimpft und schließlich abgewählt wurden? Auf welcher Rechtsgrundlage auch immer? Wer dachte schon darüber nach, dass die Früchte, selbst der friedlichsten der vorangegangenen Revolutionen, nie in den Taschen der Revolutionäre, sondern in denen der Geschäftemacher gelandet waren? Und was erst geschehen wird, dachte ich manchmal, wenn es aufseiten der Revolutionäre weder ein klares Ziel noch eine autorisierte Führung gibt? Wahrscheinlich ein böses Erwachen! Wir hätten es wissen können, wie es geht nach vergeigten Revolutionen, denn so ähnlich muss es schon 1848 gewesen sein, sinnierte ich. Georg Werth oder Heinrich Heine, jedenfalls einer der Achtundvierziger, glaube ich, schrieb damals: „Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht!“
Dem muss es ähnlich ergangen sein wie mir, dachte ich. In unserer Euphorie schrien wir zwar laut: „Weg mit der SED-Herrschaft!“, „Stasi in den Tagebau!“, „Freiheit für Wort und Schrift!“ und so weiter und so fort. Forderungen, aber kein Programm für die Zukunft. Bereits zwei Jahre später wären ein paar Millionen Ostdeutsche glücklich gewesen, hätten sie wenigstens im Tagebau arbeiten dürfen.
„Reisefreiheit!“ – Wer wollte die nicht? Aber war das ein wichtiges Ziel in einer Revolution? Alle wollten alles. Möglichst sofort! Und alles sollte aus dem Westen kommen! Umsonst? Oder zu welchem Preis? Mir jedenfalls wurde es manchmal ganz schlecht, wenn ich auf dem Leipziger Karl-Marx-Platz die Tiraden der selbsternannten Tribunen zu hören bekam. Nur wenig früher als die Geschäftemacher aus dem Westen, mithilfe der Treuhand, schleichend aber seelenruhig und unbehelligt ihre Claims absteckten.
Spontane Revolutionen sind chancenlos, wenn niemand sie führt. Das schrieb Altgenosse Lenin bereits 1905 als Lehre nach der vergeigten ersten russischen Revolution. Eine, die noch bürgerliche Ziele verfolgte. Wenn es stimmt, hat er wohl recht gehabt. Nicht nur in der DDR überschlugen sich die Ereignisse. Auch in Ungarn, Rumänien, Tschechien. Eine organisierte Führung gab es aber nur in Polen. Die Völker des Ostblocks wollten nicht weiter experimentieren an einem gescheiterten System, aber was sie stattdessen wollten, wussten sie nicht genau. In der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wusste man es: Absatzmärkte, preiswerte Produktionsstandorte und ein unerschöpfliches Arbeitskräftereservoir. „Wehe den Siegern?!“
Aber immer wieder verdrängte ich diese trüben Gedanken. Erst, als ich mit meiner Brigade „Stromschnelle“ im Schulterschluss um den Leipziger Ring marschierte, später dann im Wirtshaus zum „Roten Oktober“ in Wolfen Nord, wenn ich gemeinsam mit den anderen Arbeitslosen Zukunftspläne schmiedete.
Und dann war da plötzlich auch noch etwas Unvorhersehbares. In der „Hauptstadt der sozialistischen Weltbewegung“, also in Moskau, ging ein neuer, leuchtender roter Stern auf. Ein Messias, so schien es, der einen Sozialismus wollte mit freundlich lächelndem Gesicht. Selbstbestimmung der Völker auch und noch andere schöne Dinge. Ohne Alkohol zwar, aber vielleicht blieb das eine „nationale Besonderheit“? Wir hofften es. Zumindest glaubte das DDR-Volk, ich auch, mit ihm, dem Messias, werde Licht am Tunnelausgang erscheinen. Das wollten alle glauben, als sie „Gorbi, Gorbi“ schrien. Wie leichtgläubig sind die Völker eigentlich? Ähnlich geschrien haben bereits 2000 Jahre zuvor andere. „Hosianna“ schrien sie, nur um ihn, ihren Messias, kurze Zeit später ans Kreuz zu nageln.
Die bitteren Realitäten im Riesenland Sowjetunion nahm zunächst kaum jemand zur Kenntnis. Dass Gorbatschow lediglich, wenn auch zu spät, die realistischen Konsequenzen aus dem drohenden Zusammenbruch des eigenen Systems zog, wollte niemand sehen. Eine DDR am Tropf konnte schnell zum Mühlstein am Hals der Sowjetunion werden. Das war die Realität. Selbst sein Riesenreich konnte sich das nicht mehr leisten. Ihm selbst, dem Messias, stand das Wasser schon bis zur Halskrause. Weg mit dem Ballast, solange es noch etwas dafür gab. Nicht nur die DDR, auch Kuba, das täglich Millionen verschlang. Auch dort ging es nicht weiter, nur stundenlange Monologe des Revolutionsführers. Und dann das „sozialistische Weltsystem“, ein Verein, der immer mehr kostete als er einbrachte. Dafür schielten die Satellitenchefs ständig nach Westen, um sich auf Kosten der Brudervölker kleine Vorteile zu ergattern. Und dann waren da noch die Unruhen im eigenen Land. Und der verhängnisvolle Krieg in Afghanistan (Sowjetischer Truppenabzug 1989). Er musste amputieren, der relativ junge Genosse Generalsekretär, eins nach dem anderen, nur schnell, wenn er den Körper erhalten wollte.
„Der Starke ist am mächtigsten allein“, schrieb Schiller im Tell, glaube ich. Den musste er gelesen haben, der glücklose Messias in Moskau. Doch es nützte ihm nichts mehr. Er kam zu spät und so bestrafte ihn das Leben mit dem eigenen politischen Ende. Nein, die ursprüngliche Absicht des Reformers war es wohl nicht, das sozialistische Weltsystem aufzulösen und sicher auch nicht, der Verkauf der DDR an die Bundesrepublik Deutschland. Nur, seine Reformen kamen zwei Jahrzehnte zu spät. Inzwischen war das Fundament so marode, dass nicht mehr reformiert oder umgestaltet, sondern nur noch aufgegeben werden konnte, bis hin zur Sowjetunion selbst. Was für eine schöne steile Vorlage, sagten sich unser guter Onkel Sam in Übersee und der deutsche Einheitskanzler natürlich auch.
Kaum wurden die Bande ein wenig gelockert, kam sie plötzlich mit Macht hoch, die empfundene Entmündigung durch die SED und ihre Subalternen. Das Volk der DDR wollte frei sein, wie seine Brüder und Schwestern vom Rhein es waren. Aber was verstanden wir unter „Freiheit“? Die D-Mark und Reisen, nicht nur nach Prag und Budapest, auch durch Europa weit westlich von Spree und Pleiße wollte es fahren, das Volk. Natürlich am Steuer von Westautos und mit harter Währung in der Tasche. Na ja, und 16 Jahre warten auf einen Wartburg wollte es auch nicht mehr. Unkontrollierte Reden wollte es hören und schreiben, was und wie jeder wollte. Zumindest der intellektuelle Teil des Volkes wollte das. Und der war groß, dank eines durchgehend funktionierenden Systems von Bildung und Ausbildung in der DDR. Aber viele, sehr viele wollten einfach nur lesen. Nicht, was geschah, sondern was geschehen sein könnte, nicht trocken und langweilig wie im ND, dem „Neuen Deutschland“, sondern volksnah, wie es zum Beispiel BILD so schön konnte. Ein wahres Kuriosum der Geschichte.
Führer brauchte es nicht, das deutsche Volk im Osten. Die hatte es lange genug gehabt in seiner Geschichte. Solche und andere! Nur betrogen wurde es immer. Jetzt endlich sollte damit Schluss sein. Wir hatten ja die Brüder und Schwestern da drüben und die würden es schon richten. Davon waren die meisten irgendwann überzeugt und so wurde aus der Losung „WIR SIND DAS VOLK“
bald „WIR SIND EIN VOLK“. Von wem sie stammte war egal, selbst wenn sich jemand die Mühe gemacht hätte nachzulesen. Das ist natürlich Quatsch. Ich bitte um Entschuldigung. In der DDR konnte man es ja nicht nachlesen! Darum ging es aber nicht. Irgendwie entlarvender war dann schon eher die Losung: „KOMMT DIE D-MARK NICHT ZU UNS, GEHEN WIR ZU IHR!“ Das riefen sie, die Demonstranten, die einmal die Freiheit auf ihr Banner geschrieben hatten. Laut und fordernd, beim Marsch um den Leipziger Ring und anderswo. Das war ein wenig später. Da war auch ich dabei, trotz aller Bedenken in der Nacht. So ist das wohl. Wer im Malstrom schwimmt, schwimmt mit ihm. Ein rettendes Ufer gibt es für ihn nicht. Nein, ein Entschuldigungsversuch für mich ist das nicht! Nein! Nein! Nein! Nur die späte Erkenntnis, dass vor allem wir selbst es waren, die den Druck auf die noch Regierenden aufgebaut haben, nicht nur die Anderen.