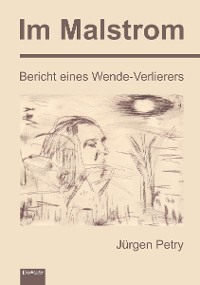Kitabı oku: «Im Malstrom», sayfa 4
VII
Ich lief weiter mit um den Leipziger Ring, schrie auch, aber nicht mehr mit Inbrunst, denn ich wusste nicht mehr, wonach ich da schrie. Eine unbestimmte Angst vor der Zukunft schnürte mir immer mehr die Luft ab. Manchmal ging ich auch ohne zu demonstrieren allein durch die Stadt, um nachzudenken, sah die verfallenden, schmutzig-grauen Fassaden, die halbleeren Geschäfte und die teils verbissenen, teils fröhlichen Gesichter. Was richtig war und was falsch, wusste ich nicht mehr. Meist ging ich nach der Demo noch in die „Bodega“. Das war eine kleine Bar in einer der Leipziger Passagen. Heute würde man sagen eine Szenekneipe. Dort konnte man ein seltsames Schauspiel beobachten, wie es vielleicht nur in Deutschland, egal ob Ost oder West, möglich war. Links standen die noch erregten Demonstranten, rechts die müde und unsicher wirkenden Polizisten. Hier standen sie friedlich, wenn auch nicht gerade vereint, an der gleichen Theke. Sah ich das, glaubte ich immer weniger, dass das alles für mich etwas bringen würde. Den Begriff „Friedliche Revolution“ gab es ja noch nicht. Der wurde erst nachträglich erfunden. Und komisch, immer wieder beruhigte ich meine Bedenken. Weil ich sie beruhigen wollte.
Das Grundgesetz für den Ausbruch einer Revolution hatten wir im Osten ja alle gelernt. Widerwillig, zugegeben, weil es mit Penetranz ständig wiedergekäut wurde. Aber einiges davon war doch bei fast jedem hängengeblieben. Heute weiß ich nicht mehr, wer es aufgeschrieben hatte, das revolutionäre Grundgesetz. Marx vielleicht oder Lenin oder gar Mao, die rote Sonne? Egal, jedenfalls einer von ihnen muss es gewesen sein! Dort hieß es, die Revolution bricht aus, wenn die da unten nicht mehr so leben wollen (das traf ja erst einmal zu) und die da oben die Herrschaft zu ihren Bedingungen nicht mehr aufrechterhalten können (auch das war so). Trotzdem fehlte etwas. Wo wollten wir hin? Was, wenn sie verflogen sein wird, die Euphorie des spontanen Aufbruchs, und die langen Mühen der Ebenen begannen? Ja, ja, „die Gedanken sind frei“!
Eine Führungsmannschaft muss sein, im kommunistischen Vokabular „Vorhut“ genannt. Das ist die, die dem Volk sagt, wo es langgeht, und es nicht losstürmen lässt wie eine durch Wolfsgeheul aufgescheuchte Schafherde. Ja, auch das ist wohl von Marx, dem übergroßen Revolutionstheoretiker. Aber ist es deshalb schon falsch? Lehrbeispiele für kopflose Revolutionen gab es doch genug, nicht nur in Deutschland. Die erste hier bei uns fand sogar auf DDR-Gebiet statt. Vor genau 464 Jahren, von 1989 an gerechnet. Am 15. Mai 1525 waren die schlecht geführten Bauernhaufen von einem gut organisierten aber kleinen Ritterheer bei Bad Frankenhausen vernichtend geschlagen worden. Und das bei zehnfacher Überzahl der Bauernhaufen. Auch das hatten wir gelernt. Das leuchtete mir damals ein. Ich hatte ja auch gelesen, dass, ungefähr 300 weitere Jahre zuvor, ein kluger Chinese, der Name ist mit leider auch entfallen, mit anderen Worten das Gleiche gesagt hatte. Es war der Berater des bereits erwähnten Mongolenherrschers Dschinghis Khan. Der hatte ihm sinngemäß empfohlen: „Du kannst den Erdkreis im Sattel erobern, aber regieren kannst du ihn vom Sattel aus nicht.“
Eine Frage beschäftigt mich bis heute. Warum war sie eigentlich so untypisch friedlich, diese Revolution? Weil wir Zehntausende waren, die jeden Montag friedlich um den Ring marschierten? Vielleicht! Aber siehe 1525. Oder weil wir laut und deutlich riefen: „KEINE GEWALT“? Vielleicht auch deshalb! Nur, fragte ich mich, haben je zuvor in der Geschichte, in der deutschen oder der anderer Völker, Herrschende ihre Macht abgegeben, nur weil Revolutionsmacher Gewaltlosigkeit für sich einforderten? Falls doch, dann muss ich in der Schule geschlafen haben. Möglich ist das schon, das mit dem Schlafen. Es soll ja vorgekommen sein. Nur, gelernt habe ich dort etwas ganz anderes. Und das habe ich nicht vergessen, weil es mich schon damals beunruhigte. Es war die glasklare Mahnung eines parteieigenen Dichters: „Seht, die Macht ist euch gegeben, dass ihr sie nie, nie mehr aus euren Händen gebt.“ Nein, das war nicht nur so dahergeschwätzt, sondern Parteidoktrin und damit die des Staates. Wer so spricht, denkt auch so, denn er will die Macht in seinen Händen behalten, egal wie, denke ich. Will man jemandem mit einer solchen Doktrin die Macht nehmen, dann braucht es Gewalt. Das ist doch deutlich genug. Trotzdem fiel kein Schuss. War es ein Wunder oder doch etwas ganz anderes?
Wunder sind allerdings selten in dieser aufgeregten Zeit! Wurde „Keine Gewalt“ möglich, weil das ganze sozialistische Fundament ins Rutschen kam? Möglich schon! Oder weil die Sowjetunion, die einst so ruhmreiche, ihrem Satelliten DDR die Unterstützung ihrer hier stationierten 50 Divisionen verweigerte? Auch das mag zutreffen. Oder weil die Volkspolizei bereits zögerlich agierte und die Armee des Volkes nicht mehr verlässlich war? Stimmt alles! Doch Gewalt wird ja nicht nur eingesetzt, wenn man sich des Sieges sicher ist und dafür wiederum gibt es genügend Beispiele in der Geschichte. Nein, ganz machtlos waren sie nicht, die Herrschenden der DDR im Herbst ’89. Da gab es ja noch die Truppe „Schild und Schwert der Partei“ und die stand ja wohl sicher zu ihren Auftraggebern!
Man hätte sie auf die Straße hetzen können, so wie es einst der israelitische König David mit seinen Krethi und Plethi, der Leibwache und dem Sicherheitsdienst, mit Erfolg getan hatte gegen eine riesige Übermacht der Aufständischen und seinen eigenen meuternden Heerscharen. Gut, David stand mit GOTT dem HERRN im Bündnis, sagt man. Krenz nicht, wie man weiß! Aber das entscheidet vielleicht über Sieg oder Niederlage, nicht aber über den Einsatz von Gewalt an sich?!
Im Kampf siegt ja keineswegs immer der, der im Recht ist. Und der mit den zahlreicheren Truppen, Gewehren und Unterstützern auch nicht. Oft aber der, der über die disziplinierteren Kämpfer verfügt. Wir haben es ja gelesen, was 1525 geschah auf dem Schlachtfeld bei Bad Frankenhausen. Doch der Sicherheitsdienst der DDR wurde nicht gegen das eigene Volk eingesetzt. Der Gedanke wurde gar nicht erwogen. Im Gegenteil, der Oberbefehlshaber aller Waffenträger des Landes, Egon Krenz, setzte sich mit allen Mitteln ein, dass kein Schuss fiel gegen uns, die Demonstranten. Warum wohl, bei einer Staatsdoktrin mit der eindeutigen Aussage: „Die Macht ist euch gegeben, dass ihr sie nie, nie mehr aus euren Händen gebt“? Ich kann es nicht beantworten, denn ich bin einfacher Elektriker und kein Historiker. Als Mensch denke ich mir aber, vielleicht war die „Friedliche Revolution“ ganz anders. Nicht nur eine von unten, sondern zugleich eine von oben, entgegen allen Lehren?
Von der genauen Höhe des DDR-Schuldenberges wusste man in Moskau erst, nachdem Egon Krenz bei seinem Antrittsbesuch in Moskau, am 31. Oktober 1989, Gorbatschow und Schewardnadse genügend reinen Wein über die wahre Lage der DDR-Wirtschaft, wie sie ihm der Saarländer hinterlassen hatte, einschenkte, schreibt Egon Bahr. Das muss dann wohl der Moment gewesen sein, der den Sowjetführern, denen selbst das Wasser schon bis zur Unterlippe stand, den Blick für die Realität frei machte. Das schreibt Bahr nicht, lässt es uns aber folgern. Besser Milliarden aus Bonn für den Verkauf der DDR, als Milliarden aus der Sowjetunion in die DDR. Das könnte man sich so gesagt haben, denn rechnen konnten sie, die Genossen im Kreml, immer schon. Nur eins leuchtet mir nicht ein, wenn es wirklich so war: Warum hat Egon Krenz dann nicht dazu in Moskau lieber geschwiegen?
Ich glaube eher, dass sie im Kreml und der Lubjanka recht gut wussten, wie es um die Bonität der DDR stand. Wozu waren denn ihre eigenen „Krethi und Plethi“ und deren zahllose deutsche Helfershelfer sonst nütze? In Moskau wusste man sehr genau, denke ich, dass sich nicht mehr viel rausholen ließ aus ihrem Satellitenstaat DDR. Nicht mit ihren, den sowjetischen Methoden! Mit denen unserer Brüder und Schwestern allerdings schon. Und zwar Milliarden, nur eben nicht auf direktem Wege. Und das war es, was man sich in Moskau sicher nicht vorstellen konnte. Und Krenz konnte es vielleicht auch nicht, wie wir alle damals. Aber was seine Moskauer Genossen über die DDR-Bonität wirklich wussten, das wusste ganz bestimmt auch er bei seinem Antrittsbesuch am 31. Oktober 1989, selbst wenn er es nicht aufschrieb in seinem Buch „Herbst ’89“. Er war jahrelang der Verantwortliche für die DDR-Sicherheitsdienste! Und die … na, lassen wir es lieber!
Vielleicht wollte er dort nur testen, woran er war? Vielleicht den Genossen in Moskau aber auch nur eine Brücke bauen, weil er ahnte, was sowieso kommen würde? Schön, das ist Politik. Also sagten sie, was sie dachten, seine Genossen Gorbatschow und Schewardnadse, damals in Moskau. Natürlich nicht ihm, ihrem treuen Verbündeten Egon Krenz, dafür aber dem guten Onkel Sam in den USA und später sogar dem Kanzler in Bonn. Auch Krenz ließen die Moskauer Freunde nicht lange im Regen stehen. Nein, nein! Nur ein paar Monate später sahen sie mit verschränkten Armen zu, dass er schnell ein dichtes Dach über den Kopf bekam, ein Gefängnisdach! So, wie sie auch beim Saarländer zusahen, der doch noch viel länger ihre Interessen vertreten hatte. Na, es wird ihm die Augen geöffnet haben, ich meine Krenz, der noch in dem bereits erwähnten Buch „Herbst ’89“ schrieb: „Die Sowjetunion ist meine zweite Heimat.“ Schöne Heimat! Wie schrieb doch dagegen ein zweifelhafter englischer Politiker? „England hat weder ewige Freunde noch ewige Feinde. Es hat nur ewige Interessen!“ Ja, auch vom Klassenfeind lernen, heißt siegen lernen!
Auch in der DDR-Führung und anderswo müssen die Zweifel an dem real existierenden Sozialismusmodel gewachsen sein. Logisch! Nicht bei allen. Nicht an allem. Aber am Dogma der Unfehlbarkeit der Partei wohl doch. Zumindest der Glaube an die These „Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen“ war tief erschüttert. In Warschau und Bukarest, Prag, Budapest und vor allem in Moskau selbst. Nicht erst 1989 begannen einige eine neue These aufzustellen: „Rette sich, wer kann“ oder „Unser Hemd ist uns näher als das Sicherheitsbedürfnis der DDR“. Was dann vor sich ging, wissen wir nicht genau. Doch Ende Dezember ’89 nahmen Washington und Bonn das Heft des Handelns in die Hand. Das sagte Egon Bahr, richtig, aber man spürte es damals auch ohne es zu wissen. Was genau ablief, wird vielleicht erst die übernächste Generation erfahren, wenn wieder einmal die Archive gelüftet werden sollten. Nur für mich, den Leiter der Brigade „Stromschnelle“, war und ist es unvorstellbar, dass ohne ein Signal aus Moskau überhaupt etwas möglich gewesen wäre.
Und nun? Das Volk der DDR stand auf der Straße. Sollten sie den „real existierenden Sozialismus“ der Welt allein verteidigen, die Herrschenden der DDR? Ohne dieses Volk? Vielleicht mit einem neuen, wie Brecht einst geraten hatte? Mit einer unsicheren Volksarmee und einer sich bereits vorsichtig umorientierenden Volkspolizei? Gestützt allein auf die Staatssicherheit? Gesetzt den Fall, der Kampf wäre gewonnen worden, ein paar tausend Tote als Kollateralschaden eingerechnet! Was dann? Die Löcher in der Mauer waren bereits groß. Und Verbündete? Wer wäre da geblieben? Albanien? Nordkorea? Kuba? China? Nein, China nicht! Die Chinesen setzen nie auf das schlechtere Pferd.
Der Sieg hat viele Väter! Daran, dass Krenz sich 1989 den Realitätssinn bewahrte, denkt heute niemand. Vielleicht hätten wir Grund, auch ihm zu danken, zumindest dafür, dass „Keine Gewalt“ möglich wurde? Das glaube ich heute und wiederhole mich! Vielleicht war ja die „Friedliche Revolution“ von 1989 eine von unten und zugleich eine von oben? Eine Theorie dafür gibt es nicht. Die Frage stellte ich mir ja auch nicht damals im Herbst 89, sondern heute kurz vor meinem Abgang ins Jenseits. Na, ich bin sicher, dass irgendwann auch das, was wirklich zu dieser „Friedlichen Revolution“ führte einmal objektiv untersucht werden wird, etwa so, wie man heute, nach 100 Jahren, vorsichtig beginnt, die wahren Ursachen für den Ausbruch des I. Weltkrieges offenzulegen. Schade, dass ich das nicht miterleben kann, denn interessieren würde es mich schon. Ich war ja ein direkt Betroffener, denn mitrevolutioniert habe ich. Das streite ich nicht ab.
Freiheit für alle und Gerechtigkeit forderten wir 1989! Lächerlich! Ja, so naiv kann man sein im Rausch der Ereignisse. Als hätte je eine Revolution Gerechtigkeit für alle gebracht und auch noch Freiheit. Stolz zitierten wir auf unseren Transparenten das Wort der Rosa Luxemburg: „Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden“. Heute auch noch? Na, dann versuchen wir es doch mal! Vielleicht zuerst in der eigenen Firma?
Gehörte sonst noch etwas dazu zur Freiheit, die wir im Herbst 1989 hätten fordern sollen? Ja! Das Recht auf Arbeit. Erst später fiel mir ein, dass ich diese Forderung auf keinem Plakat gelesen habe. Na ja, und weil es keiner gefordert hat, haben wir es eben auch nicht bekommen. So einfach ist das!
Missbraucht hat dieses Grundrecht auf Arbeit in der DDR am meisten der Saarländer selbst. Zumindest hat er indirekt die Grundlagen für den massenhaften Missbrauch geschaffen. Das war, als er zu Beginn seiner Herrschaft populistische Reformen einführte, auf deren Grundlage der Disziplinverfall in den Betrieben zu wuchern begann. Dazu zähle ich das schrittweise Untergraben der Autorität der Leiter, die Stärkung des Einflusses gesellschaftlicher Organisationen in den Betrieben oder die Arbeitsplatzbindung von Kriminellen, Asozialen und Arbeitsscheuen. Womit kann die Arbeitsmoral eigentlich schneller untergraben werden als mit einer garantierten Straflosigkeit für chronische Faulpelze? Ich weiß es nicht. Andere, die es hätten wissen müssen und ändern können, taten nichts. So fuhr das Staatsschiff DDR in aller Gemütsruhe auf den Malstrom zu und was dort geschieht, kann man nachlesen. Am besten bei Edgar Allan Poe, dem amerikanischen Schriftsteller.
VIII
Bevor ich zur Historie selbst zurückkehre, noch ein kurzer Rückblick in eigener Sache. Die Politiker an der Spitze unseres Staates kannte ich nicht. Nicht persönlich jedenfalls. Woher auch? Na schön, aus dem Fernsehen und der Zeitung, solange ich sie noch las. Doch eine Ausnahme gab es. Egon Krenz, den kannte ich. Kennen ist natürlich Quatsch. Wir waren einmal zusammengetroffen. Falls ich mich recht erinnere, haben wir sogar ein oder zwei Gläschen „Irgendwas“ getrunken. Natürlich nicht wir beide allein. Wir waren viele, darunter ich und meine Brigade „Stromschnelle“. Ein paar Worte gewechselt haben wir aber und viel gelacht, denn der Anlass war ein erfreulicher. Das reicht natürlich nicht für ein Urteil, aber immerhin hatte ich einmal mit ihm zu tun, mit Helmut Kohl nicht.
Die Begegnung fand gar nicht so lange vor der Wende im Jahre 1982 statt. Zu tun hat sie deshalb auch nichts mit ihr. Ein knappes Jahrzehnt ist das jetzt her, aber auch das ist fast schon unwichtig. Jedenfalls war der Name Krenz noch unbeschädigt durch seinen späteren Scheißjob als Wahlleiter. Auch sein Chinabesuch mit den Vorgängen auf dem Platz des Himmlischen Friedens, die er positiv kommentiert haben sollte, wie behauptet wird, lag noch in weiter Ferne.
Unsere Begegnung fand in Oberwiesenthal, im Erzgebirge statt. Die DDR hatte, warum auch immer, dort ein Jugendhotel zu bauen in Auftrag gegeben. So etwas wie eine Nobel-Jugendherberge. Man könnte auch sagen ein Sargnagel für die schon marode DDR, den der Saarländer, unbekümmert und populistisch, da und dort und eben auch hier einschlug. Kein Vergleich mit den Absteigen, die wir in der Schulzeit auf Wandertagen im Harz oder in Thüringen kennengelernt hatten. Du erinnerst dich, mein Freund, an unsere gemeinsame Rennsteigwanderung 1958 von Saalfeld nach Eisenach? Herrliche Zeit! Aber die Jugendherbergen! Egal, wir kannten ja nichts anderes! Die Hütte, die damals gerade in Oberwiesenthal errichtet wurde, war wirklich repräsentativ. Schöne Zimmer ausgerüstet mit Duschen, manche mit Bädern und einige hatten sogar kleine Kühlschränke. Minibars, lernte ich später. Unmengen an Personal im Haus und ganze sieben DDR-Mark je Übernachtung. Wohl dem Staat, der sich das leisten kann.
Doch darum geht es hier nicht. Es gab Räume zum Lesen, zum Diskutieren und anderes mehr. Sogar kegeln konnte man. Und es gab auch eine tolle Bar. Ob sie das wirklich war oder nur in meiner vielleicht noch unterentwickelten Vorstellungen davon, wie eine tolle Bar aussehen müsse, sei einmal dahin gestellt. Kurz, sie war schön. Und in dieser Bar lernte ich Egon Krenz kennen. Das kam so:
Wie in der DDR bei Repräsentationsbauten üblich, stand auch für das Jugendhotel Oberwiesenthal als erstes der Eröffnungstermin fest. Zunächst lief wohl auch alles nach Plan, dann kam das Übliche. Material wurde nicht pünktlich geliefert, Teile fehlten, Häusle- und Garagenbauer brauchten auch dieses und jenes und so weiter und so fort. Dadurch geriet die Netzwerkplanung durcheinander. Einiges musste auch umprojektiert werden, hieß es, jedenfalls schafften es die dafür geplanten Arbeitskräfte nicht mehr. Das waren wohl die wesentlichen Gründe dafür, dass ich ins Spiel kam.
Die Bauleitung wurde immer nervöser, denn der Eröffnungstermin stand ja unverrückbar fest. Schließlich griff man zum Bewährtesten der staatlichen Hilfsmittel, der sozialistischen Hilfe. Ein paar zusätzliche Gewerke wurden aus einigen Kombinaten dafür abgestellt. Darunter aus meinem Kombinat die Hälfte der Jugendelektrikerbrigade „Stromschnelle“, deren Brigadier ich war. Na ja, ganz jung waren wir nicht mehr, aber die Brigade hieß nun einmal so. Wir wurden für vier Wochen nach Oberwiesenthal delegiert. So hieß das damals.
Schließlich konnte das Jugendhotel termingerecht übergeben werden. Krenz hielt die Eröffnungsrede. Überraschend wurden alle am Bau beteiligten Helfer nach der Übergabe des Jugendhotels von ihm zu einem Probedurchlauf eingeladen. Er blieb und feierte mit uns. An seine Rede erinnere ich mich nicht, nur dass er frei sprach in einer angenehmen floskelfreien Sprache mit norddeutschem Akzent. Als die Feier dann richtig losging, kam er von Tisch zu Tisch, fragte, woher wir kämen, was wir weiter vorhätten und stieß mit uns an. Das imponierte nicht nur mir. In der Bar standen immerhin zwölf Tische. Als er sich gegen ein Uhr früh verabschiedete, sprang Heiner Kautz aus meiner Brigade auf und schrie, ohne Auftrag, dafür steht mein Ehrenwort: „Wir sind die Fans von Egon Krenz!“ Das war etwas holprig, gewiss. Doch Sekundenbruchteile später standen alle und die ganze Bar griff den Ruf auf. Ich erinnere mich, dass die Gläser auf den Tischen sprangen vom Widerhall des donnernden Gebrülls: „Wir sind die Fans von Egon Krenz!“
Das damals war ehrliche Zuneigung. Davon bin ich heute noch überzeugt. Nie zuvor und nie danach habe ich eine ähnliche spontane Sympathiedemonstration für einen SED-Funktionär erlebt. Gut, es war spät und die Getränke waren frei, trotzdem! Doch das lag ein Jahrzehnt oder mehr vor dem Tag, an dem unser damaliges „Idol“ den Sturz des Saarländers einleitete. Doch das Haus DDR war inzwischen marode und nicht mehr zu retten. Für Krenz wäre es vielleicht besser gewesen, er hätte es mit ihm, dem Saarländer, zusammenkrachen lassen. Aber wer kann schon in die Zukunft sehen. Eine echte Chance bekam er jedenfalls nicht mehr. Die Karten waren wohl bereits gemischt und verteilt. Genug von Politik und Politikern. Auch meine persönliche Uhr tickt, laut und unheilvoll.
IX
Der Frieden in unserer Familie war nach dem großen Badbenutzungskrach wieder so einigermaßen hergestellt. Vor allem weil ich vor der geballten Koalition von Ehefrau Jana, Sohn Waldemar Henry und seiner Ische Ilona dann doch zurückgewichen war. Wir hatten uns verständigt, dass die Beiden ihre morgendlichen Spielchen nicht mehr im Bad vollführten oder zumindest nicht in der Zeit, die mir von Anbeginn unserer ehelichen Gemeinschaft in dieser Wohnung für meine Morgentoilette zugestanden worden war. Dadurch bekam ich morgens auch wieder meinen Bus.
Im Gegenzug sollte ich keinen weiteren Versuch unternehmen, das mir lästige Pärchen vor die Türe zu setzen. Inzwischen wurde das gesellschaftliche Chaos in allen Lebensbereichen der unmittelbaren Vorwendezeit in der DDR flächendeckend. Davon musste auch die AWG in Mitleidenschaft gezogen worden sein, denn sie machte keine Anstalten, die unserem Waldemar Henry für 1989 fest zugesagte Wohnung bereitzustellen. Unser Pärchen störte das zunächst nicht, denn sie lebten bei uns wie in einem Hotel, in dem nichts etwas kostet. Jana hatte sich für ihren damaligen Ausbruch zwar nicht entschuldigt, mir aber durch ihr Verhalten hier und da zu verstehen gegeben, dass sie mir meinen angeblichen Ausraster nicht weiter nachtrug.
Trotzdem war mein Leben anders geworden. Nicht nur weil irgendetwas Fremdes zwischen uns getreten war. In unserem Betrieb fanden beinahe täglich irgendwelche Versammlungen statt, in denen hitzig darüber debattiert wurde, wie alles besser, vor allem aber anders werden könne. Daran nahm ich häufig teil, fast immer als Zuhörer. Ich wollte wissen, wohin das alles läuft. Und ehrlich gesagt wich ich damit möglichen weiteren Konflikten in der Familie auch noch aus.
Anfangs führten das Wort in den Betriebsversammlungen noch überwiegend bekannte Mitarbeiter, Frauen wie Männer meist unterhalb der Führungsetagen, denen es um wirkliche Verbesserungen im Kombinat ging und die Fragen und Lösungsvorschläge wurden überwiegend ruhig und meistens auch sachlich vorgetragen. Nur diskutiert wurde darüber immer hitziger. Nach und nach drängten aber immer undurchsichtigere Typen vor. Ihre Forderungen wurden radikaler und der Ton anmaßend. Misstrauensanträge gegen Leiter waren an der Tagesordnung. Mal mit Erfolg, meistens zwar ohne, aber davon irritiert schmissen Führungskräfte hin, setzten sich in den Westen ab oder wurden direkt abgeworben. Das gab es auch. Manchmal war ich vom Verlauf einer Versammlung richtig angetan, manchmal schnürte mir die Angst vor der Zukunft die Luft ab. Vor allem, wenn ich sah, wie ungeniert Vertreter von westlichen Konkurrenten begannen, sich in unserer Firma zu bewegen. Gehindert wurden sie von niemandem daran. Das, was heute mit Industriebrachen bezeichnet wird, bereitete sich schleichend vor. Ich hatte bereits die Übersicht über Ziel und Richtung unserer Bewegung verloren, nahm aber trotzdem weiter an den Debatten teil. Wahrscheinlich auch, wie gesagt, weil ich Auseinandersetzungen in meiner Familie ausweichen wollte. Genau weiß ich es aber nicht mehr. Es war am Sonntag, dem dritten Advent. Wir saßen beim Frühstück. Ich bemühte mich, dem Pärchen ein freundliches Gesicht zu zeigen und beteiligte mich zunächst locker an den belanglosen Gesprächen. Plötzlich sagte meine Jana: „Du, die Kinder möchten nach dem Westen. Sie wollen sich ihr Begrüßungsgeld abholen.“ Seit durch den Auftritt des zwielichtigen Schabowskis eher zufällig als geplant die Grenze geöffnet worden war, strömten täglich Tausende in den Westen. Schamlos flogen sie mit Kind und Kegel bei Verwandten oder Bekannten ein, um sie mit ihrer Anwesenheit zu erfreuen. Vor allem aber wollten sie sich ihr Begrüßungsgeld abholen, das ihnen, wie sie meinten, zustand. Jana und ich hatten einmal darüber gesprochen und waren uns einig: Wir nicht! Wir lassen uns nicht bestechen! Nicht von denen da im Westen. Und schon gar nicht wollten wir unseren Brüdern und Schwestern das Schauspiel bieten, uns wie arme Verwandte stundenlang in Warteschlangen nach jämmerlichen 100 D-Mark Begrüßungsgeld anzustellen. Wer wollte, sollte das tun, wir aber nicht. Der Westen lief uns nicht davon und mit je 100 D-Mark wäre ohnehin hier kein Problem gelöst. Wie gesagt, darüber waren wir uns einig. Deshalb sah ich sie erstaunt an und merkte sofort, wie verlegen sie wurde. Ich sah auch, dass sie am Halsausschnitt rote Flecken bekam. Das geschah immer, wenn ihr etwas peinlich war oder sie sich aufregte.
Deshalb sagte ich ruhig: „Wenn die jungen Herrschaften sich das Begrüßungsgeld holen wollen, dann bitte sehr, warum nicht?“ Das sagte ich so gelassen wie ich konnte. „Habt ihr schon einmal …“, wollte ich fortfahren, doch da fiel mir unsere angehende Schwiegertochter ins Wort. „Und ihr, wollt ihr es verfallen lassen und denen schenken? Das sind 100 D-Mark für jeden, keine Alu-Chips, richtiges Westgeld. Außerdem haben die hier genug rausgeschleppt mit ihrem Schwindelkurs. Das ist das Mindeste, was uns zusteht.“
Eigentlich wollte ich ja etwas Grundsätzliches sagen, überlegte nur noch, wie und was, da fiel mir wieder einmal Waldemar Henry in den Rücken. „Hör zu, mein Alter. Jetzt überwinde mal den eingebildeten Stolz deiner Arbeiterklasse. Außer dir hat den nämlich niemand. Die fahren alle hin und holen ihre Kohle, ich kenne jedenfalls niemand, der noch nichts geholt hat oder holen will. Manche haben es sogar zweimal gemacht. Einmal im Norden und einmal in Bayern und auch das hat geklappt. Natürlich nur, wenn sie einmal bis Bayern gefahren sind. Glaubst du vielleicht, dass die da drüben eine Strichliste vorliegen haben und plötzlich bemerken, aha, der Paschke Heini aus Wolfen Nord, der hat sein Begrüßungsgeld nicht geholt. Was für ein stolzer Mensch, dieser Heinrich!?“ Er nickte mir spöttisch zu und sagte dann noch richtig höhnisch: „Nichts änderst du, gar nichts, wenn du es dir nicht holst und alle anderen tun es!“
Am liebsten hätte ich ihm in meiner aufsteigenden Wut ein paar gescheuert! Direkt in seine grinsende Larve. Doch eingedenk des Kräfteverhältnisses in meiner Familie und der versprochenen Friedenspflicht hielt ich mich gerade noch zurück. Darüber vergaß ich allerdings, dass ich eigentlich sagen wollte, dass das etwas mit menschlicher Würde zu tun hat, von der die beiden wohl noch nie etwas gehört hätten. Stattdessen sagte ich nur: „Fahrt doch!“ Mein anschließendes mehrfaches tiefes Durchatmen zeigte meiner geliebten Jana wohl an, dass es Zeit zum Eingreifen war, wenn sie verhindern wollte, dass gleich ein riesiger Krach losgetreten würde. Zunächst gab sie sich neutral und sagte zu unserem Sohn: „Kein Grund zum Höhnen, lieber Henry. Dein Vater und ich haben beschlossen, das Geld nicht anzunehmen. Dein Vater meint, dass wir uns vor denen da drüben nicht so demütigen lassen dürften. Das solltet ihr respektieren. Wir, er“, sie nickte mit dem Kopf in meine Richtung, „und ich, sind uns da einig. Fahrt doch einfach allein.“
Waldemar Henry verstand offenbar den Wink und lenkte ein. „Entschuldige bitte, Papa, ich wollte dich nicht kränken. Ilona und ich haben nur gedacht, wenn wir es nicht holen, freuen die da drüben sich nur. Und wir haben nichts davon. Ilona hat es doch schon gesagt. Die da haben jahrelang auf unsere Kosten gelebt, wenn sie hier ihr Geld eins zu fünf umgetauscht haben. Dabei war hier auch so schon alles viel billiger. Erinnere dich nur, Papa, wie du dich erregt hast, als wir einmal in Prag waren. Ich weiß es wie heute. Da saß eine Herde Halbwüchsiger aus dem Westen auf der Terrasse des Hotels Jalta. Wir hätten uns dort mit unserem Tages-Umtausch-Satz nie sehen lassen dürfen. Und die hingen bereits zehn Uhr lallend herum! Rings um sich leere Sektflaschen und von außen die empörten Blicke der Tschechen. Denkst du, dass sich auch nur einer von denen dafür geschämt hat? Nee, geschämt haben wir uns. Die haben sich gedacht, sie schädigen die Kommunisten, wenn sie überhaupt gedacht haben.“ Ich lachte ironisch, denn beide glaubten, mich mit dem Argument „Die haben doch …“ umstimmen zu können.
Jana wusste es. Dennoch war sie es, die das Anliegen auf den Punkt brachte. „Hör mal, Heinrich, die Kinder meinen es doch nur gut mit uns. Wir haben ein Auto, sie nicht. Komm, gib dir einen Ruck, lass uns zusammen mit dem Wartburg einen schönen Tag machen. Die beiden jungen Leute holen sich ihr Begrüßungsgeld und wir sehen uns inzwischen irgendeine Stadt an. Hamburg vielleicht oder, falls du lieber nach Bayern möchtest, dann eben Nürnberg oder München.“ Darum also ging es. Sie wollten auch noch das Fahrgeld sparen. Ich sollte sie kutschieren. Nach Hamburg oder nach München! Das waren ungefähr 1000 Kilometer hin und zurück. Dazu brauchte ich drei Kanistern Benzin im Kofferraum. Bezahlen wollten sie mir den Westsprit sicher nicht von ihrem Umtauschgeld. Drei Kanister, das wäre dann eine fahrende Bombe, die beim kleinsten Unfall explodieren konnte. Ich war so wütend über die Zumutung, dass ich für einen Moment dachte, gib ihnen für dieses Selbstmordkommando doch dein Auto. Vielleicht klappt es! Wütend wollte ich beiden etwas entgegenschleudern, doch dann siegten die Scham und die Vernunft. Das sind deine Kinder, du dämlicher Heini, zumindest dieser Waldemar, sagte ich mir und meine Wut war verflogen. Ich wusste plötzlich, dass ich kapitulieren würde, auch ohne weitere Diskussionen. Ich hörte kaum noch zu, als Ische Ilona mit zuckersüßer Stimme nachlegte: „Wir verstehen dich ja, lieber Heinrich!“ Sie lächelte in meine Richtung. Ich sah nur noch irritiert in die Runde, denn ich hatte ihr weder das Du angeboten noch ihr gestattet, mich mit dem Vornamen anzureden. Bisher hatte sie es auch noch nie getan.
„Machen wir es doch einfach so, wie es Jana vorgeschlagen hat. Ihr seht euch die Stadt an und wir holen uns unser Begrüßungsgeld. Es muss ja nicht gleich München sein. Hof genügt und da musst du keine Kanister mitnehmen. Und wenn ihr euch geniert, dann gebt ihr uns einfach eure Ausweise und wir versuchen es euch mitzubringen. Vielleicht geht auch das. Ist das ein Vorschlag?“ – „Nein!“ Ich wunderte mich, wie ruhig ich meinen letzten Widerstand aufbaute. „Begreift ihr denn nicht, dass sie uns kaufen? Wie können wir je mit ihnen auf Augenhöhe bleiben, wenn wir zuvor nach zugeworfenen Brocken geschnappt haben wie hungrige Hunde? Die werfen uns Sand in die Augen und keiner will es merken!“