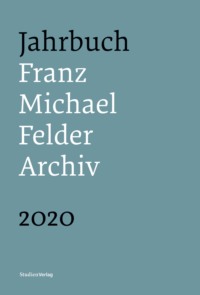Kitabı oku: «Jahrbuch Franz-Michael-Felder-Archiv 2020», sayfa 6
17 Dafür gibt es aus Claire Golls Nachlass Beispiele: Sie hat wohl nur solche Briefe Celans aufbewahrt, die sie für ihre Argumentation nutzen konnte (Wiedemann, Goll-Affäre (Anm. 2), S. 154f.).
18 Claire Goll an Richard Exner, 6.4.1955 und 18.6.1956 (nur Felder-Archiv: jeweils Handschrift, Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 13 und 17). Nicht bekannt ist außerdem das in Anm. 53 beschriebene, teilweise handschriftliche Dokument.
19 Claire Goll an Richard Exner, 17.6.1956 (nur Felder-Archiv: Typoskript, Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 17).
20 Richard Exner an Paul Celan, 11.3.1961 (Wiedemann, Goll-Affäre (Anm. 2), S. 493; Typoskript, Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 02); Richard Exner an Fritz Martini, 10.4.1961 (Typoskript, Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 10).
21 Richard Exner: Yvan Goll – zu seiner deutschen Lyrik. In: German Life & Letters (1954/55), S. 252 – 259, hier S. 252. Es gibt aus der Zeit auch Äußerungen des jungen Germanisten, die noch etwas deutlicher, als die dann in der britischen Zeitschrift gedruckten, seine Willfährigkeit gegenüber der Witwe Yvan Golls zeigen und an die er sich später kaum erinnerte und erinnern wollte: Er werde, wenn sie das wünsche, Celan stärker als Imitator herausstreichen (Richard Exner an Claire Goll, 1953 oder 1954, nur DLA: Handschrift A : Goll 78.12138).
22 Richard Exner: La poésie allemande d'Yvan Goll. In: Poètes d'aujourd'hui – Yvan Goll. Paris: Seghers 1956, S. 65 – 79, hier S. 79.
23 Ivan Goll: Abendgesang (Neila). Letzte Gedichte. Aus dem Nachlaß herausgegeben von Claire Goll. Mit drei Zeichnungen von Willi Baumeister und einem Nachwort von Hans Bender. Heidelberg: Wolfgang Rothe 1954.
24 Francis Carmody an Richard Exner, 21.3.1955 (nur Felder-Archiv, Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 22), das Jahr erschlossen aus einer Bemerkung zur Abreise Claire Golls nach Frankreich, in Verbindung mit dem in Anm. 13 genannten Brief. Claire Golls Überschreibungen von nicht zu ihren Vorwürfen passenden Daten lassen sich am Marbacher Nachlass tatsächlich nachweisen, siehe die Abbildungen 7 – 9 in: Wiedemann, Goll-Affäre (Anm. 2).
25 Francis Carmody: The Poetry of Yvan Goll. A Biographical Study. Paris: Cractères 1956, S. 160, die Datenliste S. 204.
26 Claire Goll an Richard Exner, 5.4.1955 u. 18.6.1956 (Typoskript, Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 17 und 18).
27 Claire Goll an Richard Exner, 9.2.1955 (Typoskript, Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 19; Durchschlag im DLA).
28 Claire Goll an Richard Exner, 3.5.1961 (Wiedemann, Goll-Affäre (Anm. 2), S. 581f.; zum Exemplar im Felder-Archiv siehe Anm. 15).
29 Francis Carmody warf Claire Goll im April 1955 Fälschung vor, weil von ihm wahrgenommene Abweichungen nicht auf Tippfehler zurückgehen könnten; sie wies den Vorwurf am 23.4.1955 mit der Begründung zurück, sie hole sich von einer Büste Yvan Golls immer die Genehmigung dafür (Wiedemann, Goll-Affäre (Anm. 2), S. 712f.).
30 Siehe Wiedemann, Goll-Affäre (Anm. 2), S. 493 (Durchschlag, Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 02).
31 Ebd., S. 628 (Durchschlag, Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 07).
32 Ebd., S. 586 (Durchschlag, Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 12, dort der einzige Brief von Exner an Claire Goll).
33 Richard Exner an Fritz Martini, 10.4.1961 (nur Felder-Archiv, Durchschlag: Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 10).
34 Fritz Martini an Richard Exner, 24.2.1961 (nur Felder-Archiv, Typoskript: Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 09).
35 Siehe Anm. 15. Der Rundbrief (Anm. 4) ist in dieser Fassung aus dem Celan-Nachlass (DLA) bekannt.
36 Claire Goll: Unbekanntes über Paul Celan. In: Baubudenpoet, 1960, 5 (April/Mai), S. 115f., zur Zuordnung zu dem bisher nicht bekannten Brief Martinis siehe Anm. 15.
37 Richard Exner an Rudolf Hirsch, 26.8.1960 (Wiedemann, Goll-Affäre (Anm. 2), S. 627; Durchschlag.
Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 07).
38 Richard Exner an Rudolf Hirsch, 27.12.1960 (Durchschlag, Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 07, weiterer Durchschlag im DLA).
39 Marie Luise Kaschnitz, Ingeborg Bachmann und Klaus Demus: Entgegnung. In: Die neue Rundschau, 71 (1960), 3, S. 547 – 549. Der Text wurde von Celan zusammen mit Demus erarbeitet.
40 Fritz Martini an Richard Exner, 5.1.1961 (nur Felder-Archiv, Typoskript: Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 09).
41 Fritz Martini an Richard Exner, 31.1.1961 (nur Felder-Archiv, Typoskript: Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 09).
42 Wiedemann, Goll-Affäre (Anm. 2), S. 588 (Durchschlag, Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 12).
43 Rainer Kabel (als Rainer K. Abel): Jeder ist Orpheus. Yvan Goll und die Befreiung aus dem Hades des Alltags. In: Christ und Welt, 27.10.1960. Ders.: Umstrittener Ausflug in die Vergangenheit: Anleihe oder Anlehnung? Zur Kontroverse um Yvan Goll und Paul Celan. In: Die Welt, 11.11.1960. Dietrich Schaefer: Was zum Fall Celan zu sagen ist. In: Die Welt, 16.12.1960.
44 Der Artikel aus dem nur in einem kleinen Kreis verbreiteten Blatt (siehe Anm. 36) wurde am 24.5.1960, ebenfalls unter dem Titel Unbekanntes über Paul Celan, weitgehend vollständig von den überregional verbreiteten Bremer Nachrichten nachgedruckt.
45 Wann Celan die Briefe Exners an Hirsch vom 26.8.1960 (siehe Anm. 31) und vom 27.12.1960 (Durchschlag, Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 07), zur Einsicht von Hirsch erhalten hat, ist nicht bekannt; vom ersten gibt es eine Teilabschrift, vom andern eine Kopie im Celan-Nachlass (DLA). Schon am 29.7.1960 bekam Celan Exners Brief an Hirsch vom 24.7.1960 (nicht im Felder-Archiv; Paul Celan, Rudolf Hirsch: Briefwechsel. Hg. v. Joachim Seng. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2004, S. 131 – 135).
46 Döhl an Richard Exner, 13.5.1961 (nur Felder-Archiv, Typoskript: Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 05).
47 Döhl, Geschichte und Kritik (Anm. 6), S. 106 u. 108.
48 Fritz Martini an Paul Celan, 15.2.1961 (Wiedemann, Goll-Affäre (Anm. 2), S. 519f.).
49 Fritz Martini an Richard Exner, 31.1.1961 (nur Felder-Archiv, Typoskript: Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 09).
50 Fritz Martini an Richard Exner, 24.2.1961 (nur Felder-Archiv, Typoskript: Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 09).
51 In einfachen Anführungszeichen setze ich ‚Jude‘ oder ‚jüdisch‘ dann, wenn der Begriff im Sinne der Rassegesetze von 1935 gemeint ist; Glaubensfragen, aber auch das Selbstverständnis der betroffenen Personen haben damit nichts zu tun.
52 Wiedemann, Goll-Affäre (Anm. 2), S. 188f.
53 In dieser Form nur im Felder-Archiv: handschriftlich ergänztes Typoskript, Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 20; die Publikation in Konturen kam nicht zustande. Der Entwurf, ein handschriftlich korrigiertes Typoskript, befindet sich im DLA (A : Goll 78.11276); erst durch das Bregenzer Exemplar lässt sich das Dokument eindeutig als Text über Exner identifizieren.
54 Claire Goll, Unbekanntes (Anm. 36) S. 115.
55 Rudolf Hirsch an Richard Exner, 15.8.1960 (Anm. 14).
56 Die Unachtsamkeit gegenüber Celan von Seiten Martinis geht so weit, dass er in einem Brief an Exner von „der Affäre Goll-Zelan“ spricht (5.1.1961, siehe Anm. 40).
57 Siehe den Kommentar zu Celans Brief an Rudolf Hirsch vom 3.5.1960, Celan-Hirsch, Briefwechsel (Anm. 45), S. 278.
58 Angedeutet wird dadurch auch eine mögliche erotische Komponente im Verhältnis der beiden; Claire Goll, die zur angeblichen Tatzeit (1950) 59 oder 60 Jahre alt war, nimmt derartige Andeutungen nach Celans Tod in der französischen Fassung ihrer Autobiographie La poursuite du vent (Paris: Olivier Orban 1976, S. 274) gerne auf und macht eine veritable Vergewaltigungsgeschichte daraus. So schon Claire Goll: Ivan Golls Witwe – So war es. In: Westermanns Monatshefte, (1975) 4, S. 76 – 80, hier S. 76.
59 Rudolf Hirsch an Richard Exner, 15.8.1961 (Typoskript, Nachlass Robert Warnebold, Franz-Michael-Felder-Archiv, N 46/2 : Exner : 06).
CLAUDIO BECHTER
Zwischen Tradition und Moderne.
Die Lyrik Paula Ludwigs in Kunst- und Literaturzeitschriften ihrer Zeit
Die auf Schloss Amberg in Feldkirch geborene Schriftstellerin und Malerin Paula Ludwig (1900 – 1974), deren umfangreicher Nachlass sich im Franz-Michael-Felder-Archiv befindet, galt während der Zwischenkriegszeit als bedeutende lyrische Stimme innerhalb des deutschsprachigen literarischen Feldes. Bis zu ihrem neunten Lebensjahr lebte Paula Ludwig auf Schloss Amberg, welches zu dieser Zeit mehr einer Ruine glich als einem wirklichen Schloss. Nach der Trennung der Eltern ging sie mit ihrer Mutter nach Linz. Aufgrund des frühen und für Paula Ludwig schmerzlichen Todes der Mutter führte ihr Weg 1914 zurück zu ihrem Vater nach Breslau. Nach der Geburt ihres unehelichen Sohnes 1917 verbrachte sie mehrere Jahre in München, 1923 übersiedelte sie nach Berlin. Stets in Künstlerkreisen lebend, immer von irgendwem unterstützt, schaffte sie dort den Aufstieg zur anerkannten Dichterin. Ob ihrer ablehnenden Haltung gegenüber dem NS-Regime kam Paula Ludwig 1933 zurück nach Österreich (Ehrwald in Tirol). Am Tag nach dem Einmarsch der deutschen Truppen verließ sie jedoch Österreich und emigrierte 1940 über Frankreich, Spanien und Portugal nach Brasilien. Erst 1953 kehrte Ludwig nach Deutschland zurück. Ihr literarischer Neuanfang gestaltete sich jedoch äußerst schwierig und blieb im Grunde bis heute erfolglos. Scheinbar niemand wollte mehr etwas von ihr wissen. Nichts von ihrem Leben, nichts von ihrer Dichtung, nichts von ihrer Malerei. 1956 zog sie – finanziell und gesundheitlich stark angeschlagen – zu ihrem Sohn nach Wetzlar, 1970 nach Darmstadt, wo sie schließlich 1974 verstarb.1
Schon während ihrer Zeit in München knüpfte Paula Ludwig vielzählige Kontakte zu wichtigen Vertretern und Vertreterinnen der damaligen Literaturszene: u. a. Erika und Klaus Mann, Else Lasker-Schüler, Joachim Ringelnatz, Hermann Kasack, dem Biene-Maja-Schöpfer Waldemar Bonsels oder Yvan Goll, mit welchem sie in weiterer Folge eine intensive Arbeits- wie Liebesbeziehung pflegte. Ludwig gelang es in dieser Zeit ein künstlerisch-literarisches Netzwerk aufzubauen, das es ihr ermöglichte zwischen 1920 und 1939 in den teils wichtigsten publizistischen Organen der Zeit ihre Gedichte zu veröffentlichen:2 unter anderem im Ararat (1918/20 – 1921), im Kunstblatt (1917 – 1933), in den Neuen Blättern für Kunst und Dichtung (1918/19 – 1920/21), in der Berliner Romantik (1918 – 1919), in der Neuen Rundschau (1904 – 1945), dann verstärkt in der Kolonne (1929 – 1932) und im Gedicht. Blätter für die Dichtung (1934 – 1949).
1. Zur Bedeutung von Periodika im Literaturbetrieb der Zwischenkriegszeit
Paula Ludwig trat damit in einer Zeit an die literarische Öffentlichkeit, die geprägt war von Brüchen, Verwerfungen und Diskontinuitäten. So bildeten die Zwischenkriegsjahre, weniger noch als andere Perioden, keine homogene literarische Epoche. Die historische Entwicklung mit ihren tiefgreifenden Katastrophen, den wissenschaftlichen wie gesellschaftlichen Veränderungen und den damit verbundenen ideologischen Auseinandersetzungen fanden ihren Niederschlag in der Literaturgeschichte. Nicht Kontinuität und Linearität charakterisierten die Zeit, sondern vielmehr eine Pluralität der Absichten, die Gleichzeitigkeit von Vergangenem und Gegenwärtigem, ein Neben- und Gegeneinander unterschiedlicher Strömungen zwischen Tradition und Innovation. Hinzu kamen die sich rasant entwickelnden Massenmedien wie Fernsehen, Rundfunk und Presse, die der Literatur nicht nur neue Möglichkeiten eröffneten, sondern auch starken Einfluss auf die Produktion und Rezeption hatten.3 Insbesondere die bereits im 19. Jahrhundert entstandene Presse entfaltete am Übergang zum 20. Jahrhundert ihr ganzes Potenzial. So verlieh der Streit um unterschiedliche Geisteshaltungen während der Zwischenkriegszeit der periodischen Form des Publizierens als Medium der Meinungsäußerung eine zentrale Rolle und stand damit deutlich „im Spannungsfeld der politisierten Geistesgeschichte“4. Viele Kunstund Literaturzeitschriften wurden – mit teils unterschiedlichem Erfolg – gegründet und fungierten als Sprachrohr zur Kundgabe der unterschiedlichen geistig-kulturellen Bestrebungen.5 Dementsprechend hatte die periodische Publikationsform wesentlichen Anteil an zeitgenössischen Diskursen sowie an der Genese literarischer Strömungen und Traditionen.6 So lebten literarische Texte vielfach von ihrem Publikationskontext, von welchem sie sich Themen, Schreibweisen sowie die Leseradressierung, die dem Medium innewohnten, zu eigen machten.7 Literatur schien an der Jahrhundertwende bereits derart stark an das Medium Zeitschrift gebunden, dass die Mechanismen der literarischen Produktion, Distribution und Rezeption zuweilen deutlich der medienspezifischen Ordnung der Zeitschrift unterworfen waren. Code, Produktions- und Programmlogik sowie Funktion der Zeitschrift bestimmten ästhetische Verfahrensweisen in gleicher Weise wie die Werk- und Autorenkonzeption.8
Insbesondere die „elastische Form“9 des Publizierens bildete die Dynamik und Pluralität des Literaturbetriebs der Zwischenkriegsjahre ab. Journale, Zeitungen und Literaturzeitschriften waren somit meist zentrale Schnittstellen und Schaltzentralen für die soziale Produktion wie Diskussion zeitgenössischer Wissensbestände.10 Periodika verwiesen aufgrund ihrer Vielbezüglichkeit im Spannungsfeld zwischen literarischen und nicht-literarischen Werken, Fakten und Infotainment, literatursoziologischen Markt- und medialen Publikationsbedingungen in der Regel über Problemfragen der Politik-, Sozial- sowie Ideengeschichte hinaus und stellten Fragen nach dem Markt, der Literatur und Kultur sowie der Wissenschaft kritisch zur Disposition.11 Literaturzeitschriften hatten dementsprechend eine „gesellschaftsbildende, ja gemeinschaftsfördernde Kraft“.12 Sie brachten Zeitgenossen in Gesellschaft und markieren damit einen Kontext, der wesentliche Auskünfte darüber gibt, wie eine Autorin und deren Werk im literarischen Feld ihrer Zeit eingebettet waren.13
Da Paula Ludwig nur ein sehr schmales eigenständiges Werk hinterließ, gleichzeitig jedoch wie erwähnt in den teils bedeutendsten Periodika ihrer Zeit ihre Gedichte veröffentlichte, rückt der mediale Kontext „Literaturzeitschrift“ als analyserelevante Kategorie unweigerlich in den Fokus, unterzieht man das lyrische Schaffen Ludwigs einer eingehenden Überprüfung wie literaturhistorischen Einordnung. Das Untersuchungsziel des vorliegenden Beitrags ist es daher, anhand des medialen Kontextes, in den Ludwigs Gedichte gestellt wurden, offenzulegen, an welche lyrischen Diskurse sie mit ihren ästhetischen Verfahrensweisen Anschluss findet. Die Analyse von Ludwigs Lyrik im spezifischen Kontext „Kunst- und Literaturzeitschriften“ wird dabei im Rahmen von drei hermeneutischen Arbeitsschritten abgebildet: So gilt es, neben der Darstellung der semiotischen Oberfläche der einzelnen Zeitschriften – also ihre jeweilige Programmatik sowie kulturelle Stellung ihrer Herausgeber und Mitarbeiter – exemplarische Gedichte Paula Ludwigs vor allem hinsichtlich Thematik und Bildlichkeit zu interpretieren und anhand einer vergleichenden Analyse des paratextuellen Umfeldes, in das ihre Gedichte innerhalb der jeweiligen Zeitschrift eingebunden sind, zu kontextualisieren. Dadurch soll letztlich die Bedeutung ihrer Lyrik im Hinblick auf eine etwaige produktive Rezeption literarischer Traditionen oder lyrischer Innovationen aufgezeigt werden.14
2. Paula Ludwig im publizistischen Spannungsfeld der 1920er Jahre
Von 1917 bis 1923 lebte Paula Ludwig mit ihrem Sohn Friedel in München. Sie war von Breslau nach München gezogen, um endlich eine ernsthafte Karriere als Schauspielerin und Dichterin anzustreben. Doch die Münchner Jahre waren von großer Armut geprägt. Ludwig lebte zunächst mit ihrem Sohn in einem Mütterheim der Rotkreuzschwestern. Um ihren Unterhalt zu bestreiten, arbeitete sie als Malermodell, Souffleuse sowie Statistin bei den Münchner Kammerspielen. Im Zuge ihrer Modellarbeit machte Paula Ludwig Bekanntschaft mit der aus Prag stammenden Malerin und Graphikerin Grete Weisgerber, der Witwe des Mitbegründers und Präsidenten der 1913 entstandenen Neuen Münchner Secession Albert Weisgerber.15
Bei Grete Weisgerber erhielt Paula Ludwig eine Anstellung als Haushaltshilfe – ein glücklicher Zufall wie sich herausstellen sollte; denn Grete Weisberger war in München eine Person des öffentlichen Lebens. Bei ihr gingen Dichter, Maler und sonstige Kunst- und Kulturschaffende ein und aus. Auf abendlichen Veranstaltungen im Hause Weisgerber wurden Gedichte vorgetragen, auch jene von Paula Ludwig, die sich so erstmals ein Publikum und eine gewisse Bekanntheit als Dichterin verschafften konnte. Es entstand der Kontakt zum Juristen Wolf Przygode, der Paula Ludwig schließlich zu ihrem literarischen Debüt verhalf. So wurde über Przygode, der offensichtlich von Grete Weisgerber Gedichte von Paula Ludwig erhalten haben muss, der Kontakt zu Dr. Albert Mundt hergestellt, dem Inhaber des Roland Verlags, bei welchem Ende 1919 (Impressum 1920) Ludwigs erster Gedichtband Die selige Spur erschien. So erinnert sich Paula Ludwig in ihrem Tagebuch: „Dr. Pryzgode war es der diese Skizzen zufällig zu sehen bekam und mich kennen lernte und meinte, es müsse so bleiben.“16 Für das Vorwort des Gedichtbandes verantwortlich zeichnete Paula Ludwigs Förderer Hermann Kasack, welcher bereits zu seinen Studienzeiten in Berlin mit Wolf Przygode befreundet war.17
2.1 Paula Ludwig und der Spätexpressionismus
Infolge ihrer ersten Buchveröffentlichung erschienen Ludwigs Gedichte in bekannten spätexpressionistischen Zeitschriften der 1920er Jahre. Aufgrund der fehlenden Korrespondenzen zu den Publikationen im Nachlass Paula Ludwigs ist davon auszugehen, dass die Kontakte insbesondere über ihre fruchtbare Beziehung zu Kasack, der selbst einer expressionistischen Tradition entsprang,18 entstanden. So erschienen im Februar 1920 in der Zeitschrift Neue Blätter für Kunst und Dichtung die beiden Gedichte An eine Tote sowie Sommer, im November 1921 in der Zeitschrift Der Ararat die Gedichte Abend, Abendwanderung, Es ist dein Tod und Weh nicht so sehr, Wind!; dann 1925 im Juni-Heft des Kunstblattes die Gedichte Ich bin eine Wölfin, Ich liebe dich im Angesicht sowie Aller Wesen Sommer – alles Periodika, welche für eine „Ausmerzung rückständiger Kunstauffassungen“19 einstanden und sich als Fortsetzung nicht nur der literarischen, sondern auch der künstlerischen Aufbrüche im Zuge des Expressionismus verstanden. So wurden diese Zeitschriften allesamt unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gegründet und traten für eine gewisse Erneuerung der expressionistischen Kunstbewegung ein.20
Sie setzten sich als Blätter moderner21 Ausrichtung insbesondere für die unpolemische Vermittlung neuer Kunst ein. Neben literarischen Originalbeiträgen sowie theoretischen Arbeiten zu literarisch-künstlerischen Themen widmeten sich die Zeitschriften allesamt auch verstärkt der bildenden Kunst.22 Insbesondere Der Ararat des Kunsthändlers Hans Goltz stellte sich verstärkt in den Dienst der schönen Künste, obgleich auch Goltz der Literatur in seinem Blatt immer wieder Aufmerksamkeit schenkte.23 Das zentrale Anliegen des Herausgebers und Verlegers Goltz bestand vor allem darin, im Sinne des Literaturnobelpreisträgers Romain Rolland Brücken zwischen den europäischen Völkern zu schlagen und die alten „politisch-nationale[n] Egoismen“24 abzulegen. Kunst und Kultur sollte als völkerverbindendes Element freigelegt werden, um nach den Wirren des Krieges eine „neue[] Gemeinschaft der Menschen“25 entstehen zu lassen. Gerade diese Ausrichtung an der expressionistischen Bewegung ist der Malerin Ludwig entgegengekommen. So widmete Der Ararat im November 1921 im elften Heft des zweiten Jahrganges Ludwig einen kleinen Schwerpunkt mit drei Gedichten und dem Abdruck von drei Aquarellen.
Als besonders hochstehendes Organ, welches sich nur dem Qualitätsvollsten widmete, galt jedoch Das Kunstblatt. In John Willetts Kulturgeschichte der Weimarer Republik26 wird Das Kunstblatt gar wohlwollend als „gesellschaftsbewussteste[s] aller ernstzunehmenden Kunstmagazine Europas“27 bezeichnet. Das Blatt bemühte sich vor allem um ein liberales, internationalistisches, pluralistisches wie modernistisches Image und stellte „die modisch-avantgardistische Novität über alles“.28 So verschloss sich die Zeitschrift beispielsweise zu keinem Zeitpunkt neuen Medien wie Film oder Photographie.29
Doch auch der lyrische Kontext in den Neuen Blättern für Kunst und Dichtung und im Kunstblatt ist geprägt von der thematischen wie motivischen Wiederaufnahme expressionistischer Lyrik wie der Klage des lyrischen Ichs über die Vergänglichkeit des Lebens, der Darstellung der Todes- und Leiderfahrung des Menschen sowie jener von Transzendenzverlust und Liebesentzug – deutlich abzulesen an Paula Ludwigs Gedicht An eine Tote, ein Gedicht aus ihrem ersten und nahezu zeitgleich erschienenen Band Die selige Spur von 1919.30
Es muß leicht sein
Da, wo deine Augen hingegangen sind.
Aber schwer liegen die Kränze,
Und trübe Spuren zermahlen die Wege.
Wie der Schnee fiel
Und sich jäh schloß über deinem Lachen,
Also sank das Unbegreifliche.
Nun wandle ich immer in deiner bangen Umarmung,
Und möchte, du kämest einmal im Traume
Und würdest lächeln.
Laß deinen unendlichen Hauch
Kreisen um meine Sinne,
Und gehe nicht fort mit deinen innigen Füßen.
Menschen kommen und legen
Zärtliche Hände auf meinen Scheitel, Aber keines Liebenden Wärme
Kann dich verdrängen.
Ich wandle immer in deiner Umarmung.31
Es dominiert ein melancholisch-vergänglicher Ton. Das lyrische Ich ist in einem Schwebezustand zwischen Leben und Tod gefangen, im Spannungsfeld zwischen Lebensbejahung und Vergänglichkeitserfahrung. Zwar erscheint der Tod respektive das Totenreich nicht als Gefahr, dennoch wiegen der Verlust und der Tod der Geliebten schwer und werden als unbegreifliche Zäsur empfunden. Die tiefe Verzweiflung des Ichs über den Verlust erhält dabei durch die direkte Anrede der Toten sowie durch den gesprächsartigen Charakter des Gedichtes eine starke Eindringlichkeit. So erbittet das sprechende Ich sehnsüchtig die Rückkehr des sinnstiftenden Hauches der Verstorbenen; denn selbst die „zärtlichen Hände“32 sowie die wärmende Nähe der Lebenden können kein Gegengewicht zum Tod mehr herstellen. Der Schmerz über den Verlust kann letzten Endes nicht überwunden werden, und das lyrische Ich wandelt stets in der Umarmung der Verlorenen, in der Umarmung von Leben und Tod.33
Die Verneinung des Lebens sowie die Empfindung des bedrohten Ichs setzen sich thematisch in Ludwigs Gedichten deutlich fort, erfahren im Kunstblatt gar eine zusätzliche Steigerung. Der Schwebezustand zwischen Vergänglichkeitserfahrung und menschlicher Nähe hat sich völlig in Bitterkeit über die Welt aufgelöst. So findet sich das lyrische Ich in einer emotionalen Welt der Einsamkeit und Hilflosigkeit wieder. Die Welt des sprechenden Ichs ist wesenlos, menschliche Nähe und Empathie nicht zu erwarten. Selbst in der Nacht bleiben dem schutzlosen Ich die Türen verschlossen.34
Ich bin eine Wölfin die ohne Hunger heult
Ich strecke Hände aus ins Wesenlose
Ich wende mein Gesicht zu nächtigen Türen
Erschräke, wenn jemand riefe: herein35
Das lyrische Ich projiziert seinen emotionalen Zustand, den Ausdruck seiner Innenwelt dabei auf die Natur, und zwar auf die des Wolfes. Der Vergleich mit dem Wolf wird zum Abbild der emotionalen Innenwelt des Ichs. So steht der Wolf als Raub- und Rudeltier sinnbildlich für soziale Bindung und Selbsterhaltungstrieb; doch beide Wesensmerkmale scheint der Wolf verloren zu haben. Selbst sein Heulen findet keinen Widerhall.36
Die Bitterkeit über die Welt wird in derselben Ausgabe des Kunstblattes bisweilen von der Liebeserfahrung des sprechenden Ichs abgelöst. Doch der positive Ton währt nur kurz. So wird die Liebe vielmehr als sündhaft und ambivalent erfahren – etwa im Gedicht Ich liebe dich im Angesicht der losen, welches später in Ludwigs zweiter Gedichtsammlung Der himmlische Spiegel 1927 unter dem Titel Ich liebe dich erneut erscheinen sollte.37
Ich liebe dich im Angesicht der losen
Unendlich süßen Blüten meiner Sünden
Und gehe heimlich hin mich anzuzünden
im dornenhaftesten Gebüsch der Rosen.38
Die Ambivalenz der Liebe, auf die formal auch der umarmende Reim hinweist, manifestiert sich vor allem in der religiös konnotierten Bilderwelt der Rose. Einerseits als Sinnbild der Liebe und der Freude evoziert die Rose aber auch immer Schmerz, Vergänglichkeit und Tod: Jede Rose ist bestückt mit Dornen. Die Enttäuschung über die unerfüllte Liebe sowie die fehlende menschliche Nähe und Empathie mündet bei Ludwig innerhalb dieser Ausgabe des Kunstblattes schließlich in einen resignierenden Tonfall. Der Transzendenzverlust des lyrischen Ichs erfährt dabei eine hyperbolische Steigerung. So scheint es keinen Halt mehr in dieser Welt zu finden und befindet sind im freien Fall.39
Aller Wesen Sommer gleitet aus
Fällt von Tiefe zu Tiefe.40
Das lyrische Ich empfindet sich als seelenlos, als ein inhumanes und bedrohtes Wesen, eingelassen in eine kranke Masse. Es befindet sich in einem Zerwürfnis zwischen individueller Erfahrung und der Auflösung in der Masse. Angesichts der Bedrohlichkeit der Welt verfällt das Ich in einen schockartigen Zustand, ist handlungsunfähig, kann nichts gegen den drohenden Zerfall der Welt unternehmen. Bangend und abwartend fragt sich das sprechende Ich, wann der Schrei des Vogels – der religiös konnotiert ist – das mit einer Hoffnungsperspektive verbundene blutige Ende der Welt verkündet.41
Die Welt ist krank und ich ein Stein
Eingefügt in neue Mauer,
Warte bis sie abbröckelt.
Und horche so die Zeit hin –
Auf meiner Straße das süße Kreuz sinkt ein
Wann wird eines kleinen Vogels Blutschrei die Erde aufreißen?42
Der Blick auf den paratextuellen Kontext, in den Paula Ludwigs Gedichte im Kunstblatt und in den Neuen Blättern für Kunst und Dichtung eingebunden sind, gibt deutlich zu erkennen, dass nicht nur in ihren Versen ein verunsichertes lyrisches Ich begegnet, das seinen inneren Seelenzustand nach außen in die Natur projiziert. Es eröffnen sich aber auch hoffnungsvolle Perspektiven und Evokationen einer kosmischen und natürlichen Ordnung, in die das menschliche Leben eingebettet ist. Gerade im Kunstblatt, und hier im Besonderen bei Peter Huchel und Jakob Haringer, scheint sich die menschliche Existenz stets in einer übergeordneten, kosmischen Ordnung sowie im natürlichen Rhythmus der Natur zu ergründen. Vor dem Hintergrund der Begegnung zwischen einem Jüngling und einem Mädchen wird beispielsweise in Huchels dialogisch aufgebautem Gedicht Die Begegnung am Meer die enge Verbundenheit eines Liebespaares mit der Natur beschrieben. Nur wenn die Liebenden ihre Gewänder ablegen, sich der Kreatürlichkeit zuwenden und zu Tieren werden, sind sie in der Lage, mit der Natur eine Symbiose einzugehen und sich der leidenschaftlichen Liebe hinzugeben.43
JÜNGLING:
Da ich Sandalen und Gewandung
abstreife und nur Tier bin: nackte Haut,
posaunen hell die Winde, paukt die Brandung
und Gott wird mir in Meer und Möwe laut ...
[...]
Mein Tanz ist zum versöhnten Ufer blonde Furt ...
die Erde tanzt in mir. Das All umkreist mich Weib.
Ich tanze Gott! Ich tanze Freude der Geburt!
Anmut ist Andacht: Nackt-sein ist Takt-sein:
Nackt-sein ist All-überflaggt sein!44
Neben dem Hang zur Naturverbundenheit evozieren die Gedichte Huchels und Haringers zudem eine religiös-existenzielle Ebene, was sich in der Suche nach Gott oder in einer Gottverlassenheit äußert. Diese Form des religiösen Bezuges fehlt in den Gedichten Paula Ludwigs völlig. Zwar sind Ludwigs Texte ebenfalls von einer starken seelischen Entleerung des Ichs gekennzeichnet, sie verortet diese aber nicht wie Huchel oder Haringer in der Gottverlassenheit. Vielmehr hat die teils religiös konnotierte Bilderwelt bei Ludwig die Funktion der intrinsischen Zustandsbeschreibung, was sich im Besonderen in der konsequenten Ich-Perspektive äußert und bisweilen an Gedichte Else Lasker-Schülers erinnern lässt. Während es sich bei Huchel und Haringer um eine Klage über die Abwesenheit Gottes handelt, dient Paula Ludwig die Anlehnung an eine religiöse Bilderwelt vielmehr der Beschreibung des Existenziellen sowie der bedrohlichen Lebenssituation. Parallelen zwischen Ludwig, Huchel und Haringer lassen sich jedoch anhand der beschriebenen Naturmetaphorik festhalten, die auf die existenzielle Situation des lyrischen Ichs hinweist. So projizieren alle drei die seelischen Zustände des lyrischen Ichs meist auf die Natur.45