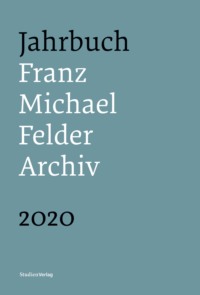Kitabı oku: «Jahrbuch Franz-Michael-Felder-Archiv 2020», sayfa 7
Die existenziellen Daseinsbeschreibungen innerhalb der lyrischen Beiträge korrespondieren auch im Bereich der Prosa mit der Fortsetzung expressionistischer Großstadtlyrik. August Endell fängt in seinen Großstadtimpressionen in insgesamt vier kurzen Prosatexten die vielfältigen Stimmungseindrücke Berlins ein. Dabei werden die Texte von einem befremdlichen und bedrohlichen Ton bestimmt. Die Stadt wirkt merkwürdig und grotesk. „Alles ist lose, frei sich dehnend ins Unendliche.“46 Die Sinne der Erzählinstanz scheinen angesichts des bizarren Schauspiels und der Dynamik der Großstadt überfordert. Der urbane Raum bekommt wesenhafte Züge. So wird die Stadt zu einem handelnden Objekt, wohingegen der Mensch zum reinen Beobachter degradiert wird. Dies verdeutlicht sich vor allem anhand der gewählten Erzählinstanz. Im Unterschied zu einer klassischen Ich-Erzählinstanz weist diese keinerlei Persönlichkeitsprofil auf, der Erzähler bleibt verborgen, die Eindrücke der Stadt erzählen sich scheinbar selbst.47
„Wagengedränge und Menschen verschmelzen hier völlig. Der ganze Platz ist dicht gefüllt und scheint wie ein einheitliches Wesen. Nicht einmal die schwerfälligen Gebäude der Trambahnen können den Bann brechen, so gewaltig sind Licht uud (sic!) Luft die alles umhüllen, alles verbinden, verschmelzen zu einem ruhelos bewegten Ungeheuer.“48
Im Speziellen in der Darstellung des unheimlich Wesenhaften der Stadt erinnert Endells Kurzprosa zuweilen an expressionistische Großstadtgedichte eines Georg Trakl, Jakob van Hoddis oder Alfred Lichtenstein, wenngleich die Darstellung der Stadt bei Endell zu keinem Zeitpunkt in einer Dämonisierung gipfelt, wie dies bei Georg Heym bisweilen geschieht.49
Gerahmt werden die literarischen Originalbeiträge sowohl im Ararat als auch im Kunstblatt sowie in den Blättern für Kunst und Dichtung von Abdrucken zeitgenössischer Kunst, Künstlerporträts, umfangreichen Besprechungen zu aktuellen Ausstellungen sowie Beiträgen zu Film und Tanz. Ganz im Sinne der Ausrichtung der Zeitschriften auf die Moderne hin lässt sich dabei ein starker Hang zu avantgardistischen Kunstströmungen ablesen, welche sich gegen bisher gängige Konventionen wie Klassizismus oder Romantik wandten und für eine moderne Kunst eintraten. So zeigen sich Abbildungen und Essays von Wegbereitern der modernen Malerei wie Eduard Manet, Pablo Picasso oder Paul Cézanne, Realisten wie Gustav Courbet und Honoré Daumier, aber auch Expressionisten wie Oskar Kokoschka, Gottfried Diehl, Rudolf Wacker oder Lovis Corinth.50
Die Frage, ob Bezüge zwischen Paula Ludwigs Texten und dem ästhetischen Kontext der Zeitschriften hergestellt werden können, lässt sich zumindest anhand der untersuchten Ausgaben durchaus bejahen. So steuert die starke expressionistische Ausrichtung der Blätter im künstlerischen Bereich auch den Rezeptionsprozess der literarischen Originalbeiträge. Gerade die Kombination von bildlichen und textlichen Repräsentationsformen in allen drei Periodika erscheint stark rezeptionslenkend und vermittelt damit letztlich deutlich den Eindruck, dass Paula Ludwig dem Kunstverständnis der Zeitschriften folgt.51
Neben der rezeptionssteuernden Produktions- und Programmlogik der Zeitschriften sind es aber durchaus auch literarische Verfahrensweisen, die Ludwigs Gedichte in Verbindung mit dem Expressionismus bringen. Obgleich der literarische Expressionismus im Unterschied zu dessen Pendant im bildenden Bereich als keineswegs homogene Strömung begriffen werden darf, lassen sich in den Gedichten Ludwigs dennoch deutlich Anklänge an den Expressionismus erkennen. Gerade zu Georg Trakl und Else Lasker-Schüler, welche Paula Ludwig selbst in ihrem Tagebuch neben Eichendorff, Hölderlin sowie Benn, Ringelnatz und Stefan George als ihre Lieblingsdichter listet,52 lassen sich durchaus einige Parallelen ziehen; denn ähnlich wie bei Trakl ist auch bei Ludwig die existenzielle Klage verbunden mit einer starken Melancholie unüberhörbar. Darüber hinaus sind Ludwigs Gedichte von Trauer, Resignation, Untergangsahnungen sowie von der Erfahrung des bedrohten und unbehausten Individuums geprägt. Auffallend erscheint bei Ludwig jedoch – im Unterschied zu Trakl – der Verzicht auf eine komplexe, schwer dechiffrierbare Bildlichkeit. Mit Else Lasker-Schüler verbindet sie vor allem der konsequente Ich-Bezug sowie die Liebesthematik. Nicht ohne jeden Grund bezeichnete Yvan Goll Paula Ludwig als die christliche Else Lasker-Schüler, wobei christlich hier als nicht-jüdisch zu verstehen ist. So schrieb er im Februar 1931 in einem Brief an seine Frau Claire:53 „Ich habe auch Paula Ludwig kennengelernt: seltsames Bauernmädchen, Tochter eines Sargtischlers, ziemlich holzschnitthafter Kopf, aber eine feine Seele. Sie entwickelt sich langsam zu einer christlichen Lasker.“54
2.2 Wiederentdeckung von Natur, Sehnsucht und Liebe: Paula Ludwig im Kontext der Berliner Romantik
Neben Zeitschriften, die nach dem Ersten Weltkrieg für ein neues, der Moderne nahestehendes Kunstverständnis eintraten, entstanden parallel dazu vereinzelte Periodika, welche sich für eine Wiederbelebung romantischer Werke und Weltanschauungen starkmachten. Als überaus starker Verfechter der romantischen Gesinnung galt der Schriftsteller Kurt Bock. Bock war in Berlin Vorsitzender des Eichendorff-Bundes und veröffentlichte zwischen 1918 und 1926 die Zeitschrift Berliner Romantik. Er hatte mit seinem Periodikum – wie bereits aus dem Titel hervorgeht, aber auch am stark konventionellen Layout abzulesen ist – die Absicht, die Werke der Berliner Frühromantik wiederzubeleben.55 So schreibt er in der ersten Ausgabe der Zeitschrift:
„Einer inneren Forderung unserer Zeit, die in Materialismus nahezu versinkend notwendig nach geistigem Gegengewicht ruft, wollen diese Blätter entsprechen. [...] Der Romantiker starker Wille zu leuchtender Tat kann und muss heute Lebensfreude spenden, Herzenswärme, die Schönheit ausstreut über die Erde hin und Gemeines in Schatten versenken.“56
Bock druckte unter anderem Lyrik von Friedrich Schlegel, Rainer Maria Rilke, Cäsar Flaischlen, Richard O. Koppin, Joseph von Eichendorff, Herbert Eulenberg, Hermann Hesse, Hans Franck, Walter Harlan sowie Prosatexte aus der Romantik und der unmittelbaren Gegenwart. Darüber hinaus enthielt die Zeitschrift immer wieder literaturtheoretische Aufsätze und Essays sowie Künstlerporträts. So wurde beispielsweise Heft 3/4 des dritten Jahrganges der Zeitschrift Friedrich Hölderlin gewidmet. Die inhaltlich fundierten Aufsätze und Beiträge zu diesem Schwerpunkt kamen vor allem von Erwin Reiche und Hermann Kasack, dem Förderer Paula Ludwigs. Gerade aufgrund dieser sorgfältig verfassten Beiträge und ihrer inhaltlichen Zuverlässigkeit galt die Berliner Romantik in der Nachkriegszeit als eines der qualitätsvollsten Medien der literarischen Öffentlichkeit in Berlin.57
Paula Ludwig veröffentlichte 1920 im dritten Heft des zweiten Jahrganges der Romantik insgesamt drei Gedichte. Erneut ist sie mit dem Gedicht An eine Tote vertreten; weiters mit den beiden Gedichten Die Erde ist mir lieb und Du kanntest ihre Gestalt, ebenfalls Gedichte aus ihrer ersten Buchveröffentlichung Die selige Spur. Wiederum handelt es sich um Gedichte ohne strenge formale Regelhaftigkeit, freirhythmisch, reimlos und ohne deutlich erkenntliche Strophik. Insbesondere Du kanntest ihre Gestalt schließt dabei deutlich an den sehnsüchtigen und melancholischen Ton aus ihren Publikationen in den dem Expressionismus nahestehenden Zeitschriften Der Ararat, Das Kunstblatt und Neue Blätter für Kunst und Dichtung an. So beklagt auch hier das lyrische Ich den Tod sowie den schwerwiegenden Verlust eines geliebten Menschen. Es ist stets auf der Suche nach Nähe, Geborgenheit und Zuneigung. Doch im Unterschied zu An eine Tote wird das Verhältnis zwischen dem lyrischen Ich und der geliebten Person nicht lediglich anhand einer Bildlichkeit aus dem Bereich des Menschlichen geschildert. Zwar wird der Zusammenhang des sprechenden Ichs und der Geliebten über die menschliche Gestalt im Bild der sich berührenden Hände hergestellt und die Beziehung zu dieser verlorenen Gestalt über Gesänge, Melodien und Töne zusätzlich versinnlicht. Die Verbundenheit des lyrischen Ichs verdichtet sich jedoch vor allem in Bilder der Natur bzw. der Landschaft. Lediglich in der Natur scheint das Ich der geliebten Person nahe zu sein, die vom Menschen hinterlassenen Spuren nur in der Natur auffindbar.58
Nun suche ich nach ihrer Spur
in den Wiesen des Frühlings,
die vorüberging wie ein Strahl,
und in zerfallenes Licht
trage ich meine sehnsüchtige Trauer.59
Obgleich dem Bild der Frühlingswiesen eine positive Konnotation im Sinne einer Erneuerung bzw. eines Neubeginns inhärent ist, bleibt der vergängliche und melancholische Ton unüberhörbar. Gerade die mit dem Frühling in enger Verbindung stehende Lichtmetapher wird durch den Verweis des lyrischen Ichs auf seine „sehnsüchtige Trauer“60 ihrer natürlich positiven Assoziation beraubt. Die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit der Geliebten bleibt flüchtig, das Licht nur ein kurzer Strahl, der letztlich zerfällt.61
Die Verbundenheit des Menschen mit der Natur äußert sich jedoch noch deutlicher im Gedicht Die Erde ist mir lieb, wenngleich das Gedicht in einem deutlichen Kontrast zum vergänglichen und negierenden Ton der anderen Gedichte Paula Ludwigs in dieser Ausgabe der Romantik steht; denn anders als in An eine Tote und Du kanntest ihre Gestalt wird in diesem Gedicht nicht der schmerzliche Tod oder die Sehnsucht nach einem geliebten Menschen beklagt, vielmehr vermittelt das Gedicht ein Bild der Überwindung von Schmerz und Tod. So wird die Geburt eines Menschen zum Sinnbild des Neuerwachens des Lebens. Die enge Verbindung zwischen Mensch und Natur wird hierbei vor allem durch die euphorische Reaktion der Natur auf die Empfängnis des neuen Menschen deutlich.62
Die Erde ist mir lieb,
seit dein strahlender Leib
eingegangen ist in sie.
Von nun an werden die Blumen im Wind
immer flüstern von deinen behutsamen Händen.
Wenn durch stille Wälder
die Quellen ihre Wohltat vergießen,
werden sie nachsingen
die Melodie deines Mundes.63
Der Einklang zwischen Mensch und Natur äußert sich auf der stilistischen Ebene dabei insbesondere anhand der Personifizierung und Vermenschlichung der Pflanzenwelt: Blumen flüstern, Wälder schweigen und singen. Doch selbst in der engsten Verbundenheit mit der Natur scheint der Mensch sich stets in einem latenten Zustand der Bedrohung zu befinden. So bildet der Ausruf „Siehe“ im zehnten Vers eine deutliche Zäsur, woraufhin vor der Gefahr einer Zerstörung der natürlichen Abläufe der Dinge gewarnt wird. So werden der euphorisch gestimmten Natur die Last sowie die Gefahren der technisierten Welt entgegengesetzt, vor welcher das junge Leben scheinbar geschützt werden muss. Es ist am Ende erneut die Natur, welche die menschliche Empfindung erblühen lässt und nicht die moderne technisierte Welt. Das Glück der „keusche[n] Empfängnis“64 liegt letzten Endes im Duft der Blumen.65
Siehe:
Mein Herz klopft,
wenn ein harter Wagen poltert über die Straße.
Ich kniee mich nieder zur Erde:
daß sie nicht laste auf deinem Lächeln,
daß sie mir wiedergebe in ihren Blumen,
in ihrem Dufte
dich keusches Empfängnis.66
Hinsichtlich Thematik und Bildhaftigkeit findet Paula Ludwig damit deutlichen Anschluss an die Programmatik der Herausgeber der Zeitschrift im Sinne einer Wiederbelebung „romantischer Werke und Gesinnung“.67 Insbesondere thematisch knüpfen ihre Gedichte sichtlich an Merkmale der Romantik an; denn neben den Motiven des Traums, der Liebe sowie der Sehnsucht ist es vor allem die Suche nach einer engen Verbundenheit mit der Natur, die Ludwigs Gedichte deutlich an die Tradition der romantischen Dichtung anschließen lässt.68
Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang zudem, dass Paula Ludwig für diese Ausgabe der Romantik scheinbar den Rahmen vorgibt. So wird das Heft nicht nur mit ihren drei Gedichten eingeleitet, es schließt auch mit einer essayistischen Betrachtung ihres Werkes durch Hermann Kasack – eine konzise Version von Kasacks Vorwort zu Ludwigs Gedichtband Die selige Spur. Allem Anschein nach und aufgrund der zeitlichen Nähe beider Publikationen zueinander, wollte Herausgeber Bock mit der starken Präsenz Paula Ludwigs in seinem Heft auf deren erste Buchveröffentlichung aufmerksam machen.
Kasacks Text – gekennzeichnet von einer abgeschwächten expressionistischen Eindringlichkeit – lenkt den Fokus gezielt auf Ludwigs Herkunft:69 Die Dichterin sei „niedrig geboren, in Dienst und Arbeit großgeworden“70; gleichzeitig betont er das „Naturhaft-Unverbindliche ihrer Lyrik“71. Kasack beschreibt Paula Ludwig – wie es Heide Helwig formuliert – als „Botin einer Naturpoesie, nach der schon die Romantiker Ausschau hielten“72. Ausgehend von Ludwigs Abstammung und sozialem Umfeld zeichnet Kasack das Bild einer „bloßfüßig wandelnden Dichtergestalt“,73 die, unberührt von allem, in die literarische Öffentlichkeit der 1920er Jahre hineintrat.74 Indem Kasack in Paula Ludwigs Gedichten eine an die Romantik deutlich anschließende Naturpoesie erkennt, werden ihre Texte zumindest für diese Ausgabe durchaus zum Programm der Zeitschrift. Dies bestätigt sich insbesondere dann, wenn man das paratextuelle Umfeld der Gedichte Ludwigs näher betrachtet. Verwandte Bilder der Sehnsucht nach dem Verlorenen, der Natur als Abbild des inneren Zustandes, das Motiv des Traumes und der Erinnerung zeigen sich auch deutlich in den Gedichten Richard Hirschs, Alfred Pralles sowie Elisabeth Meinhards. Gerade bei Meinhard kommt ähnlich wie bei Ludwig ein Welt- und Trennungsschmerz zum Ausdruck. So klagt auch hier das lyrische Ich über die Abwesenheit einer geliebten Person. Der Verlust wiegt dabei scheinbar schwer, der innere Seelenzustand des sprechenden Ichs gleicht einem verlassenen und verwahrlosten Haus. Nur in der Erinnerung an die geliebte Person und im Traum scheint das Ich den schweren Verlust zu ertragen.75
Manchmal fällt durch eine Ritze am Holz
ein Sonnenstrahl in die kühl gewordene Stube.
Und wie das Lächeln glücklicher Kinder im Traum
schleicht ein Erinnern vom Leben treppauf und treppab.76
Neben dem sehnsüchtigen und melancholisch negierenden Ton sind es aber auch zivilisationskritische Anklänge insbesondere in Ludwigs Gedicht Die Erde ist mir lieb, die sich auf der thematischen Ebene mit anderen Texten dieser Ausgabe decken. Speziell in Karl Schönbergs Erzählung Der schmerzliche Weg kommt die Kritik an der modernen Zivilisation offenkundig zum Ausdruck. Darin beschreibt Schönberg die Großstadt mit all ihren negativen Aspekten. Menschenmassen, überfüllte Krankenhäuser sowie Gewalt, Chaos und Seuchen prägen das Bild der Stadt. Der degenerierte urbane Raum wird zur fast unüberwindbaren Hürde, zur Barriere zwischen den natürlichen Räumen und der Liebe zweier Personen. So findet der Ich-Erzähler keinerlei Orientierung und Halt in den „von ewiger Menschenwanderung erfüllt[en]“77 Straßen. Es bleiben schließlich die wegweisenden Sterne, welche die Hoffnung des Ich-Erzählers auf eine Flucht in die Natur, auf eine Rückkehr zu seiner Geliebten aufrecht erhalten.78
Überdies gesellt sich zur Naturverbundenheit und Zivilisationskritik noch ein weiterer wesentlicher Aspekt der romantischen Weltanschauung, auf welchen im Besonderen Alfred Ferdinand Rabes mit seiner Abhandlung Die Romantik und der Persönlichkeitsgedanke hinweist: die Betonung des Individuums. So sind sämtliche Gedichte – jene Paula Ludwigs eingeschlossen – von einem starken Rückbezug auf die Innerlichkeit geprägt. Die Gedichte können allesamt als persönliche und innere Zustandsbeschreibungen des jeweiligen sprechenden Ichs verstanden werden.79 Hierzu schreibt Rabes: „Die Romantiker erhoben das Individuum in imaginäre Räume und bestätigten seine Größe durch die Eigenwerte des einzelnen, die er dank der im Innern ruhenden und nun entfesselten geheimnisvollen Kräfte, aus den Tiefen der Seele an das Licht des Tages hob.“80
2.3 Geistiger Wiederaufbau:
Paula Ludwig und Die neue Rundschau
Als weit heterogener in der programmatischen Ausrichtung als die Romantik galt in den 1920er Jahren die von Otto Brahm gegründete Zeitschrift Die neue Rundschau. 1890 zwar als Kampfzeitschrift der naturalistischen Bewegung gegründet, fühlten sich die Herausgeber der Rundschau im Wesentlichen aber keiner Strömung verpflichtet. Vielmehr zählte sie bereits 1918 zu den etablierten Periodika unter den großen Literaturrevuen und zeigten im Unterschied zu vielen damaligen Mitbewerbern große Aufgeschlossenheit gegenüber allem Neuen.81 Gerade zur Glanzzeit der Zeitschrift zwischen 1904 und 1925 setzten die Herausgeber neben strengen Maßstäben und hohem Niveau auf eine weltweite Offenheit gegenüber „dem Jüngeren, dem Nachstrebenden, den noch so abseitigen poetischen Entdeckungen“.82 So öffnete sich die Rundschau beispielsweise auch gegenüber der Literatur und den sozialen Fragen wie politischen Diskursen des Auslandes.83 Die ausgeprägte Neigung zu einem europäischen Kollektivempfinden entwickelte sich vor allem seit dem Ende des Ersten Weltkrieges und wurde in der Folgezeit zu einem bestimmenden Kennzeichen der Zeitschrift und machte sie damit zu einem der modernsten Publikationsorgane der Zeit.84
Doch obgleich die Zeitschrift von Anfang an dem Neuen gegenüber sehr aufgeschlossen war und sich durch eine pluralistische Ausrichtung auszeichnete, schenkte man nicht allen Geistesströmungen gleich viel Beachtung. So schienen die Herausgeber der Zeitschrift beispielsweise wenig Sympathien gegenüber dem Expressionismus zu haben. Der Expressionismus war vor allem aufgrund der starken Abwehr des Verlegers Samuel Fischer und seines engeren Beraterstabs lediglich ein Nebenschauplatz innerhalb der Neuen Rundschau. Man widmete sich vielmehr Otto Flake, Robert Musil sowie Oskar Loerke und Alfred Döblin.85 Dass der Expressionismus durchaus Dichter und Dichterinnen von Rang hervorbrachte, darüber war sich die Rundschau-Redaktion zwar einig, dennoch sah man – bis auf wenige Ausnahmen – meist schweigend über sie hinweg. Vielmehr wandte sich Die neue Rundschau gerade in den 1920er Jahren einer Literatur zu, die durch Wirklichkeitsbezug und Nüchternheit gekennzeichnet war. So schreibt Rudolf Kayser – Mitherausgeber und Redakteur der Zeitschrift – im Jahr 1926:86 „Nach den maßlos verströmten Ekstasen wird jetzt in allen Lebensbezirken die Tendenz zu neuer Wirklichkeit und Sachlichkeit sichtbar.“87
Die Aussage Kaysers heißt jedoch nicht, dass sich Die neue Rundschau als Publikationsorgan jener Strömung begriff, die den Expressionismus zu überwinden versuchte; dennoch lagen der Neuen Rundschau die Grundüberlegungen und -gedanken der Neuen Sachlichkeit scheinbar näher als jene des Expressionismus.88 Insbesondere der Lyrik des Expressionismus stand man kritisch gegenüber. Der Schriftsteller und Literaturkritiker Arthur Eloesser beispielsweise attestiert 1918 im achten Heft der Zeitschrift der jüngeren expressionistischen Generation ein zu geringes Maß an Welt- und Erdnähe. Er spricht der expressionistischen Dichtung den Mangel eines pietätsvollen Verhältnisses zur Natur ab, welche gerade ein Spezifikum der Lyrik Goethes gewesen sei. Damit gehen die Forderungen nach einer Abkehr von abstrahierenden und formelhaften Verfahrensweisen und der Wunsch nach einer Wiederbelebung einer sinnlichen Betrachtungsweise einher. In der Kunst soll wieder eine Einfachheit und „substantielle Natürlichkeit“89 einkehren, die zur Artikulation ihrer Anschauung nicht den Umweg der Abstraktion benötigt. Die zentralen ästhetischen Forderungen lauteten dementsprechend Einfachheit, Unmittelbarkeit, Sinnlichkeit sowie Welt, Erde und Natur.90 Man bemühte sich augenscheinlich nicht um die Auflösung bürgerlicher Ästhetik, dennoch artikuliert sich gerade im Lyrikverständnis der Rundschau-Kritiker die Bestrebung, neue und traditionelle Elemente miteinander zu verbinden.91 Genau aus dieser Überzeugung heraus wurde die Zeitschrift gerade in den Zwischenkriegsjahren zu einem vielstimmigen Gebilde, zu einem Medium, in dem sich viele Meinungen erheben durften, um einen fruchtbaren Dialog und Austausch im Sinne eines geistigen Wiederaufbaues zu führen.92 Die neue Rundschau fungierte als bürgerlich-liberale Kulturzeitschrift und als „Generator vielschichtiger Diskurse“93, wodurch sie letztlich zu einem „Denkmal“94 des breiten literarischen Ausdrucks der Weimarer Republik aufstieg.95
An diesen Diskursen beteiligte sich auch Paula Ludwig mit ihren Gedichten. So ist sie im September 1929 im neunten Heft der Neuen Rundschau mit den Gedichten Dies aber ... und Spätherbst vertreten (im Dezember 1934 nochmals mit dem Gedicht Totenfeier). In allen Gedichten kommt erneut eine starke Naturverbundenheit zum Ausdruck. So werden die inneren Zustände des Ichs wiederum auf die Natur übertragen und der Verlust geliebter Dinge beklagt. Doch gerade im Gedicht Dies aber ... tritt an die Stelle der Resignation, der Vergänglichkeit sowie der Bedrohlichkeit des Lebens aus ihren im Kunstblatt oder in der Romantik veröffentlichten Gedichten ein offensichtlich reiferer Blick des sprechenden Ichs auf die teils beschwerlichen Umwege des Lebens. Zwar fragt sich das lyrische Ich mit sehnsüchtigem Ton, wie einst geliebte Dinge für den inneren Seelenzustand wieder fruchtbar gemacht werden können, doch ist das Ich nun „geübt zu unterscheiden, was beglückt und trübt“.96 Das Ich lässt die Rückkehr des ehemals Geliebten zu, ist sich jedoch der mit der Liebe verbundenen Gefahr bewusst und möchte sich sowohl den positiven als auch negativen Emotionen nicht erneut vollends hingeben. Vielmehr erscheint das lyrische Ich in seinem Handeln gefestigt und reflektiert.97 Es ist nun gewohnt, „daß sich Musik und Wind und Welle eint.“98
Wie holt man Dinge, die man einst geliebt,
aus kühlen Schatten an den Tag hervor –
wie kann man eine Aster, die erfror,
anrühren, daß sie wieder Farbe gibt –
O dieses Herzens ungeteiltes Ohr
hat sich in Zeiten wunderbar geübt
zu unterscheiden, was beglückt und trübt –
es rauscht zurück der Wald, was sich verlor.
Dies aber wurde Herz und Quell verneint,
daß einmal wieder jene Flöte tönt,
so süß vom Anfang ihres Seins verschönt,
von Tränen, die der erste Tag geweint –
Nun ist das großgewachsene Tal gewöhnt,
daß sich Musik und Wind und Welle eint.99
Der scheinbar reifere Blick des sprechenden Ichs wird begleitet von einem gesteigerten Formbewusstsein der Dichterin. So waren ihre bisher erschienenen Gedichte durchwegs ohne strophische Gliederung, reimlos und metrisch ungebunden, d.h. durch freie Rhythmen gestaltet. Die Gedichte in der Neuen Rundschau hingegen zeichnen sich durch einen strengeren Aufbau der Strophik aus. Insbesondere das Gedicht Dies aber ... offenbart durch die strenge Form des Sonetts das gesteigerte Formbewusstsein der Dichterin. Ludwig wählt hierbei jedoch nicht die geläufigere Form des Alexandriners, sondern bedient sich der italienischen Sonettform. So realisiert sie das Gedicht durch einen fünfhebigen Jambus mit stumpfer Kadenz. In den beiden Quartetten folgt sie dem üblichen Reimschema abba / abba, während sie in den abschließenden Terzetten mit den Reimfolgen cdd / cdc vom italienischen Sonett abweicht.100 Durch die strengere Form vollzieht sich in diesem Gedicht noch eine weitere Veränderung in Ludwigs lyrischer Verfahrensweise; nämlich jene vom mehr prosaischen zum lyrischen Stil. So zeigte sich in den bisherigen Gedichten aufgrund ihrer freien metrischen Gestaltung eine Tendenz zur Prosa hin101, wohingegen die gebundene Sprache sowie die stärkere Rhythmisierung zu einer lyrischeren Ausdrucksweise führen. Abgesehen vom gesteigerten Formbewusstsein artikuliert sich in den Gedichten zudem eine bisweilen veränderte innere Kommunikationssituation. So ist zwar auch hier die Natur allgegenwärtig, dennoch fungiert sie nicht als Personifikation oder Projektion des Zustandes eines sprechenden Ichs; im Unterschied zu ihren Gedichten aus früheren Zeitschriftenpublikationen, in denen das lyrische Ich eine stark gefühlsbezogene Sprecherposition einnimmt und dadurch seine inneren Zustände ausdrückt, artikuliert sich nun ein verdeckter und auf den Gegenstand bezogener Sprecher, welcher als scheinbar sachlich objektiver Beobachter die Begebenheiten in der Natur beschreibt. So ergibt sich ein Stimmungsbild, in welchem die fruchtbare Kraft des Spätherbstes geschildert wird:102
Sie haben sich gewendet
von der großen Ernährerin,
sie brauchen ihren Strahl nicht mehr –
sie hängen im schütteren Laubwerk,
und ihre Süße sammelt sich langsam
bei der zunehmenden Trübe –
im feuchten Munde des Nebels
im Schauer des Nordwinds
steigen in ihnen die seligen Säfte,
brauen die Kälte-Geister
Ach, aus dem nahen, schon sichtbaren
Ansatz des Reifes
immer glänzender wölbt sich,
immer mächtiger
nähret sich selber die Frucht.103
Erst im letzten Vers wird vollends deutlich, dass es sich im Gedicht beim Subjekt „Sie“, von dem die Rede ist, um die Früchte der Natur handelt, die im Spätherbst zu ihrer Reife und Süße finden. Dabei bleibt der Mensch sowohl als lyrisches Ich als auch als angesprochenes lyrischen Du ausgespart und wird dadurch nicht explizit in den natürlichen Prozess der Natur eingebunden. Die menschliche Abwesenheit sowie Verdinglichung der Natur erweisen sich allerdings als durchaus bedeutungstragend. Zwar scheint der Mensch aufgrund seiner Abwesenheit vom natürlichen Zyklus der Jahreszeiten ausgeschlossen und im Spätherbst wortwörtlich keinen Platz zu finden, dennoch kann gerade aufgrund der verdichteten Metaphorik im Gedicht implizit ein Bezug zum Menschen hergestellt werden. So verdichtet sich vor allem in der letzten Strophe das Bild der Natur, es schafft Leerstellen, die auch ohne direkten Bezug zum Menschen ein Äquivalent zu demselben herstellen. Der auf den ersten Blick sachliche Befund über die Natur wird zum Spiegel des Menschen – und nur wenn dieser den natürlichen Zyklus von Entstehen und Vergehen akzeptiert, wird er auch Vollendung und Trost erfahren.104
Die Frage, inwieweit Ludwig mit dieser ästhetischen Verfahrensweise in die Ausrichtung der Neuen Rundschau eingebunden ist, lässt sich nur eingeschränkt beantworten; denn ganz im Sinne der Zeitschrift zeigt sich in dieser Ausgabe ein sehr pluralistisches paratextuelles Umfeld, wenngleich deutliche Tendenzen zu einer wirklichkeitsbezogenen, neusachlichen Literatur zu erkennen sind. Der starke Bezug zur Wirklichkeit bzw. zum Zeitgeschehen kommt dabei bereits bei Georg Cleinow zum Ausdruck, in dem er die geopolitische Lage Chinas in Bezug auf die Mandschurei skizziert. Die Forderung vieler Vertreter der neusachlichen Literatur, sich mit den alltäglichen Fragen der Zeit zu beschäftigen, zeigt sich bisweilen auch in Hermann Hesses Bücherbesprechung Notizen über Bücher. Insbesondere beim Blick auf die Bücherauswahl wird der Hang zur Wirklichkeitsbezogenheit augenfällig. So setzt sich Hesses Buchschau weniger aus Besprechungen fiktionaler Texte zusammen, sondern vielmehr aus Büchern mit sachbezogenen Inhalten, wie beispielsweise Abhandlungen und wissenschaftlich fundierte Texte aus dem Bereich der Psychoanalyse oder chinesischen Philosophie. „Ganz in der Tatsachenwelt [...] lebt und webt“105 auch Lujo Brentano in seinem letztem Band zur Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung Englands, welchem Samuel Saenger eine wohlwollende Erwähnung zuteilwerden lässt. Am deutlichsten äußerst sich der neusachliche Duktus in dieser Rundschau jedoch wohl in Heinrich Hausers literarischem Originalbeitrag Schwarzes Revier. Ein sich weitestgehend im Hintergrund befindlicher Ich-Erzähler schildert darin eine Besichtigungsfahrt durch die Krupp-Werke im Ruhrgebiet. Im Stile einer dokumentarischen Reportage reflektiert er kritisch und mit exaktem Blick den mühevollen und entmenschlichenden Arbeitsalltag in der deutschen Schwerindustrie. So werden die Arbeiter lediglich als Ressource und „Inventar des Menschenlebens“106 eines großindustriellen Arbeitsgebers beschrieben, welchem die menschlichen Wesenszüge gänzlich abhandengekommen sind. Doch nicht nur die Inhalte zeugen vom Anschluss an die neusachliche Literatur, sondern auch auf der formalen wie stilistischen Ebene werden charakteristische Merkmale der Strömung deutlich sichtbar. Gerade die an fotografische Momentaufnahmen erinnernden Ausschnitte evozieren einen objektiven Blick auf die beschriebenen Szenerien. Die Kameralinse wird regelrecht zum objektiven Zeugen der Wirklichkeit:107 „Eine alte Dame. Die alte Dame saß an einem großen Schreibtisch in einer Halle mit Säulen und vielen Sesseln, in der Besucher empfangen werden.“108
Paula Ludwig befindet sich mit ihren Gedichten damit in einem Umfeld, das der Neuen Sachlichkeit offensichtlich Rechnung trägt. Ihre sowie auch jene lyrischen Verfahrensweisen innerhalb des direkten paratextuellen Umfelds (Wilhelm von Scholz mit Hic fuit Till, Herbstnacht in Castagnola sowie Das Kloster) folgen jedoch keineswegs direkt dem Lyrikverständnis der neusachlichen Literatur im Sinne einer Ding- oder Gebrauchslyrik. In der Zeitnähe sowie der Objektwelt der Gebrauchslyrik sahen die Herausgeber und Kritiker der Neuen Rundschau aber auch nicht den von ihnen geforderten neuen Idealismus einer Verbindung von Tradition und Moderne vertreten. Zwar forderten die Kritiker der Zeitschrift auch in der Lyrik eine gewisse Nähe zur Welt und eine Abkehr vom Pathos des Expressionismus, sahen jedoch den reinen Wert der Lyrik in der Verbindung von Traditionellem und Neuem. Gerade die Berücksichtigung der Natur sowie ihre sinnliche Betrachtung, aber auch eine gewisse Einheit von Form und Inhalt erachteten sie dabei als zentral. An diese Forderungen knüpfen sowohl Paula Ludwigs Gedichte als auch jene Wilhelm von Scholz’ – zumindest in dieser Ausgabe der Neuen Rundschau – durchaus an. So lassen sich sowohl an Ludwigs Gedicht Spätherbst als auch an Scholz’ Herbstnacht in Castagnola Bilder geheimnisvoll wirkender Naturkräfte ablesen. Die sachlichen und beinahe „taxonomisch[]“109 genauen Naturdarstellungen verdichten sich dabei zu einem Bild bzw. Zeichen für ein übergreifendes Konzept von Entstehen und Vergehen, in welches das einzelne Individuum stets eingebunden ist.110 Die sachliche Naturbeschreibung in Paula Ludwigs Texten entspricht dabei deutlich dem Postulat vieler Rundschau-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach einer weltnahen Hinwendung zur Natur. Daneben zeigen sich im gesteigerten Formbewusstsein Paula Ludwigs deutlich traditionalistische Muster, was sich beispielsweise an der Annäherung an die Form des italienischen Sonetts im Gedicht Dies aber ... zeigt.111
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.