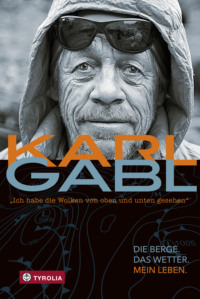Kitabı oku: «"Ich habe die Wolken von oben und unten gesehen"», sayfa 3
BERGLEIDENSCHAFT
Sobald ich gehen konnte, nahm mich meine Mutter auf Ausflüge und Wanderungen in die heimatlichen Berge des Arlberg mit. Zuerst zu Spielplätzen am Bach im Schöngraben, zum Beerensammeln im Maroi mit Kreuzottererlebnis, auf den Erzherzog-Eugen-Weg oder auch den Arlenweg, auf Ausflüge über den Kristbergsattel von Dalaas nach Schruns, auf Wanderungen zum Spullersee im Lechquellengebirge, aber auch auf anspruchsvolle exponierte Wanderungen wie den oberen Höhenweg vom Kapall zur Leutkircher Hütte. Es war im Frühsommer 1954: In St. Anton gab es kein Kino und natürlich auch kein Fernsehen, aber Walter Schuler hatte in seinem Hotel Post einen Saal für Filmvorführungen eingerichtet. Dort sah ich den Film über die Erstbesteigung des Mount Everest durch den Neuseeländer Edmund Hillary und den Sherpa Tenzing Norgay. Ich war fasziniert und begeistert, und bei der nächsten Wanderung bat ich meine Mutter, mir einmal einen Eispickel zu kaufen, damit ich diesen starken Männern nacheifern könne.
Als ich fast zehn Jahre alt war, nahm mich mein Onkel Franz Rofner mit auf den Patteriol (3056 m), das matterhornähnliche Wahrzeichen des Verwalls und des gesamten Arlbergs. Mit dabei waren auch seine Kinder Harald und Doris, unser Cousin Gerhard Pedrini aus Innsbruck und Brigitte Walter, eine Freundin von Doris. Mit insgesamt fünf Kindern, die ältesten waren gerade einmal zwölf Jahre alt, brach Onkel Franz von der Konstanzer Hütte auf. Extra für diese Tour hatte mir meine Mutter eine schicke Knickerbockerhose aus Schnürlsamt geschneidert. Als Kopfbedeckung trug ich einen normalen Hut, Steinschlaghelme gab es ja noch nicht. Alle zusammen erreichten wir den Gipfel des Patteriol nach einigen Stunden, die letzten zwei Stunden mussten wir im zweiten Schwierigkeitsgrad klettern. Noch heute wundern Harald und ich uns, dass sich Onkel Franz traute, diese Klettertour auf diesen markanten Gipfel mit fünf Kindern ohne Seil zu unternehmen. Uns bescherte Onkel Franz’ Mut aber ein prägendes Erlebnis. Unsere Freude und unser Stolz waren riesengroß.
Mit meinem Vater und seinem Freund Richard Murr durfte ich als Zehnjähriger zur Gämsenjagd zur Erlachalpe ins „Erli“, nördlich der Valluga. Zweimal sollten wir auch übernachten. Einmal in einem Heustadel auf den Fallerstaißwiesen und das zweite Mal auf der Erlachalpe selbst. Es waren zwei wunderschöne Sommertage am Fuße von Fallerstaiß- und Roggspitze. Wir pirschten uns in diesen zwei Tagen mehrmals an Gämsen an. Richard schoss viermal und verfehlte viermal. Lapidar und nicht unglücklich sagte er nach jedem Fehlschuss: „Dann lassa mir sie halt leba“. Er hätte mir gar keine größere Freude machen können als mit den nicht getroffenen Gämsen, die nach dem Schuss davonspringen konnten.

Blick vom Kuchenjoch auf den winterlichen Patteriol (3056 m) im Verwall. Meine Winter-Erstbegehungen des Nordostgrats im Februar 1972 (rechts) und des mittleren Südostpfeilers im März 1973 wurden bis heute nicht wiederholt.
Als Elfjähriger bestieg ich mit Onkel Franz und meinem Cousin Harald den Hohen Riffler (3160 m), den höchsten Berg der Verwallgruppe und weithin sichtbaren Eckpfeiler. Kurz vor meinem 15. Geburtstag kaufte ich mir das Buch „Klettern im Fels“ von Franz Nieberl. Ich begann nun theoretisch bergzusteigen. Mit meinen Schnürsenkeln übte ich Bulinknoten, Sackstich, Prusikknoten, Weberknoten und Spierenstich. Diese genügten für die damalige Seiltechnik. Und im Sommer 1962 wurde ich von einigen Jesuitenpatres auf die Zimba im Rätikon mitgenommen. Meine Bergleidenschaft war geweckt und spontan fingen mein Cousin Harald Rofner, mein Nachbar Walter Strolz und ich an, die heimatlichen Gipfel, darunter auch leichte Felsgipfel wie die Weißschrofenspitze, zu besteigen. Immer wieder schweifte unser Blick hinüber zur steil aufragenden, felsigen Roggspitze nördlich der Valluga. Ein echter Kletterberg.
Damals gab es keinen Brust- oder Sitzgurt, sondern man band sich direkt mit einem Bulinknoten ins Hauptseil ein, das um die Brust geschlungen war. Auch Perlonseile waren noch nicht üblich. Und die Karabiner waren aus Stahl statt aus Alu, ebenso wie die Felshaken. Der Stiel des Hammers war aus Holz. Gesichert wurde über die Schulter und nicht mit Sicherungsgeräten wie einem Achter. Und beim Abseilen mit der Dülfermethode fraß sich das über einen Schenkel und die entgegengesetzte Schulter verlaufende Seil wegen der Reibungswärme durch die Kleidung und hinterließ auch Brandwunden auf der Haut.

Am Südpfeiler der Roggspitze in den Lechtaler Alpen: Sich ohne Sitzgurt direkt ins Hauptseil einzubinden war damals die übliche Anseilmethode. Dazu gehörten steigeisenfeste Lederschuhe und Schnürlsamt-Knickerbocker.
Mit Harald wollte ich den Südpfeiler der Roggspitze erklettern, der als Genusskletterei galt. Wir hatten aber keine Ahnung, wie schwer diese Route war. In meinem ersten Kletterjahr war ich idiotisch mutig. Das betraf nicht nur mein Können, sondern auch die Ausrüstung. Walter lieh uns ein altes, etwa 20 Meter langes Hanfseil, das beim Heuen verwendet wurde und einen Durchmesser von etwa acht Millimeter aufwies. Im Sporthaus Hannes Schneider besorgte ich mir einige Eisenkarabiner, mehrere geschmiedete Felshaken und einen Felshammer. Mutig stiegen Harald und ich am Pazüeljoch in den Südpfeiler ein, der 250 Meter in den Himmel ragt. Oft den Schwierigkeiten auf Bändern ausweichend, erreichten wir kurz unter dem Gamsband nach etwa zwei Dritteln der Tour die Schlüsselstelle: einen abdrängenden Riss, den ich persönlich wegen meiner kurzen, zum Spreizen weniger geeigneten „Haxen“ mit IV+ bewerte. Den Blick für den Verlauf einer Route hatten wir noch nicht, und so probierte ich lange, ehe ich direkt im Riss, mit Hängen und Würgen, den Durchstieg schaffte. Nicht auszudenken, was bei einem Sturz passiert wäre. Das in einen Haken und Karabiner eingehängte Hanfseil wäre bei einem Sturz von mehr als einem Meter sicherlich gerissen und ich wäre dann fast 200 Meter bis zum Wandfuß abgestürzt. Nach dieser Tour lieh uns Onkel Pepi fortan sein neues, geflochtenes Perlonseil.

Mit Walter Strolz am Weg zur winterlichen Bacherspitze. Im Hintergrund der Hohe Riffler (3160 m). Die eierförmigen Steinschlaghelme waren in den 1960er-Jahren modern.
Bei einer Wanderung auf dem Ludwig-Dürr-Weg, der von der Friedrichshafener zur Darmstädter Hütte führt, übernachteten wir Anfang September 1962 auf der Darmstädter Hütte. Immer wieder schaute ich mit Harald zur mächtigen Kuchenspitze (3148 m), zu ihrer Nordwand mit ihren zwei Eisfeldern und zum Ostgrat hinauf. Über den Ostgrat kletterten wir wenige Tage später auf den Gipfel der Kuchenspitze. Und vom Gipfel aus sahen wir im Westen den nahen Patteriol mit seinem Ostgrat aus dunkler Hornblende, der sich 1300 Meter mächtig über das Fasultal erhebt. Das war unser nächstes Ziel. Im Führer des Bergverlages Rother fanden wir eine Beschreibung und Fotos dieser Tour. Beim Anseilen am Schneefeld unterhalb des Grates sahen wir zwei Kletterer rasch aufsteigen. Es waren Innsbrucker, und als sie an uns vorbeigingen, musterten sie uns und blieben stehen. Einer von ihnen kam zu uns herüber, und ohne mit uns zu schimpfen, nahm er den Bulinknoten vor unserer Brust und zurrte ihn fest, wir hatten diesen nämlich nicht durch die Schlaufe gezogen. Von da an wussten wir, wie der Bulinknoten richtig gemacht wird. Weil ich mehrere Felshaken trug, bat mich Harald, auch einen Haken tragen zu dürfen, weil dies so toll aussehe. Selbstverständlich bekam er einen. Es dauerte lange, bis wir den Gipfel des Patteriol erreichten. Aber wir kamen unter dem gestrengen Blick von Ludwig Tschol, Bergführer und Hüttenwirt der Konstanzer Hütte, der unser Treiben durch einen Feldstecher beobachtete, am Gipfelan.
Mit der Zeit waren wir dann zu viert, die auf die heimatlichen Berge kletterten: Mein Freund Walter Strolz, mein Cousin Harald Rofner, Bernhard Pfeifer und ich. Mit Bernhard, einem Bewegungstalent, beging ich auch die Nordwand des Patteriol. Einmal – wir stiegen von der Weißschrofenspitze durch das Törli zum Schöngraben ab – sahen wir direkt nach dem Törli einen mehrere hundert Meter hohen Lawinenkegel in den Schöngraben hinunter. Der Bach hatte den abgelagerten Lawinenschnee unterhöhlt. Warum wir dann durch das Bachbett 200 Meter unter der Lawine ins Tal wanderten – diese verrückte Idee können wir uns heute noch nicht erklären.
Fast drei Jahre lang kam das Bergsteigen dann zu kurz. Einerseits schrieb ich eine umfangreiche Dissertation über die Messungen an der ehemaligen Forschungsstation Hochserfaus im sonnigen, trockeneren inneralpinen Klimagebiet des Oberen Gerichtes südlich von Landeck, wobei ich zum ersten Mal auch extremwertstatistische Methoden zur Beurteilung der Jährlichkeit von Neuschneehöhen angewendet habe. Andererseits übernahm ich im Malerbetrieb meines Vaters die Büroarbeiten. Ich schrieb die Rechnungen, erledigte die doppelte Buchführung bis zur Rohbilanz und berechnete sogar die Löhne der Mitarbeiter. Fast drei Jahre war ich an jedem Wochenende im Büro. Als mein Vater im November 1973 starb, übernahmen meine Schwester Erika und mein Schwager Kurt den Betrieb und auch die Büroarbeit.
Einmal, ich war zwei Jahre nicht mehr auf einer längeren Bergtour gewesen, plante ich mit Gerhard Markl aus Innsbruck, den Monte Rosa über seine 2000 Meter hohe Ostwand, die höchste Eiswand der Alpen, zu besteigen. Gerhards alter Peugeot war ein abenteuerliches Fahrzeug. Auf der Hinfahrt nach Macugnaga öffnete sich in einem Tunnel in der Schweiz die Motorhaube und versperrte die Sicht nach vorne. Gerhard meisterte das Problem locker, indem er das Seitenfenster herunterkurbelte und dort hinausschaute, bis der Tunnel zu Ende war. Auf der Rückfahrt verbrauchte das Auto für den defekten Kühler mehr Wasser als der Motor Benzin. Die Monte-Rosa-Ostwand bestiegen wir über das Marinelli-Couloir in zwei Etappen: am ersten Tag bis zur winzigen Biwakschachtel, dem Marinellibiwak, am zweiten über den Zumsteinsattel zum Gipfel. Bis auf die letzten 250 Höhenmeter gingen wir seilfrei, dann spürte ich konditionell meine zweijährige Trainingspause und bat Gerhard, uns wegen meiner wacklig gewordenen Beine anzuseilen. Nun, vierzig Jahre später, dürfte die Monte-Rosa-Ostwand aufgrund der Erwärmung eine äußerst stein- und eisschlaggefährliche Wand geworden sein.

1969 noch eine Himmelsleiter aus Schnee und Firn – mit meinem Studienkollegen, später Professor für Meteorologie, Reinhold Steinacker am Biancograt
Ich habe nie ein Tourenbuch geführt, aber ich kann mich trotzdem noch an jede einzelne der vielen bekannten Touren im fünften und sechsten Schwierigkeitsgrad im Wetterstein, im Karwendel, im Wilden Kaiser, in den Dolomiten erinnern. Ich war vor allem mit Helmut „Willi“ Rott, Thomas Mihatsch, meinem Neffen Berndt Köll, Adi Staudinger, Jakob „Joggl“ Oberhauser und zuletzt sehr viel mit Wolfger Mayrhofer unterwegs. Mit Robert Renzler als Seilerstem meisterte ich die Comici in der Großen-Zinne-Nordwand (VII–) und die Lacedelli (VI+/A1) an der Scotoni. Mit Adi Staudinger ist mir die Route Egger-Sauschek (VI–/A1) an der Kleinen Zinne wegen der Felsqualität und der wenigen Zwischenhaken in unguter Erinnerung geblieben.
Mit Willi habe ich beim damals noch üblichen Biwak an der 1600 Meter hohen Agnerkante (VI+ oder V+/A0) in der südöstlichen Palagruppe, in Daunenjacken gehüllt, einen Liter Wein getrunken. Mit ihm war ich am Abend des 31. Oktober 1972 in der Auronzohütte, nur der Trientiner Bergsteigerchor war noch zugegen. Es klingt ungeheuer kitschig, war aber berührend, als dieser weltberühmte Chor bei Kerzenlicht das Lied „La Montanara“ sang. Am nächsten Tag, an Allerheiligen, kletterten wir die Gelbe Kante (VI) an der Kleinen Zinne.
Mit Willi benötigte ich zwei Versuche an der 1400 Meter hohen Ortler-Nordwand. Beim ersten Mal 1970 war die Wetterprognose falsch und nach zwei Dritteln der Wand mussten wir wegen ständiger kleiner Lockerschneelawinen, die uns mitzureißen drohten, unter absturzgefährdeten Seracs biwakieren und am nächsten Tag wieder 1000 Höhenmeter absteigen. Wir hatten Abenteuer gesucht, das war uns dann aber doch zu viel. Beim zweiten Versuch ein Jahr später schafften wir diese beeindruckende Eiswand, meist gleichzeitig aufsteigend, in viereinhalb Stunden.

Mit Helmut Rott gelang mir 1969 die Winter-Erstbegehung der Fotscher Umrahmung. Dazu gehörten zwei lausig kalte Nächte im Biwak.
Anfang der 1970er-Jahre machte ich mit Willi diverse Winter-Erstbegehungen, darunter die Fotscher Umrahmung mit zwei Biwaks sowie am Patteriol den Nordostgrat (IV, eine Stelle V) und den alten Südostpfeiler (IV+) mit einem Biwak.
Und mit Joggl war ich im Karwendel, überschlagend führend, am Hechenbergpfeiler (VI+) bei Innsbruck unterwegs. In der Schmid-Krebs-Führe in der Laliderer Nordwand brach mir unter den Füßen in der dritten Seillänge führend ein Stein aus. Darauf führte nur noch Joggl, der die schwierigen, brüchigen und zudem noch von einem starken Regen nassen Stellen souverän meisterte.
SKIGESCHICHTEN
Der Schnee spielte in meinem Leben eine sehr wichtige Rolle. Das hat unter anderem damit zu tun, dass der Skilauf bei uns eine Familienangelegenheit war und aus meiner Verwandtschaft Skifahrer hervorgingen, die Geschichte geschrieben haben. Mein Großonkel Albert Weißenbach gewann laut Annalen des Skiklubs Arlberg anscheinend das erste Skirennen in St. Anton, irgendwann um 1900. Und meine Onkel Pepi und Franz Gabl, die Brüder meines Vaters, waren Mitglieder der österreichischen Skinationalmannschaft.
Onkel Franz war, wie dessen Brüder, im Zweiten Weltkrieg Soldat bei der Wehrmacht gewesen. Obwohl er mehrmals verwundet wurde und 1945 erst spät aus der russischen Gefangenschaft nach Hause kam, gewann er schon 1946 wieder Skirennen und später die erste olympische Medaille im Skisport für Österreich. Es war eine Silbermedaille im Abfahrtslauf bei den Olympischen Winterspielen 1948 in St. Moritz. Nur der Franzose Henri Oreiller war schneller als er. Das damalige Österreichische Olympische Comité (ÖOC) gratulierte Onkel Franz schriftlich zu seiner herausragenden Leistung, und als Belohnung wurden ihm fünf Kilo Reis und fünf Kilo Zucker, abzuholen in der Liechtensteinstraße 15 in Wien, zuerkannt. Ob er sie jemals abgeholt hat? Ich weiß es nicht. Zwar waren die Jahre nach dem Krieg entbehrungsreich, für diese Mengen Reis und Zucker aber bis nach Wien zu fahren, wäre doch ein ziemlicher Aufwand gewesen.
Nach der Ski-WM in Aspen blieb Onkel Franz in den Vereinigten Staaten, wo er als Trainer und Skilehrer arbeitete. Er starb im Januar 2014 im Alter von 93 Jahren in Bellingham im US-Bundesstaat Washington. Ich kannte ihn durch seine Besuche in der Heimat.
Onkel Pepi wurde während des Krieges in Sonthofen zum Jagdflieger ausgebildet. Er erzählte mir einmal, mehr als 40 Flugzeuge abgeschossen zu haben und dass er selbst ebenfalls dreimal in seinem Jagdflieger getroffen worden sei, glücklicherweise aber mit dem Fallschirm aussteigen habe können. Auch Pepi zog es nach Amerika, und auch er war Trainer und mehr als zwanzig Winter Skilehrer in Stowe in Vermont. Zu seinen Schützlingen gehörten Robert („Bob“) Kennedy, Jackie Kennedy, der ehemalige amerikanische Verteidigungsminister Robert McNamara und viele andere berühmte amerikanische Persönlichkeiten.
Gertrud, die sympathische, liebenswerte Tochter von Pepi, war die erfolgreichste Rennläuferin, die die Familie hervorgebracht hat. Im Jahr 1969 gewann sie, für den ÖSV startend, den Gesamtskiweltcup. Dicht auf den Fersen folgte ihr eine der Goitschel-Schwestern aus Frankreich. Weil bei den Männern Karl Schranz diese Trophäe einheimste, stammten in diesem Jahr beide Weltcupsieger aus einem Ort; eine Novität. Bis heute, fast fünfzig Jahre später, hat es das nicht mehr gegeben.
Wie meine Cousine ebenfalls im Österreichischen Nationalteam war mein Cousin Harald Rofner, ein gutes Jahr jünger als ich, mit dem mich seit Jahrzehnten eine intensive Freundschaft verbindet. Mit ihm spielte ich Fußball und ging Bergsteigen. Außerdem war Harald eine Art Ski-Mentor, wobei meine Skifahrkünste nicht mit seinen vergleichbar waren. Er hatte bei den Österreichischen Schüler- und Jugendmeisterschaften in allen drei Disziplinen – Abfahrt, Riesenslalom und Slalom – gewonnen. Einer seiner Fans war damals offenbar Manfred Scheuer, der bis 2016 Bischof von Innsbruck war. Bei einer Frühjahrsskitour, die ich mit Harald und ihm vor einigen Jahren unternahm, wusste der Bischof noch genau, in welchem Rennen Harald welchen Platz erreicht hat. Obwohl auch ich verfolgte, wie Harald sich bei den Rennen schlug – so genau erinnere ich mich nicht mehr an seine Platzierungen. Während Harald oder auch mein Nachbar Karle Cordin schon als Kinder von ihren Vätern betreut und trainiert wurden, war ich auf mich allein gestellt. Ich kann mich nur an einen Skiausflug auf den Galzig erinnern, den ich im Alter von sechs Jahren mit meinem Vater unternommen habe. Die Ausrüstung war zeitgemäß. Die Bindung meiner Skier hatte noch keinen Federstrammer vorne, stattdessen war der Strammer an der Ferse, und vorne bei der Schuhspitze gab es einen Lederriemen. Durch die Keilhosen aus Stoff, die in den Schuhen steckten, blies der kalte Wind hindurch, und dichter Nebel und Schneefall verhinderten eine gute Sicht. Mein Vater fuhr den Hang hinunter. Ich musste irgendwie hinterher. Da ich noch keinen Pflugbogen konnte, war die Abfahrt über die Kandaharstrecke nach St. Anton eine längere Tortur, garniert mit zahlreichen Stürzen. Aber ich ließ mich von meinen Tränen nicht entmutigen.
Meine Mutter war da offensichtlich weniger abgebrüht. Auch ihr wollte mein Vater auf seine ganz eigene Art das Skilaufen beibringen. Doch über einzelne Versuche kam sie nicht hinaus. Das wundert mich nicht. Vor ein paar Jahren sind mir ihre Ski in dem alten Kellergewölbe unseres Hauses in St. Anton wieder in die Hände gefallen. Offensichtlich waren Vater und Mutter noch nicht verheiratet, als sie schon miteinander Skifahren gingen. Denn in schönster Fraktur hatte mein Vater die Initialen „M. H.“ auf die Ski meiner Mutter gemalt: Marianne Hauzinger. Heute steht das alte Paar Skier in liebevoller Erinnerung in meinem Wohnzimmer. Aber ganz ehrlich: Mit diesen Brettern, die zwar schon Stahlkanten hatten, meine Mutter aber sicherlich mehr als einen halben Meter überragten, wäre ich auch keinen Hang hinunter gekommen.
Mit Walter Strolz ging es ab der ersten Volksschulklasse nach dem vormittäglichen Unterricht am Nachmittag zum Nassereiner Skilift. Neidvoll schaute ich auf Walter. Er hatte Skier der Firma Fischer mit einem farbigen Abziehbild auf der Skispitze, auf dem ein schwungvoller Skifahrer bei einem dynamischen Stemmschwung mit Stöcken mit großen Skitellern zu sehen war. Ich hingegen hatte einen in St. Anton von der Firma Pangratz hergestellten Ski aus Eschenholz, der bis auf einen kleinen farbigen Rand naturbelassen war, mit Stahlkanten und einem lackierten Belag, beides war damals – auch bei Kinderski – üblich. Bei einer unserer Schussfahrten aber, zu denen auch Mut gehörte – etwa wenn wir uns von der vorletzten Liftstütze beim Nassereiner Skilift in die Tiefe stürzten –, erwies es sich einmal, dass Skier aus einheimischer Produktion doch die bessere Wahl waren: Als Walter zu schnell über das Pillbachli fuhr, wurde sein Fischer-Ski gestaucht und brach. Mein Qualitätsski von Pangratz dagegen hielt auch der Belastung durch größere Bodenwellen stand.
Manchmal holten wir uns Weidenstöcke und steckten uns einige Slalomtore unterhalb des Weges vom Strolz-Haus zur Bahn hinunter. Nach der kurzen Fahrt traten wir im Treppenschritt wieder zum Weg hinauf. Trotz dieses Stangentrainings war ich beim Kinderskitag in St. Anton aber nie bei den Besten. Wahrscheinlich war der von meinem Vater am Vortag aufgemalte Belag nicht der richtige, aber auch die fehlende Unterstützung von zu Hause hat sicherlich etwas dazu beigetragen. Denn während die anderen von den Eltern gebracht und angefeuert wurden, musste ich mich alleine durchkämpfen.
Im Alter von zehn Jahren hatte ich bei einem Riesentorlauf, der über fast die gesamte Länge des damaligen Slalomhangskiliftes reichte, großes Pech. In meinem überschäumenden Eifer kam ich etwa 100 Meter vor dem Ziel bei einem Tor von der Rennstrecke ab und fiel neben einer Holzhütte, die bei uns in St. Anton „Pilla“ heißt, in einen Schneekolk, ein fast ein Meter tiefes Loch, das durch den Wind entstanden war. Verzweifelt krabbelte ich – viel Zeit verlierend – aus dem Loch heraus und fuhr ohne meine Mütze die letzten Tore ins Ziel. Abends war die Preisverteilung vor dem Eingang des Hotels Post. Als Preise gab es für die drei Schnellsten silberne Anstecknadeln in Form eines Skis und für weitere Plätze ein Kuchenstück. Traurig verlief die Preisverteilung für mich, denn als Achtplatzierter erhielt ich keinen Preis mehr. Für den siebten Platz gab es das letzte Stück köstliche Sachertorte. Dass ein paar andere Nachwuchsrennfahrer, die langsamer gewesen waren als ich, ebenfalls leer ausgingen, war damals kein Trost für mich.

Beim Stellarennen in Dalaas erreichte ich den ersten Platz. Eine besondere Herausforderung war der in Betrieb befindliche Skilift, der die Rennstrecke querte.
Im Gymnasium wurde das Skifahren für mich schwierig. Feldkirch, auf einer Seehöhe unter 500 Metern gelegen, war ein schneearmer Ort. Aber wenn doch einmal Schnee lag, konnte man am Mittwoch in der längeren Mittagspause im Obstanger der Stella, der zum Stadtschrofen hinauf führte, einige Schwünge machen. Oft bin ich auch mit geschulterten Skiern am Wochenende über die Westseite des Stadtschrofens und über den Letzehof die vier Kilometer lange Strecke bis nach Amerlügen gewandert und anschließend mit den Skiern abgefahren.

Beim Kinderskirennen in St. Anton. Wegen eines Sturzes landete ich nur auf dem achten Platz.
Am Faschingsdienstag fand jedes Jahr die Stellameisterschaft, ein Riesentorlauf, in Dalaas statt. Es war eine besondere Rennstrecke, die von der Bergstation des Skiliftes bis zur Talstation führte und an einer Stelle den in Betrieb stehenden Lift kreuzte. Mehrere Male bin ich Stellameister im Skilauf geworden. Sporadisch nahm ich auch an anderen Skirennen in Vorarlberg teil. Bei den Rennen des Vorarlberger Skiverbandes landete ich unter „ferner liefen“. Dagegen konnte ich bei den katholischen Jugendmeisterschaften in Buch den ersten Platz im Abfahrtslauf erringen. Wohlgemerkt, die Betonung liegt auf katholisch. Daraufhin wurde ich zu den katholischen Meisterschaften Österreichs in Piesendorf eingeladen. Dort traf ich auch Paul Tschol aus St. Anton, der immer der bessere Skiläufer war und auch bei diesen Meisterschaften bessere Platzierungen erreichte. Zur Rettung meiner Ehre muss ich erwähnen, dass mir mein Cousin Harald Rofner für diese Meisterschaften seine eigenen Rennskier zur Verfügung gestellt hatte. Diese Skier mit einer Länge von 210, 215 und 220 Zentimeter taten mit mir schmächtigem Skifahrer, was sie wollten. Daran konnten auch die meterlangen Lederriemen der Bindung nichts ändern.
Gerne nahm ich auch einige Jahre beim Rennen der Skischule St. Anton teil. Ganz vorne war ich aber nie. Beim Bundesheer in Landeck trat ich dem Heeressportverband bei und konnte einmal unter der Woche das Areal der Pontlatzkaserne verlassen, um beim schon längst stillgelegten Skilift Thial zu trainieren. Mein Trainingspartner war Bruno Traxl aus Flirsch, der spätere Kommandant des Gendarmeriepostens St. Anton und Bürgermeister von Flirsch. Gemeinsam nahmen wir an einigen Wochenenden auch an Skirennen von örtlichen Skiklubs teil. Bruno, der einige Monate jünger ist als ich, war noch in der Juniorenklasse startberechtigt. Ich startete bereits in der Allgemeinen Klasse, in einem unvergleichlich größeren, rivalisierenden Starterfeld. Obwohl ich, wie in Sautens auf der Strecke vom Ritzlerhof, meist wenige Zehntel schneller als Bruno war, landete er in der Juniorenklasse ganz vorne, ich in meiner Altersklasse immer hinten.

Obwohl ich erst einen Monat vorher mit dem Langlaufen begonnen hatte, erreichte ich beim Marcia Longa 1974 unter 10.000 Teilnehmern über die verkürzte Distanz von 50 km den 1076. Platz.
Ein Rennen mit Bruno in Strengen am Arlberg im Winter 1967 ist mir bis heute als einzigartig in Erinnerung geblieben. Die Rennstrecke führte vom Strenger Berg mit dem Start oberhalb von Perflör bis ins Ziel zum Dorf hinunter. Es gab keinen Skilift und die Einheimischen hatten einen großen Vorteil, da sie die Strecke kannten. Wir Auswärtigen fuhren mit dem Auto über die steilen und engen Bergwege zum Start und konnten nur einen Teil des Riesentorlaufes, der durch umzäunte Wiesen führte, einsehen. Schnelle Reaktionen waren gefragt, wenn man bei einem Gatter im Zaun das nächste Tor links, rechts oder unterhalb erspähte. Bruno stürzte und landete im geschlagenen Feld. Ich freute mich auf die Preisverteilung im Saal des Hotels Post in Strengen am späten Nachmittag, da ich ohne Sturz Bruno weit hinter meiner Zeit vermutete. Beim Vorlesen der Ergebnisliste wurde mein Gesicht länger und länger. Schließlich wurde ich 32-ster, fast eine halbe Minute hinter Bruno. Offensichtlich hatte mir der Zeitnehmer eine derart schnelle Zeit nicht zugetraut und prophylaktisch eine Minute dazugeschlagen. Ich bin zwar nicht nachtragend, aber bei meinen jährlich zahlreichen Besuchen auf der Skihütte des Strenger Ski- und Rodelklubs auf Dawin wird über meine hartnäckig vorgetragene Forderung nach Genugtuung immer herzlich gelacht.
Die Grundausbildung zu meinem Präsenzdienst absolvierte ich in der Kaserne in Absam. Unser diensthabender Unteroffizier war Vizeleutnant Kurt Waldegger, ein gebürtiger Nauderer. Alle Rekruten sahen einen Offizier, der überaus kompetent, korrekt, streng war und alle gleich behandelte. Es gab nie irgendwelche Schikanen. Außerdem erinnere ich mich noch gut an unseren Kompaniekommandanten Oberleutnant Rudolf Hinteregger, der später Kommandant des Truppenübungsplatzes Wattener Lizum war. Bei einer Schießübung mit dem Sturmgewehr schoss ein Soldat neben mir einige Male auf meine Scheibe, worauf ich meldete: „Herr Oberleutnant: Melde zehn Schuss und zwölf Treffer im Quadrat“. Das Schwierigste dabei war, bei dem erwarteten militärischen Ernst nicht in schallendes Gelächter auszubrechen. Nach der Grundausbildung wechselte ich in die Kaserne nach Landeck zur Tragtierkompanie. Mein Haflingerpferd „Dirndl“ war eines der schönsten Pferde mit einer prächtigen blonden Mähne. Ich bin heute noch stolz, den Umgang mit Pferden erlernt zu haben. Es ist sogar in meinem Wehrdienstbuch unter der Rubrik Wehrdiensteignung zu lesen: „Geeignet zum Tragtierführer“.
Im Winter, der auf den Wehrdienst folgte, begann ich bei der Skischule Arlberg in St. Anton als Aushilfsskilehrer, später als Landesskilehrer. Ich unterrichtete Skischüler vom Anfänger bis zu Fortgeschrittenen, einmal fuhr ich einige Tage mit einem früheren Mitglied der amerikanischen Skinationalmannschaft im hüfthohen Pulverschnee Ski. Gerne war ich auch in der Kinderskischule, die Rudolf Draxl, Ökonomierat, Landtagsabgeordneter und Landwirt, souverän leitete. „Onkel Rudi“, wie er von allen genannt wurde, war ein Organisationstalent. Das musste er auch sein, waren doch an Spitzentagen durchaus 600 Kinder in der Skischule.
Einmal, nach Ende des Skikurses, fuhr ich gemeinsam mit einem älteren, Englisch sprechenden Herrn den Slalomhang-Skilift hinauf. Wir kamen ins Gespräch, diskutierten über die Qualität des Schnees auf den Pisten und, neugierig wie ich war, stellte ich ihm auch private, persönliche Fragen, die er liebenswürdig beantwortete. Woher er komme, was er beruflich mache, wie es ihm in St. Anton gefalle. Wie sich herausstellte, lebte er in New York und war kein Geringerer als der weltberühmte Dirigent und Komponist Leonard Bernstein.
Das schwierigste Après-Ski erlebte ich in der Pension meines Onkels Pepi. Er hatte mich kurzfristig zum 5-Uhr-Tee zu sich beordert, um mit seiner Skischülerin Alexandra von Kent, Lady Ogilvy, geborene Windsor, die bei ihrer Geburt an sechster Stelle der englischen Thronfolge stand, Konversation zu machen. Die Unterhaltung war zäh, denn mit Prinzessin Alexandra konnte ich nicht einmal über das Wetter und schon gar nicht über das Skifahren sprechen.
Aber neben meinem Studium einige Wochen pro Winter als Skilehrer in der weltberühmten Skischule von Matt und Fahrner arbeiten zu dürfen, machte mir großen Spaß. Als die Leitung der Skischule wechselte, schied ich freiwillig aus.