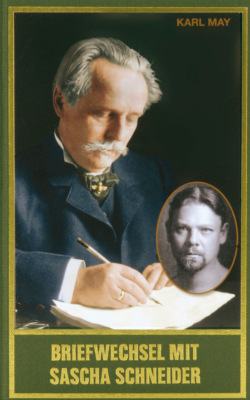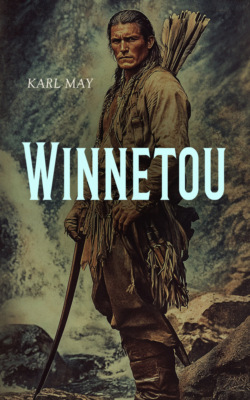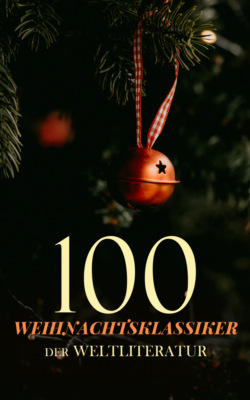Kitabı oku: «Winnetou 2», sayfa 13
Der Häuptling fragte uns, ob wir »speisen« wollten, und brachte uns wirklich einige Stücke sehniges Fleisch, welches vom Pferde stammte und »zugeritten« war. Wir dankten unter dem Vorgeben, daß wir noch mit Vorrat versehen seien, obgleich derselbe nur noch aus einem ziemlich kleinen Stücke Schinken bestand. Auch den Mann, weicher uns begleiten sollte, stellte er uns vor, und es bedurfte keiner geringen diplomatischen Kunst des Scout, ihn davon abzubringen. Er verzichtete endlich darauf, als der Alte ihm erklärte, daß es eine Beleidigung für solche weiße Krieger sei, ihnen einen Führer mitzugeben. Das tue man Knaben oder unerfahrenen und ungeschickten Männern an. Wir würden die Schar des »weißen Bibers« schon zu finden wissen. Nachdem wir noch unsere Ziegenschläuche mit Wasser gefüllt und einige Bündel Gras für unsere Pferde aufgeschnallt hatten, brachen wir nach einigen kurzen Abschiedsworten auf. Auf meiner Uhr war es vier.
Erst ritten wir langsam, um die Pferde in den Gang kommen zu lassen. Wir hatten noch grasigen Boden, doch wurde der Rasen immer dünner und unansehnlicher, hörte endlich ganz auf, und Sand trat an seine Stelle. Als wir die Bäume des Flußufers hinter uns nicht mehr sehen konnten, war es, als ob wir uns in der Sahara befänden: eine weite Ebene ohne die geringste Bodenerhebung, Sand, nichts als Sand und über uns die Sonne, die trotz der frühen Morgenstunde schon stechend niederschien.
»Nun können wir bald einen schnelleren Trab anschlagen,« meinte Old Death. »Wir müssen uns besonders am Vormittage sputen, weil wir da die Sonne hinter uns haben. Unser Weg geht genau nach Westen. Nachmittags scheint sie uns in das Gesicht; das strengt mehr an.«
»Kann man in dieser eintönigen Ebene, welche gar kein Merkzeichen bietet, nicht die Richtung verlieren?« fragte ich als angebliches Greenhorn.
Old Death ließ ein mitleidiges Lachen hören und antwortete:
»Das ist schon wieder eine Eurer berühmten Fragen, Sir. Die Sonne ist der sicherste Wegweiser, den es gibt. Unser nächstes Ziel ist der Turkey-Creek, ungefähr sechzehn Meilen von hier. Wenn es Euch recht ist, werden wir ihn in wenig über zwei Stunden erreichen.«
Der Scout ließ sein Pferd erst in Trab und dann in Galopp fallen, und wir taten dasselbe. Von jetzt an wurde nicht gesprochen. Jeder war darauf bedacht, seinem Pferde die Last zu erleichtern und es nicht durch unnötige Bewegungen anzustrengen. Eine Stunde verging, noch eine, während welcher wir die Tiere zuweilen eine Strecke weit Schritt gehen ließen, damit sie verschnaufen konnten. Da deutete Old Death vor sich hin und sagte zu mir:
»Seht nach Eurer Uhr, Sir! Zwei Stunden und fünf Minuten sind wir geritten, und da haben wir den Nueces vor uns. Stimmt es?«
Es stimmte allerdings.
»Ja, seht,« fuhr er fort, »das Zifferblatt liegt unsereinem sozusagen in den Gliedern. Ich will Euch sogar in finsterer Nacht sagen, wie viel Uhr es ist, und werde höchstens um einige Minuten fehlen. Das lernt Ihr nach und nach auch.«
Ein dunkler Streifen bezeichnete den Lauf des Flusses, doch waren keine Bäume, sondern nur Büsche vorhanden. Wir fanden leicht eine zum Übergange passende Stelle und kamen dann an den Turkey-Creek, welcher in dieser Gegend in den Rio Nueces mündet. Er hatte fast gar kein Wasser. Von da ging es nach dem Chico-Creek, den wir kurz nach neun Uhr erreichten. Sein Bett war ebenfalls fast trocken. Es gab nur hier und da eine schmutzige Lache, aus welcher ein armseliger Wasserfaden abwärts floß. Bäume oder Strauchwerk waren gar nicht vorhanden, und das spärliche Gras zeigte sich ganz vertrocknet. Am andern Ufer stiegen wir ab und gaben den Pferden Wasser aus den Schläuchen. Als Eimer wurde Will Langes Hut benutzt. Das mitgenommene Gras wurde von den Tieren schnell verzehrt, und dann ging es nach einer halbstündigen Rast wieder vorwärts nach dem Elm-Creek, unserm letzten Ziele. Auf dieser letzten Strecke zeigte sich, daß die Pferde ermüdet waren. Die kurze Rast hatte sie nur wenig gestärkt, und wir mußten im Schritt reiten.
Es wurde Mittag. Die Sonne brannte mit fast versengender Glut hernieder, und der Sand war heiß und so tief, daß die Pferde in demselben förmlich wateten. Das erschwerte das Vorwärtskommen. Gegen zwei Uhr stiegen wir abermals ab, um den Pferden den Rest des Wassers zu geben. Wir selbst tranken nicht. Old Death litt es nicht. Er war der Meinung, daß wir den Durst viel leichter als sie ertragen könnten, die uns durch diesen Sand zu schleppen hätten.
»Übrigens,« fügte er schmunzelnd hinzu, »habt ihr euch brav gehalten. Ihr wißt gar nicht, welche Strecken wir zurückgelegt haben. Ich sagte, daß wir erst am Abend am Elm-Creek sein wollten, aber wir werden ihn bereits nach zwei Stunden erreichen. Das ist ein Stückchen, welches uns nicht leicht Einer mit solchen Pferden nachmachen wird.«
Nun bog der Alte ein wenig von der westlichen Richtung nach Süden ab und fuhr fort:
»Ein wahres Wunder ist es, daß wir noch nicht auf die Fährte eines Comanchen gekommen sind. Sie haben sich jedenfalls mehr nach dem Flusse hingezogen. Welch eine Dummheit von ihnen, so lange Zeit nach dem entkommenen Apachen zu suchen. Wären sie stracks über den Rio Grande hinüber, so hätten sie die Feinde überrascht.«
»Sie werden sich sagen, daß sie das auch jetzt noch tun können,« meinte Lange, »denn wenn Winnetou mit dem Verwundeten nicht glücklich hinübergekommen ist, so haben die Apachen keine Ahnung, daß die verräterischen Comanchen ihnen so nahe sind.«
»Hm! Das ist nicht so ganz unrichtig, Sir. Grad der Umstand, daß wir die Letzteren nicht sehen, macht mich für Winnetou besorgt. Sie schwärmen nicht mehr, sondern sie scheinen sich zusammengezogen zu haben. Das ist ein für die beiden Apachen sehr ungünstiges Zeichen. Vielleicht sind sie ergriffen worden.«
»Was wäre in diesem Falle das Schicksal Winnetous?«
»Das entsetzlichste, was sich nur denken läßt. Er würde nicht etwa getötet oder während des Kriegszuges gemartert. Nein. Den berühmtesten Häuptling der Apachen gefangen zu haben, wäre für die Comanchen ein noch nie dagewesenes Ereignis, welches in würdiger, das heißt fürchterlicher Weise gefeiert werden müßte. Er würde unter sicherer Bedeckung heimgeschafft nach den Weideplätzen der Comanchen, wo nur die Frauen, Knaben und Alten zurückgeblieben sind.
Dort würde er außerordentlich gut gepflegt, so daß ihm nichts als die Freiheit fehlte, Die Frauen würden ihm jeden erfüllbaren Wunsch an den Augen ablesen. Wenn Ihr aber meint, daß es höchst freundlich von ihnen sei, den Gefangenen so gut zu pflegen, so irrt Ihr Euch ungeheuer. Man will den Gefangenen nur kräftigen, damit er später die Qualen so lange wie möglich zu ertragen vermag und nicht gleich bei der ersten Marter stirbt. Ich sage Euch, Winnetou müßte sterben, aber nicht schnell, nicht in einer Stunde, an einem Tage. Man würde seinen Körper mit wahrhaft wissenschaftlicher Vorsicht nach und nach zerfleischen, so daß viele Tage vergehen könnten, ehe der Tod ihn erlöste. Das ist ein eines Häuptlings würdiger Tod, und ich bin überzeugt, daß er bei all den ausgesuchten Qualen nicht eine Miene verziehen, sondern vielmehr seine Henker verspotten und verlachen würde. Es ist mir wirklich bange um ihn, und ich sage Euch aufrichtig, daß ich gegebenen Falls mein Leben wagen würde, ihn aus diesen Händen zu erretten, jedenfalls haben wir die Comanchen da westlich vor uns. Wir reiten etwas südlich ab, um zu meinem alten Freunde zu kommen, von welchem wir vielleicht erfahren werden, wie es am Rio Grande steht. Wir bleiben die Nacht bei ihm.«
»Werden wir willkommen sein?«
»Ganz selbstverständlich! Sonst würde ich ihn gar nicht als Freund bezeichnen. Er ist Ranchero, ein Landwirt, ein echter Mexikaner von unverfälschter spanischer Abkunft. Einer seiner Ahnen ist einmal von irgend wem zum Ritter geschlagen worden, und also bezeichnet auch er sich als einen Caballero, einen Ritter. Darum hat er auch seinem Rancho den wohlklingenden Namen Estanzia del Caballero gegeben. Ihn selbst habt Ihr Sennor Atanasio zu nennen.«
Nach diesen Erklärungen ging es wieder schweigend weiter. Unsere Pferde wieder in Galopp zu bringen, gelang uns nicht, sie sanken fast bis an die Knie in den Sand. Nach und nach aber nahm die Tiefe desselben ab, und ungefähr um vier Uhr nachmittags begrüßten wir das erste Gräschen. Dann kamen wir über eine Prairie, auf welcher berittene Vaqueros ihre Pferde, Rinder und Schafe bewachten. Unsere Tiere bekamen neues Leben; sie fielen von selbst in schnelleren Gang. Bäume erhoben sich vor uns, und endlich sahen wir etwas Weißes aus dem Grün uns entgegenschimmern.
»Das ist die Estanzia del Caballero,« sagte Old Death. »Ein ganz eigenartiges Bauwerk, genau nach dem Stile der Moqui- und Zunni-Bauten errichtet, die reine Festung, was in dieser Gegend sehr notwendig ist.«
Wir kamen näher an das Gebäude und konnten die Einzelheiten desselben erkennen. Eine doppelt mannshohe Mauer zog sich um dasselbe. Sie war mit einem hohen, breiten Tore versehen, vor welchem eine Brücke über einen tiefen, jetzt aber wasserleeren Graben führte. Das Gebäude hatte eine kubische Gestalt. Das Erdgeschoß konnten wir nicht sehen, da es von der Mauer vollständig verdeckt wurde. Das Stockwerk trat von demselben zurück, so daß rundum Raum zu einer Galerie verblieb, welche mit weißem Zeltleinen überdeckt war. Von einem Fenster bemerkten wir nichts. Auf diesem würfelförmigen Stockwerke lag ein zweites von derselben Form. Die Grundfläche desselben war wieder kleiner als die des vorhergehenden, so daß abermals eine Galerie entstand, welche durch Leinwand beschützt wurde. So bestanden Erdgeschoß, erstes und zweites Stockwerk aus drei Mauerwürfeln, von denen der höhere immer kleiner war als der tiefer liegende. Die Mauern waren weiß angestrichen; die Leinwand hatte dieselbe Farbe, weshalb das Gebäude weit hinaus in die Ferne leuchtete. Erst als wir näher kamen, bemerkten wir an jedem Stockwerke rundum laufende Reihen schmaler schießschartenähnlicher Maueröffnungen, welche als Fenster dienen mochten.
»Schöner Palast!« lächelte Old Death. »Werdet Euch über die Einrichtung wundern. Möchte den Indianerhäuptling sehen, der sich einbildet, dieses Haus erstürmen zu wollen!«
Nun ritten wir über die Brücke an das Tor, in welchem eine kleine Öffnung angebracht war. An der Seite hing eine Glocke, so groß wie ein Menschenkopf. Old Death läutete sie. Man konnte den Ton wohl über eine halbe Stunde weit hören. Bald darauf erschienen eine Indianernase und zwei wulstige Lippen an dem Loche. Zwischen den letzteren heraus ertönte es in spanischer Sprache:
»Wer ist da?«
»Freunde des Hausherrn,« antwortete der Scout. »Ist Sennor Atanasio zu Hause?«
Die Nase und der Mund senkten sich tiefer, zwei dunkle Augen schauten heraus, und dann hörten wir die Worte:
»Welche Freude! Sennor Death! Euch lasse ich natürlich sofort herein. Kommt, Sennores! Ich werde euch sofort melden.«
Wir hörten einen Riegel gehen; dann öffnete sich das Tor, und wir ritten ein. Der Mann, welcher uns geöffnet hatte, war ein dicker, ganz in weißes Leinen gekleideter Indianer, einer von den Indios fideles, das heißt gläubigen Indianern, welche sich im Gegensatze zu den wilden Indios bravos mit der Zivilisation friedlich abgefunden haben. Er schloß das Tor, machte eine tiefe Verneigung, schritt dann gravitätisch über den Hof hinüber und zog dort an einem an der Mauer herabhängenden Draht.
»Wir haben Zeit, das Haus zu umreiten,« sagte Old Death. »Kommt mit, euch das Bauwerk zu betrachten.«
Erst jetzt konnten wir das Erdgeschoß sehen. Auch an demselben zog sich eine Reihe kleiner Schießscharten rund um die vier Seiten. Das Gebäude stand in einem mauereingeschlossenen Hofe, der ziemlich breit und nicht gepflastert, sondern mit Gras bewachsen war. Außer den Schießscharten war kein Fenster zu sehen, und es gab auch keine Türe. Wir umritten das ganze Haus und kamen wieder an der vorderen Seite desselben an, ohne eine Türe gefunden zu haben. Der Indianer stand noch wartend da.
»Aber wie kommt man denn in das Innere des Gebäudes?« fragte Lange.
»Werdet es gleich sehen!« antwortete Old Death.
Da beugte sich von der auf dem Erdgeschoße befindlichen Galerie ein Mann herab, um nachzusehen, wer unten sei. Als er den Indianer sah, verschwand sein Kopf wieder, und dann wurde eine schmale, leiterähnliche Treppe herabgelassen, an welcher wir emporsteigen mußten. Wer nun der Ansicht gewesen wäre, daß es hier im ersten Stocke wenigstens eine Türe gebe, der hätte sich geirrt. Oben auf dem zweiten Geschoße stand wieder ein Diener, auch in Weiß gekleidet, welcher von da oben eine zweite Leiter herabließ, auf welcher wir auf der Höhe des Hauses ankamen. Diese Plattform bestand aus mit Sand bedecktem Zinkblech. In der Mitte befand sich ein viereckiges Loch, welches die Mündung einer in das Innere führenden Treppe bildete.
»So wurde bereits vor Jahrhunderten in den jetzigen indianischen Pueblos gebaut,« erklärte Old Death. »Niemand kann in den Hof. Und wenn es einem Feinde gelingen sollte, über die Mauer zu kommen, so ist die Treppe emporgezogen und er steht vor der türenlosen Mauer. In friedlichen Zeiten freilich kann man auch ohne Tor und Treppen herein- und heraufkommen, indem man sich auf das Pferd stellt und über die Mauer und auf die Galerie klettert. In Kriegszeiten aber möchte ich es keinem raten, dieses Experiment zu versuchen, denn man kann von dieser Plattform und der Galerie aus, wie ihr seht, die Mauer, das vor ihr liegende Terrain und auch den Hof mit Kugeln bestreichen. Sennor Atanasio wird an die zwanzig Vaqueros, Peons und Diener haben, von welchen jeder ein Gewehr besitzt. Wenn zwanzig solcher Leute hier oben ständen, müßten Hunderte von Indianern sterben, bevor der erste von ihnen über die Mauer käme. Diese Bauart ist hier an der Grenze von großem Vorteile, und der Haziendero hat mehr als eine Belagerung ausgehalten und glücklich abgewehrt.«
Man konnte von der Höhe des Hauses weit nach allen Seiten sehen. Ich bemerkte, daß hinter dem Hause, gar nicht weit von demselben entfernt, der Elm-Creck vorüberfloß. Er hatte ein schönes, klares Wasser, und es war kein Wunder, daß er Fruchtbarkeit nach beiden Seiten verbreitete. Sein schönes, klares Wasser erregte in mir das Verlangen, ein Bad in ihm zu nehmen.
Wir stiegen, von einem Diener geführt, die Treppe hinab und gelangten da auf einen langen, schmalen Korridor, welcher vorn und hinten durch je zwei Schießscharten erleuchtet wurde. Zu beiden Seiten mündeten Türen, und am hinteren Ende ging eine Treppe in das Erdgeschoß hinab. Um vom Hofe aus in dieses zu gelangen, mußte man also außen am Gebäude zwei Treppen hinauf- und im Innern desselben wieder zwei Treppen hinabsteigen. Es erschien mir das sehr umständlich, war aber in den Verhältnissen der Gegend wohlbegründet. Der Diener verschwand hinter einer Türe und kehrte erst nach einiger Zeit zurück, um zu melden, daß Sennor der Capitano de Caballeria uns erwarte. Während dieser Wartezeit hatte Old Death uns auf etwas aufmerksam gemacht:
»Nehmt es meinem alten Sennor Atanasio nicht übel, wenn er euch ein wenig förmlich empfängt. Der Spanier liebt die Etikette, und der von ihm abstammende Mexikaner hat das behalten. Wäre ich allein gekommen, so wäre er mir längst entgegengeeilt. Da aber Andere dabei sind, so gibt es jedenfalls einen Staatsempfang. Lächelt ja nicht, wenn er etwa in Uniform erscheint! Er bekleidete in seinen jungen Jahren den Rang eines mexikanischen Rittmeisters und zeigt sich noch heutigen Tages gern in seiner alten, längst antik gewordenen Uniform. Im übrigen ist er ein Prachtkerl.«
Jetzt kam der Diener, und wir traten in ein wohltuend kühles Gemach, dessen einst wohl kostbares Meublement jetzt vollständig verblichen war. Drei halbverschleierte Schießscharten verbreiteten ein gedämpftes Licht. Inmitten des Zimmers stand ein langer, hagerer Herr mit schneeweißem Haar und Schnurrbart. Er trug rote, mit breiten Goldborten besetzte Hosen, hohe Reiterstiefel aus blitzendem Glanzleder mit Sporen, deren Räder die Größe eines silbernen Fünfmarkstückes hatten. Der Uniformfrack war blau und reich mit goldenen Bruststreifen verziert. Die goldenen Epauletten deuteten auf den Rang nicht eines Rittmeisters, sondern eines Generals. An der Seite hing ihm ein Säbel in stählerner Scheide, deren Schnallenhalter auch vergoldet waren. In der Linken hielt er einen Dreispitzhut, dessen Spitzen von goldenen Raupen strotzten; an der Seite war eine schillernde Agraffe befestigt, welche einen bunten Federstutz trug. Das sah aus wie Maskerade. Aber wenn man in das alte, ernste Gesicht und das noch frische, gütig blickende Auge sah, konnte man es nicht über das Herz bringen, heimlich zu lächeln. Als wir eingetreten waren, schlug er die Absätze sporenklirrend zusammen, richtete sich stramm empor und sagte:
»Guten Tag, meine Herren! Ihr seid sehr willkommen!«
Das klang sehr steif. Wir Andern verbeugten uns stumm. Old Death antwortete ihm in englischer Sprache:
»Wir danken, Sennor Capitano de Caballeria! Da wir uns in dieser Gegend befanden, so wollte ich meinen Begleitern gern die ehrenvolle Gelegenheit geben, Euch, den tapfern Streiter für Mexikos Unabhängigkeit, kennen zu lernen. Gestattet, sie Euch vorzustellen!«
Bei diesen schmeichelhaften Worten ging ein befriedigtes Lächeln über das Gesicht des Haziendero. Er nickte zustimmend und sagte:
»Tut es, Sennor Death! Es ist mir eine große Freude, die Sennores kennen zu lernen, welche Ihr zu mir bringt.«
Old Death nannte unsere Namen, und der Caballero reichte jedem von uns, sogar dem Neger die Hand und lud uns dann zum Sitzen ein. Der Scout fragte nach Sennora und Sennorita, worauf sofort der Haziendero eine Türe öffnete und die beiden schon bereit stehenden Damen eintreten ließ. Die Sennora war eine sehr schöne, freundlich dreinschauende Matrone, die Sennorita ein liebliches Mädchen, ihre Enkelin, wie wir später erfuhren. Beide waren ganz in schwarze Seide gekleidet, als ob sie soeben im Begriffe gestanden hätten, bei Hof zu erscheinen. Old Death eilte auf die Damen zu und schüttelte ihnen die Hände so herzhaft, daß mir bange wurde. Die beiden Langes versuchten es, eine Verbeugung zu stande zu bringen. Sam grinste am ganzen Gesichte und rief:
»O Missis, Missus, wie schön, wie Seide!«
Ich trat auf die Sennora zu, nahm ihre Hand auf die Spitzen meiner Finger, bückte mich auf dieselbe und zog sie an die Lippen. Die Dame nahm meine Höflichkeit so wohlwollend auf, daß sie mir ihre Wange darreichte, um auf derselben den Beso de cortesta, den Ehrenkuß, zu empfangen, was eine große Auszeichnung für mich war. Ganz dasselbe wiederholte sich bei der Sennorita. Nun wurde wieder Platz genommen. Natürlich kam die Rede sofort auf den Zweck unseres Rittes. Wir erzählten das, was wir für nötig hielten, auch unser Zusammentreffen mit den Comanchen. Die Herrschaften hörten uns mit der größten Aufmerksamkeit zu, und ich bemerkte, daß sie einander bezeichnende Blicke zuwarfen. Als wir geendet hatten, bat Sennor Atanasio um eine Beschreibung der beiden Männer, welche wir suchten. Ich zog die Photographien hervor und zeigte sie ihnen. Kaum hatten sie dieselben gesehen, so rief die Sennora-.
»Sie sind es, sie sind es! Ganz gewiß! Nicht wahr, lieber Atanasio?«
»Ja,« stimmte der Caballero bei, »sie sind es wirklich. Sennores, die Männer waren in vergangener Nacht bei mir.«
»Wann kamen und wann gingen sie?« fragte der Scout.
»Sie kamen spät des Nachts und waren ganz ermüdet. Einer meiner Vaqueros hatte sie getroffen und brachte sie mir. Sie schliefen sehr lang und erwachten erst nach der Mittagszeit. Es ist drei Stunden her, daß sie fort sind.«
»Schön! So holen wir sie morgen sicher ein. Wir werden ihre Spur jedenfalls finden.«
»Gewiß, Sennor, werdet Ihr das. Sie wollten von hier aus nach dem Rio Grande, um denselben oberhalb des Eagle-Passes, ungefähr zwischen dem Rio Moral und dem Rio las Moras zu überschreiten. Übrigens werden wir noch von ihnen hören. Ich habe ihnen einige Vaqueros nachgeschickt, welche Euch ganz genau sagen werden, wohin sie geritten sind.«
»Warum habt Ihr ihnen diese Leute nachsenden müssen?«
»Weil diese Menschen mir meine Gastfreundschaft mit Undank belohnt haben. Sie haben mir, als sie fortgeritten sind, den Vaquero einer Pferdetruppe mit einer fingierten Botschaft gesandt und während seiner Abwesenheit sechs Pferde gestohlen, mit denen sie eiligst fort sind.«
»Schändlich! So waren die beiden Männer nicht allein?«
»Nein. Es war eine Schar verkleidetet Truppen bei ihnen, welche angeworbene Rekruten nach Mexiko zu bringen hatten.«
»So glaube ich nicht, daß Eure Leute die Pferde wiederbringen werden. Sie sind zu schwach gegen diese Diebe.«
»O, meine Vaqueros wissen ihre Waffen zu gebrauchen, und ich habe die energischsten Kerls ausgewählt.«
»Haben Gibson und William Ohlert von ihren Verhältnissen und Plänen gesprochen?«
»Kein Wort. Der Erstere war sehr lustig und der Letztere sehr schweigsam. Ich schenkte ihnen alles Vertrauen. Ich wurde gebeten, ihnen die Einrichtung meines Hauses zu zeigen, und da haben sie sogar den verwundeten Indianer gesehen, den ich vor jedermann verstecke.«
»Ein verwundeter Roter? Wer ist er, und wie kommt Ihr zu ihm?«
Der Caballero ließ ein überlegenes Lächeln sehen und antwortete:
»Ja, das ist sehr interessant für euch, Sennores! Ich beherberge nämlich den Unterhändler der Apachen, von dem Ihr vorhin erzähltet, welchen Winnetou droben am Rio Lena verbunden hat. Es ist der alte Häuptling Inda-nischo.«
Anda-nischo, der »gute Mann«, welcher diesen Namen mit Recht trägt! Der älteste und klügste, friedliebendste Häuptling der Apachen! Den muß ich sehen.«
»Ich werde ihn Euch zeigen. Er kam in einem sehr schlimmen Zustande bei mir an. Ihr müßt wissen, daß der berühmte Winnetou mich kennt und stets bei mir einkehrt, wenn er in diese Gegend kommt, denn er weiß, daß er mir vertrauen darf. Er hatte von Fort Inge aus den andern Häuptling eingeholt. Dieser hatte eine Kugel in den Arm und eine zweite in den Schenkel bekommen. Am Rio Lena hat Winnetou ihn verbunden; und dann sind sie sofort wieder aufgebrochen. Aber den alten, verletzten Mann hat das Wundfieber gewaltig gepackt, und die Comanchen sind quer durch die Wüste geschwärmt, um ihn aufzufangen. Wie Winnetou es fertig gebracht hat, ihn trotz dieser Hindernisse bis hierher zu meiner Estanzia del Caballero zu bringen, das ist mir noch jetzt ein Rätsel, so etwas kann eben nur Winnetou leisten. Aber hier ging es nicht weiter, denn Inda-nischo hatte sich nicht mehr im Sattel halten können, so schwach war er gewesen und so hatte ihn das Fieber geschüttelt. Er hatte sehr viel Blut verloren gehabt und ist über siebzig Jahre alt.«
»Man sollte es nicht für möglich halten! Von Fort Inge bis hierher bei solchen Wunden im Sattel zu bleiben! Der Weg, den sie geritten sind, beträgt mehr als hundertsechzig englische Meilen. Bei so einem Alter kann das nur ein Roter aushalten. Bitte, weiter!«
»Er kam des Abends hier an und läutete. Ich ging selbst hinab und erkannte Winnetou. Er erzählte mir alles und bat mich, seinen roten Bruder in Schutz zu nehmen, bis er abgeholt werde; er selbst müsse schleunigst über den Rio Grande, um seine Stämme von dem Verrate und der Annäherung der Comanchen zu benachrichtigen. Ich gab ihm meine beiden besten Vaqueros mit, um zu erfahren, ob es ihm gelingen werde, durchzukommen. Sie sollten ihn begleiten und mir dann Nachricht bringen.«
»Nun,« fragte Old Death gespannt. »Ist er dann hinüber?«
»Ja. Und das hat mich außerordentlich beruhigt. Er ist sehr klug gewesen und nicht oberhalb des Rio Moral, wo die Comanchen stehen, sondern unterhalb desselben über den Rio Grande gegangen. Freilich gibt es dort keine Furt; der Fluß ist sehr reißend, und es ist ein lebensgefährliches Wagnis, hindurch zu schwimmen. Trotzdem sind meine Vaqueros mit ihm hinüber und haben ihn noch soweit begleitet, bis sie Sicherheit hatten, daß er den Comanchen nicht mehr begegnen könne. Nun hat er die Apachen benachrichtigt, und diese werden die Feinde richtig empfangen. Jetzt aber kommt mit zu dem alten Häuptling, wenn es euch recht ist, Sennores.«
Alle standen auf. Wir verabschiedeten uns von den Damen und stiegen in das tiefere Geschoß. Unten angekommen, befanden wir uns in einem ganz ähnlichen wie dem oberen Korridore. Wir traten durch die hinterste Türe links im Korridore.
Da lag in einem sehr kühlen Raume der alte Häuptling. Das Fieber hatte nachgelassen, aber er war so schwach, daß er kaum sprechen konnte. Die Augen lagen tief in ihren Höhlen, und die Wangen waren eingefallen. Einen Arzt gab es nicht; aber der Caballero sagte, Winnetou sei ein Meister in der Behandlung von Wunden. Er habe heilsame Kräuter aufgelegt und streng verboten, die Verbände zu öffnen. Sobald das Wundfieber vorüber sei, habe man nichts mehr für das Leben des Kranken zu befürchten, für welchen nur der starke Blutverlust und das Fieber gefährlich seien. Als wir die Türe wieder hinter uns und die Treppen vor uns hatten, sagte ich dem Haziendero, daß ich ein Bad im Flusse zu nehmen wünschte.
»Wenn Ihr das wollt, so braucht Ihr garnicht erst die Treppen zu steigen,« meinte er. »Ich lasse Euch gleich hier unten in den Hof hinaus.«
»Ich denke, es gibt keine Türen!«
»O doch, aber heimliche. Ich habe sie anbringen lassen, um einen Fluchtweg zu haben, falls es feindlichen Roten je einmal gelingen sollte, in das Haus zu dringen. Ihr sollt sie gleich sehen.«
Es stand ein Schränkchen an der Mauer; er schob es fort, und ich sah eine Öffnung, welche nach dem Hofe führte. Sie war draußen durch ein zu diesem Zwecke aufgepflanztes Buschwerk verdeckt. Er führte mich hinaus, zeigte auf die gegenüberliegende Stelle der Außenmauer, an welcher ähnliches Gesträuch stand, und fuhr fort:
»Dort geht es hinaus ins Freie, ohne daß ein Fremder es ahnen kann. Wollt Ihr dies als den kürzesten Weg zum Flusse benutzen? Wartet aber ein wenig hier! Ich will Euch einen bequemen Anzug schicken.«
In diesem Augenblicke wurde die Glocke am Tore geläutet. Er ging selbst hin, um zu öffnen, und ich folgte ihm. Es waren fünf Reiter, prächtige kraftvolle Gestalten, die Leute, welche er den Pferdedieben nachgeschickt hatte.
»Nun?« fragte er. »Ihr habt die Pferde nicht?«
»Nein,« antwortete einer. »Wir waren ihnen bereits ganz nahe. Sie hatten unsern Fluß eben überschritten, und wir sahen aus den Spuren, daß wir sie in einer Viertelstunde einholen mußten. Da aber kamen wir plötzlich auf eine Fährte von vielen Pferden, welche von rechts her mit der ihrigen zusammenfiel. Sie waren also mit den Comanchen zusammengestoßen. Wir folgten ihnen nach und bald sahen wir alle vor uns. Es waren weit über fünfhundert Comanchen, und an eine solche Übermacht konnten wir uns nicht wagen.«
»Ganz recht. Das Leben sollt ihr nicht an einige Pferde setzen. Haben die Comanchen die Weißen freundlich behandelt?«
»Um das zu erkennen, konnten wir nicht weit genug an sie heran.«
»Wie ritten sie?«
»Gegen den Rio Grande.«
»Also von hier aus vorwärts. So haben wir nichts zu fürchten. Es ist gut. Geht zu euren Herden!«
Sie ritten fort. Der gute Caballero befand sich in einem großen Irrtume. Es war viel zu fürchten, denn die Comanchen hatten von Gibson, wie wir dann erfuhren, gehört, daß der verwundete Apachenhäuptling sich auf der Hazienda del Caballero befinde. Infolge davon hatten sich sofort eine Anzahl roter Krieger aufgemacht, im schärfsten Galoppe nach der Hazienda zu reiten, um den Häuptling gefangen zu nehmen und Sennor Atanasio für seine apachenfreundliche Gesinnung zu bestrafen, Der Letztere stieg ruhig die Treppe empor, und bald kam ein Peon herab, welcher mich bat, mit ihm zu kommen. Er führte mich zum Tore hinaus und an den Fluß. Oberhalb der Hazienda war eine Furt, wie man an den Brechungswellen des Wassers sah. Unterhalb dieser Furt aber war der Strom sehr tief. Da blieb der Peon stehen. Er hatte einen weißleinenen Anzug auf dem Arme.
»Hier Sennor,« sagte er. »Wenn Ihr gebadet habt, zieht Ihr diesen Anzug an; die Kleidungsstücke, welche Ihr jetzt ablegt, kann ich gleich mitnehmen. Wenn Ihr das Bad beendet habt, so läutet die Glocke; man wird Euch öffnen.«
Er entfernte sich mit meinen Kleidern, und ich sprang in das Wasser. Nach der Hitze des Tages und der Anstrengung des Rittes war es eine wahre Wonne, im tiefen Strome zu tauchen und zu schwimmen. Wohl über eine halbe Stunde war ich im Wasser gewesen, als ich es endlich verließ und den Anzug anlegte. Eben war ich damit fertig, als mein Blick auf das gegenüberliegende Ufer fiel. Zwischen die Bäume hindurch konnte ich von meiner Stelle aus nach aufwärts blicken, wo der Fluß eine Krümmung machte. Da sah ich eine lange Schlange von Reitern kommen, einer hinterdem andern, wie die Indianerso gern reiten. Schnell rannte ich nach dem Tore und läutete. Der Peon, welcher auf mich gewartet hatte, öffnete.
»Schnell zum Caballero!« sagte ich. »Indianer kommen von jenseits des Flusses auf die Hazienda zu.«
»Wie viele?«
»Wohl über fünfzig.«
Der Mann war bei meinen ersten Worten sichtlich erschrocken; als ich ihm jetzt diese Zahl nannte, nahm sein Gesicht einen beruhigteren Ausdruck an.
»Nicht mehr?« fragte er. »Nun, da haben wir ja nichts zu befürchten. Mit fünfzig und auch noch mehr Roten nehmen wir es schon noch auf, Sennor. Wir sind jederzeit auf so einen Besuch vorbereitet. Ich kann nicht hinauf zum Caballero, denn ich muß den Vaqueros augenblicklich Nachricht bringen. Hier habt Ihr Eure Sachen wieder, die ich doch nicht mitnehmen kann. Riegelt hinter mir das Tor zu, und eilt zu Sennor Atanasio. Zieht aber hinter Euch die Treppen empor!«
»Wie steht es mit unsern Pferden? Sind dieselben in Sicherheit?«
»Ja, Sennor. Wir haben sie hinaus zu den Vaqueros geschafft, damit sie weiden können. Das Lederzeug aber wurde in das Haus getragen. Die Tiere können Euch nicht genommen werden.«
Jetzt eilte er fort. Ich schloß hinter ihm das Tor und stieg die beiden Treppen hinauf, die ich natürlich hinter mir emporzog. Eben als ich auf die Plattform kam, sah ich Sennor Atanasio mit Old Death aus dem Innern des Hauses auf derselben erscheinen. Der Haziendero erschrak nicht im mindesten, als ich ihm die Ankunft der Indianer und die Anzahl derselben meldete. Er fragte mich sehr ruhig: