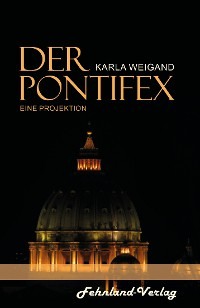Kitabı oku: «Der Pontifex», sayfa 5
„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“
(Psalm 103, 2)
In einem Punkt zumindest irren die Menschen nicht: Der Papst verfolgt tatsächlich einen Plan. Und diesen auch schon über sehr lange Zeit. Schwester Monique weiß nur in etwa und leider auch nur sehr bruchstückhaft darüber Bescheid.
Der Schwur eines sechsjährigen Jungen auf dem sogenannten „Schwarzen Kontinent“ im Jahre 1894 ist bei Seiner Heiligkeit noch keineswegs vergessen. Wurde er in seiner Familie doch über mehrere Generationen tradiert. Einem einstmals geschundenen Volk sollte, wenn auch spät, Genugtuung verschafft werden für zugefügte Schmach. Diejenigen, die sich damals anmaßten, die Herren zu sein, später deren Erben, sollten zur Rechenschaft gezogen werden und dafür büßen, was ihre Vorfahren einst verbrochen hatten.
„Im ehemaligen Deutsch-Ostafrika ist bisher in dieser Richtung noch so gut wie gar nichts geschehen!“, bemängelt Papst Leo nicht zum ersten Mal. „Im Westen des Schwarzen Kontinents ist man ein kleines bisschen eher zur Sache gekommen – wenn auch nicht allzu nachdrücklich.
Immerhin hat man sich vor gut zwanzig Jahren zu einer eher halbherzigen Schadensersatzklage wegen des Genozids der Deutschen vor mehr als einem Jahrhundert durchgerungen. In Namibia reichten die Nachfahren der Völkermordopfer vor einem Gericht in New York Klage ein, nachdem sie sich endlich ein Herz gefasst hatten.“
„Wieso in Amerika?“, wundert sich Schwester Monique. „Was haben denn die Amerikaner damit zu tun – außer dass sie in ihrem eigenen Land selbst Sklavenhalter gewesen sind?“
„Nach einem entsprechenden Gesetz können in den USA Ansprüche von Ausländern geltend gemacht werden, auch wenn die Ereignisse nicht auf dem Boden der USA stattgefunden haben“, bekommen die Schwestern Monique, zweiundvierzig, und ihre Nichte Angélique, vierundzwanzig Jahre alt, zu hören.
Auch letztere eine Klosterfrau des Ordens der Kleinen Schwestern Jesu – und genauso wenig mit Leo XIV. nahe verwandt wie ihre Tante Monique … Die Ordensfrau Monique hatte ihre Äbtissin gebeten, ihre Nichte zu sich holen zu dürfen, um sich in der fremden Umgebung nicht so verlassen zu fühlen.
„Auch das heutige Namibia war einmal eine deutsche Kolonie. Bei Massakern am Volk der Herero und der Nama wurden zwischen den Jahren 1904 und 1908 mehr als einhunderttausend Menschen von den Deutschen getötet.“
So detailliert wussten das beide Frauen bisher nicht.
„Aber die Deutschen haben es immer verstanden“, fährt Leo XIV. fort, „entsprechende Forderungen nach Wiedergutmachung abzuschmettern und stattdessen die Nachfahren der Opfer mit lahmen und vor allem billigen Entschuldigungen abzuspeisen. Und auch das nur nach massivem psychologischem Druck – im eigenen Land übrigens …
Außerdem glaubte man, erst in Bonn, später in Berlin, durch das Gewähren von ‚großzügiger Entwicklungshilfe’ sei man sowieso aus jeder weiteren Verantwortung entlassen und vor finanziellen Regressansprüchen sicher.“
Aus jedem Wort, das der Heilige Vater zu diesem traurigen Themenkomplex äußert, spricht sein Groll über jene über Generationen hinweg tradierte ohnmächtige Wut der indigenen Bevölkerung. Zum Teil kann ihn Monique verstehen – aber eben nur zum Teil. Wie steht es mit der von Christen geforderten Vergebung? „So dich einer auf die rechte Wange schlägt, reich’ ihm auch die linke dar!“
Hatte sich nicht der Gründer ihrer Religion selbst in diesem Sinne geäußert? Für den Heiligen Vater scheint das keine Rolle zu spielen.
„Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes in Jesus Christus.“
(Römer 8, 38f.)
Über vieles kann Schwester Monique mit dem Heiligen Vater sprechen, nur nicht über ihr Intimleben, das zu ihrem Leidwesen nicht mehr stattfindet – immer noch nicht. Geschickt versteht es Leo, ihre diesbezüglichen zaghaften Versuche abzublocken und andere Themen anzuschneiden. Außerdem bittet er sie so gut wie nicht mehr, ihn am späten Abend in seinen Gemächern aufzusuchen …
Es kommt der jungen Frau allmählich vor, als sei für ihn das jahrelange intime Zusammensein mit ihr nur Mittel zum Zweck gewesen, quasi der Motor, der ihn angetrieben habe, um sein ehrgeizigstes Ziel zu erreichen: den Papstthron.
Nachdem er diesen errungen hat, scheint er diesen Motor nicht mehr zu benötigen. Für seine nunmehrigen Vorhaben, denen Monique, soweit sie davon, wenn auch nur lückenhaft, Kenntnis besitzt, scharf ablehnend gegenübersteht, bedarf Seine Heiligkeit offenbar anderer „Antriebsmaschinen“, als sie es ist.
‚Den größten Teil seiner kargen Freizeit verbringt Maurice nicht mehr mit mir, sondern mit afrikanischen ‚Freunden’, die er vorher nicht hatte, ja, meist nicht einmal gekannt hat’, muss sie enttäuscht erkennen. Eine Tatsache, die sie traurig macht, aber auch ein wenig wütend. Ausgesperrt und zunehmend übergangen fühlt sie sich; ja, im Grunde genommen als Betrogene.
Zu Anfang, während der Phase ihrer Eingewöhnung in Italien, plagte Monique zudem die Eifersucht auf die um etwa zwanzig Jahre jüngere Angélique, die sie doch selbst gebeten hatte, sie in „die Fremde“ zu begleiten. Sie überlegte bereits, wie sie ihrer jungen hübschen Verwandten den Aufenthalt im Vatikan wieder vergällen könnte, um die junge Nonne zu veranlassen, sich wegen „starken Heimwehs“ um die Rückkehr in ihr Kloster in Ghanumbia zu bemühen.
Bis Schwester Monique erkannt hat, dass sie sich gewaltig irrte, sind etliche Wochen vergangen, während denen sie Seine Heiligkeit und ihre Cousine mit Argusaugen beobachtete.
Jetzt weiß sie definitiv, dass weder von seiner noch von Angéliques Seite ein Interesse besteht, neben einem rein freundschaftlichen ein sexuelles Verhältnis zu beginnen.
* * *
Statt Zeit mit seiner schönen Geliebten zu verbringen, lässt es sich der Heilige Vater angelegen sein, im Tagebuch seines Vorfahren zu lesen. Der Text ist ihm zwar keineswegs neu, aber er empfindet bei der Lektüre eine gewisse Befriedigung: bietet sie ihm doch die Bestätigung der Recht- und Verhältnismäßigkeit seines Vorhabens …
Maurice Obembe, seine Mutter Mtaga, mit dem ihr von den neuen Herren aufgezwungenen „weißen“ Namen Elisa, seine Geschwister und die übrigen der Gruppe versteckten sich nach etlichen Wochen, Ende Juli 1894, am Rande des Urwalds wie waidwunde Antilopen im dichten Gebüsch.
Nach wie vor meidet Elisa die auf Lichtungen errichteten Dörfer sowie die Klöster. Sprüche wie aus einem „Römerbrief“, den ihr die Mönche vor Jahren ans Herz legten, der von der untrennbaren Liebe zu Gott sprach, empfindet sie mittlerweile als Hohn. Um solches nie mehr hören zu müssen, nimmt sie auch weite Umwege in Kauf.
Um das aufkommende Murren in der Gruppe zu unterbinden, hämmert sie den Erschöpften immer wieder aufs Neue ein: „Die Gefahr, von verängstigten Dorfältesten oder liebedienerischen Klosterbrüdern in vorauseilendem Gehorsam an die weißen ‚Herren’ verraten zu werden, ist nach wie vor sehr hoch, meine lieben Mitschwestern!“
Als sie verständnislose Blicke erntet, erklärt sie es mit einfachen Worten: „Wollt ihr riskieren, von den Weißen wieder eingefangen und versklavt zu werden? Nein? Also, dann mault gefälligst nicht, sondern nehmt eure Beine in die Hand und folgt mir nach!“
Papst Leo ist aufgewühlt und erregt. Ruhelos nimmt er die Wanderung in seinem Schlafzimmer wieder auf, vom Bett zu den Fenstern, zurück zur Tür, dann erneut zu den Fenstern, um in den Nachthimmel zu spähen. Der ist allerdings verhangen; kein Stern lässt sich blicken.
Er fühlt sich, als sei er selbst der sechsjährige Sohn Elisas, der als junger Mann seine Erlebnisse in der dritten Person niedergeschrieben hat. Er verspürt die nächtliche Kälte, die durch seine dünne Kleidung dringt, die Feuchtigkeit, die die dschungelähnliche Vegetation bei Nacht ausdünstet und er meint, die lauten nächtlichen Geräusche des Urwalds zu vernehmen. Vor allem hört er das Tappen nackter Füße oder das Patschen von den Sohlen primitiver Strohsandalen. Vor allem aber spürt er die Vibrationen des nachgiebigen Waldbodens, der unter den Tritten der Flüchtigen leicht zu schwanken scheint.
Abrupt beendet Leo das Auf- und Abgehen und sucht erneut sein Bett auf. Beinahe zwanghaft wendet der einsame schwarze Mann sich erneut der traurigen Lektüre zu.
KREUZZEICHEN
„ … und des Heiligen Geistes. Amen!“
Trotz aller Vorsicht werden die Flüchtigen, erschöpft von Angst, Schlafmangel, stechenden Insekten und quälendem Hunger, schließlich doch noch von schwarzen Soldaten der deutschen Kolonialmacht aufgespürt.
Rasch werden sie überwältigt, gefesselt und teilweise geknebelt. Man beschimpft und misshandelt sie mit Fußtritten und Ohrfeigen, auch ein paar sichtlich Schwangere. Vor allem die jungen Frauen und Mädchen laufen Gefahr, von den Soldaten der „Schutztruppe“ vergewaltigt zu werden, „nach gutem altem Siegerbrauch“, bei dem ganz selbstverständlich das Recht des Stärkeren gilt.
Normalerweise drücken die weißen Offiziere, sobald eine Schwarze geschändet wird, ein Auge zu oder schauen lieber gleich ganz weg. Nicht selten „reservieren“ sie auch die hübschesten Negermädchen für sich selbst …
Dieses Mal allerdings schreitet der militärische Vorgesetzte zum Erstaunen der Gefangenen und zur Enttäuschung seiner Soldaten dagegen ein.
„Lasst eure Finger von den Weibern! Ich dulde keinerlei Belästigungen von gefangenen Frauen und Mädchen. Bei Zuwiderhandlungen werde ich hart durchgreifen und die Täter streng bestrafen!“, bekommen die Männer zu ihrem Unmut zu hören.
Dieses Mal finden keine sexuellen Übergriffe statt und die Soldaten müssen den Gefangenen sogar die Knebel wieder abnehmen, worauf sofort lautes Jammern zu hören ist: Soll etwa das erbärmliche Häuflein der Unglücklichen, mit Stricken aneinandergefesselt, dorthin zurückgetrieben werden, woher es vor Tagen geflohen ist?
Gegen Ende der schier endlosen Treibjagd ist es Maurice so vorgekommen, als habe sich der bis zum Umfallen erschöpften Mütter und Frauen eine Art von freiwilligem Ergeben in ihr würdeloses Sklavinnenschicksal bemächtigt.
Die Frauen und ihre meist noch kleinen Kinder scheinen am Ende ihrer Kräfte angelangt zu sein. Die wenigen mit ihnen geflohenen Männer haben sich gleich zu Beginn der Flucht aus dem Staub gemacht, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes in die Büsche geschlagen und dadurch ihre durch die Kleinen gehandicapten Weiber feige im Stich gelassen.
In keinem einzigen Dorf, an dem sie in den vergangenen drei Wochen vorübergeschlichen sind, hat man die Flüchtigen aufgenommen, aus Angst vor den Besatzern; überall lauerte der Feind. Sie konnten von Glück sagen, dass man sie nicht umgehend an die Obrigkeit verraten, sondern ihnen gelegentlich ganz heimlich etwas zu essen zugesteckt hat …
Als Einzige unter den Frauen scheint Elisa sich noch nicht in das traurige Los einer Sklavin ergeben zu wollen. Mit betont ruhiger, jedoch fordernder Stimme verlangt sie von den feindlichen Soldaten, sie vor den befehlshabenden Offizier zu führen, da sie ihn unbedingt sprechen müsse.
Ihre stolze Miene, die so gar nicht zu ihrer erbärmlichen Erscheinung in der zerlumpten Kleidung zu passen scheint, sowie ihre aufrechte Haltung und der unerwartet befehlsgewohnte Ton, machen auf die schwarzen Soldaten und auf ihren preußischen Anführer, zu dem sie die Eingeborenenfrau schließlich führen, ziemlichen Eindruck.
Letzterer ist ein junger, erst vor kurzem nach dem Schwarzen Erdteil verpflichteter deutscher Leutnant, der sich noch ein gewisses Maß an „Afrikaromantik“ und vor allem seine Menschlichkeit erhalten hat und noch nicht wie die meisten anderen, bereits länger dienenden „Schutztruppler“ geartet ist, die an Desillusionierung, Frust, Überheblichkeit und Rassendünkel leiden – Befindlichkeiten und Charakterdefizite, die oftmals durch Trunksucht und latent schlummernde Brutalität noch verstärkt werden.
Infolgedessen ist er auch noch nicht angesteckt von der üblichen Blindheit gegenüber Ausbeutung, Menschenverachtung und der bei den Weißen häufig grassierenden Sklavenhaltermentalität.
Maurice, der seiner Mutter nicht von der Seite gewichen ist, vernimmt mit Stolz die Worte, die seine geliebte Mama an die Person richtet, von der allein in diesem Augenblick das Schicksal aller Gefangenen abhängt.
„Sollen unsere Entbehrungen, Gefahren und Ängste auf der Flucht vergebens gewesen sein, weißer Mann? Wir sind nicht aus Spaß geflohen, sondern um unmenschlicher Behandlung, körperlicher Züchtigung und Vergewaltigung zu entgehen! Immerhin sind auf unserer Flucht schon zwei Kleinkinder und eine ältere Frau den Strapazen erlegen“, berichtet Elisa.
‚Wie eine Königin steht sie vor dem fremden Eroberer’, denkt der sechsjährige Knabe und sein Herz fließt über aus Liebe zu ihr. ‚Sie redet ihn mit ‚weißer Mann’ an und nicht mit ‚Herr’ oder ‚Bwana’. Trotz der schäbigen Lumpen, die sie am Leib trägt, wirkt meine Mutter wie eine Prinzessin, wie eine Herrscherin – was sie in Wahrheit ja auch ist!’
Wird es Elisa Obembe gelingen, den preußischen Leutnant zu überreden, so dass er sich zumindest bereitfindet, sie und ihre Kinder sowie die übrigen Flüchtlinge – wenn schon nicht laufenzulassen – in der nächstgelegenen Missionsstation abzusetzen, anstatt sie der Rachsucht ihres bisherigen „Herrn“ und seiner widerwärtigen, hochnäsigen Ehefrau auszuliefern?
Die Besitzerin der Zuckerrohrplantage ist nämlich zu allem Übel auch noch krankhaft eifersüchtig und überwacht ständig ihren Ehemann, einen ehemaligen deutschen Kolonialoffizier, der in der Tat wie besessen hinter schwarzen Frauen her ist. Keine unter vierzig ist vor ihm sicher …
Aus Rachsucht lässt die Memsahib üblicherweise ihre Wut an den weiblichen Sklaven und oftmals an deren Nachwuchs aus; wobei sie Züge von Sadismus offenbart, die nicht selten sogar ihrem Ehemann zu weit gehen.
Ausgerechnet in einem Kloster abgeliefert zu werden, entspricht nicht gerade dem Wunschtraum Elisas; aber bei den Mönchen ist man zumindest seines Lebens sicher, wird in aller Regel nicht brutal verprügelt und läuft auch als Frau kaum jemals Gefahr, gegen den eigenen Willen missbraucht zu werden, so wie es den meisten anderen jungen Weibern in dienender Stellung durch weiße Herren ganz selbstverständlich widerfährt.
Die schwarzen Beischläferinnen der Klosterbrüder verrichten ihre Liebesdienste, sofern diese gewünscht werden, freiwillig, weil sie sich dann als „Ehefrauen“ der Mönche betrachten können und damit zufrieden sind, nicht schlecht behandelt, sondern gut versorgt zu sein; während auf den meisten Plantagen Missbrauch, Prügelstrafe, Demütigung und gnadenlose Ausbeutung an der Tagesordnung sind.
Nicht einmal große Hässlichkeit schützt die Ärmsten vor sexuellen Übergriffen ihrer weißen Besitzer. Von einem berühmt-berüchtigten Leutnant der deutschen Kolonialtruppen wird gar überliefert, er pflege von den „schwarzen Huren“ während er sie missbrauche, zu verlangen, die Röcke übers Gesicht zu schlagen, „um dabei ihre abstoßenden Negervisagen nicht sehen zu müssen …“
Während Elisa mit dem Leutnant verhandelt, kommt in dem kleinen Jungen die Erinnerung an ein schlimmes Ereignis hoch.
Maurice – zum damaligen Zeitpunkt war er knapp fünf Jahre alt – ist einmal Zeuge gewesen, wie ihr weißer Sahib – ein höherer deutscher Offizier mit Adelstitel, der sich nach Ablauf seiner regulären Dienstzeit mit seiner Frau wie viele andere ebenfalls als Zuckerrohrpflanzer versuchte – sich erlaubt hatte, seine Mutter sexuell zu bedrängen. Er hatte sie in der Scheune beim Stillen ihres zweitältesten Sohnes, seines damals dreijährigen Bruders überrascht.
Elisa pflegte, wie alle Frauen ihres Stammes, Kindern bis zum fünften Lebensjahr die Brust zu geben. Einem alten Volksglauben zufolge, sollte diese Praxis der Geburtenkontrolle dienlich sein.
Wie die Geburtenhäufigkeit der Eingeborenenfrauen hinlänglich bewies, war dieser „Kontrolle“ allerdings keine besondere Effizienz zu bescheinigen …
Maurice selbst wurde des Gestilltwerdens zwar nicht mehr teilhaftig, aber Henri musste sich noch mit der kleinen Greta die Muttermilch teilen.
Der deutsche Pflanzer zerrte an Elisas Baumwollrock, der dabei zerriss und begann, ihre dünne Bluse zu zerfetzen, da sie sich überraschend heftig zur Wehr setzte. Empört weigerte sie sich, sich auszuziehen und sich ihm freiwillig hinzugeben.
„Warte, du schwarzes Biest!“, hörte der kleine Maurice, der sich voller Angst hinter einem Bottich versteckt hatte, den Bwana toben. „Ich werd’ dir geben! Es ist mein gutes Recht, dass du die Beine jederzeit für mich breit machst, du dreckiges Luder!“
Wie ein bösartiger Hund hatte der Weiße mit offenstehender Hose, aus der sein erigierter Penis ragte, geknurrt und ihr einen Faustschlag gegen die Wange versetzt, ehe er nach der an der Scheunenwand hängenden Kiboko griff, jener gefürchteten Flusspferdpeitsche aus Krokodilleder, um Maurices geliebte Mama „Mores zu lehren“, wie der Sahib es wutschnaubend nannte.
Bei der Kiboko handelte es sich um eine fürchterliche, in aller Regel grässliche Fleischwunden verursachende Waffe, die dazu diente, aggressive Flusspferde abzuwehren; Tiere, denen in Afrika mehr Menschen zum Opfer fielen als Krokodilen oder Löwen.
Maurice hatte zwar gewusst, dass seine hochgewachsene Mutter Elisa stark und auch sehr mutig war. Aber die Schnelligkeit und vor allem die wilde Entschlossenheit, mit der sie erst ihren kleinen Sohn ein Stück abseits auf den Boden setzte, ehe sie wie eine Leopardin auf ihren „Besitzer“ zusprang, ihm blitzschnell das unter Umständen sogar tödliche Züchtigungsinstrument entriss und stattdessen ihn mit dessen Stiel verprügelte, bis er, schreiend vor Schmerzen und fluchend vor ohnmächtiger Wut, zu Boden ging:
Das nötigte dem kleinen Jungen gewaltigen Respekt ab! Niemals hat Maurice den geradezu unwirklich anmutenden Anblick vergessen: Elisa mit gespreizten Beinen, die der zerfetzte Rock bis zu den schlanken muskulösen Oberschenkeln frei gibt, die Peitsche mit erhobenem Arm in der Luft schwingend, blickt wie eine wilde Rachegöttin nieder auf den Gedemütigten, dessen Glied sich inzwischen längst klein und schlapp im Hosenschlitz verkrochen hat, und stellt ihm mit bemerkenswert ruhiger Stimme ein Ultimatum.
„Du kannst es dir jetzt aussuchen, weißer Mann: Entweder du schwörst mir beim Leben deiner eigenen kleinen Tochter, dass du es nie mehr wagen wirst, gegen mich oder einen der Meinen auch nur die Hand zu erheben – oder ich schlage dich augenblicklich tot wie eine Ratte!
Aber vorher“ – nicht einmal Maurice hat gesehen, woher sie das scharfe Fischmesser, das sie zwar immer bei sich trug, jetzt so urplötzlich hervorgezaubert hat – „würde ich dich noch von deiner verfluchten Männlichkeit befreien! Als Vergeltung für die vielen Übergriffe, die du dir bisher gegen meine schwarzen Schwestern geleistet hast!“
Blitzschnell greift Elisa ihm zwischen die Beine und umfasst grob seine Hoden.
„Deine Eier im Futtertrog der Schweine: Das würde denen mit Sicherheit gut gefallen!“
Unwillkürlich beginnt der Bwana zu wimmern und um Gnade zu betteln. Nach einer Weile lockert Elisa ihren Griff.
Dem damals Fünfjährigen ist bei den schrecklichen Worten seiner Mutter der Mund vor Schreck offen stehen geblieben. Der dreijährige Henri, der bei dem Geschrei des Plantagenbesitzers fürchterlich erschrocken ist und, als der weiße Mann seine Mutter mit der Faust schlug, zu weinen begonnen hat, versteht noch nicht, worum es eigentlich geht.
Bei Maurice verhält es sich anders. Der Fünfjährige begreift sehr wohl, was der Bwana von Elisa gewollt hat. In den beengten Sklavenunterkünften kriegen es auch die jüngeren Kinder mit, wenn Männer und Frauen sich „näherkommen“. Aber das geschieht in aller Regel in beiderseitigem Einvernehmen …
Was seine Mutter gerade wagte, mag zwar bewundernswertes Heldentum sein, grenzte jedoch an hellen Wahnsinn, darüber gibt es für den kleinen Maurice keinen Zweifel.
Natürlich wird der weiße Mann den geforderten Schwur jetzt leisten und, nachdem Elisa von ihm abgelassen und er sich von dem Schreck erholt hat, sie zur Strafe durch seine Helfershelfer auf der Plantage umbringen lassen. Und ihn und seine Geschwister gleich mit …
Bestimmt ist sich dessen auch Elisa bewusst. Während der Pflanzer noch den Schwur herunterleiert, steckt sie das Messer in den Bund ihres zerfetzten Rocks, hebt ihren kleinen Sohn Henri von der Erde auf, schiebt sich die Kiboko unter einen Arm und stolziert hoch erhobenen Hauptes aus der Scheune, in der das geerntete Zuckerrohr lagert, bis es abgeholt wird.
Erst draußen lässt sie achtlos das verabscheuungswürdige und verhasste Züchtigungsinstrument mitten auf den Weg fallen.
Wie durch ein Wunder waren damals keine neugierigen schwarzen Arbeiter bei dem lauten Getümmel herbeigerannt, wie sie es sonst immer taten, sobald etwas auf der Pflanzung die übliche Routine unterbrach.
Bereits als sie ihren Herrn hatten kommen sehen, waren sie blitzartig in ihren Hütten verschwunden. Sie ahnten wohl, dass der Sklavenhalter plante, sich mit einer der ihren, dieses Mal mit ihrer ungekrönten Königin, der Häuptlingsfrau Elisa, zu „vergnügen“, die kurz zuvor die Scheune betreten hatte.
Normalerweise suchte der Herr die Lagerhalle für das Zuckerrohr nur auf, wenn der Aufkäufer nach der Ernte kam, um mit ihm den Preis auszuhandeln. Aber das war bereits vor zwei Tagen geschehen. Besuche außer der Reihe konnten nur eines bedeuten …
Und bei einem „Rendezvous“ schätzte der Bwana es erfahrungsgemäß überhaupt nicht, gestört zu werden. Zitternd vor Angst, aber doch unendlich stolz auf Elisa, war Maurice ihr hinterhergelaufen. Diese Begebenheit würde er niemals aus dem Gedächtnis verlieren. Im Gegenteil: Er würde dafür Sorge tragen, dass auch seine Nachkommen davon erfuhren.