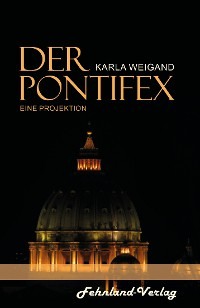Kitabı oku: «Der Pontifex», sayfa 8
GLORIA
„In excelsis Deo!“
Elisa Obembes spektakuläre Flucht ist nach ihrer Ankunft bei den Benediktiner Missionspatres zu Ende.
Zu erschöpft sind sie und die übrigen, die mit ihr den Gang ins Ungewisse gewagt haben, als dass sie danach streben würden, sich erneut den Gefahren eines Eintauchens in den gefährlichen Dschungel, der Überwindung steiler Berge und unfruchtbarer Wüstenstreifen und des Durchquerens krokodilverseuchter Flüsse auszusetzen und sich dabei auf das Risiko einzulassen, von der deutschen Kolonialmacht unerbittlich gejagt – und letztendlich doch zur Strecke gebracht zu werden.
Nach nur wenigen Tagen ist Elisa sicher, bei den frommen Mönchen für sich und ihre Kinder ein neues Zuhause gefunden zu haben. Dazu hat es lediglich mehrerer ausführlicher Gespräche mit dem Prior des Klosters, Pater Hilarius Hilreiner, bedurft, der ihr ein gerechter und kluger Mann zu sein scheint. Für sie ein echtes Wunder: gehört er doch der Rasse der Weißen an …
So kommt es auch den meisten anderen Flüchtigen vor. Alle, bis auf zwei jüngere Frauen ohne Kinder, wollen bleiben, künftig für die Mönche arbeiten und im Tausch dafür deren Schutz genießen.
Die meisten sind bereits getauft, bis auf ein paar ältere Wahehe-Frauen, die der Christianisierung bisher entkommen sind. Aber auch sie sind zur Taufe bereit, falls man ihnen im Gegenzug Nahrung und Obdach bis ans Ende ihrer Tage gewährt.
‚Alle scheinen zufrieden mit ihrem Schicksal’, muss der kleine Maurice erkennen, Elisas ältester Sohn. Er selbst ist unglücklich und zornig darüber, künftig bei den „heiligen Vätern“ der verhassten Eroberer-Rasse leben – und noch dankbar dafür sein zu müssen.
Obwohl satt und sicher, mit einem Dach über dem Kopf und einer Mutter, die zwar fleißig ist, aber keineswegs ausgebeutet wird, und obgleich er wie die anderen Kinder fast nichts arbeiten muss und stattdessen beinah den ganzen Tag spielend verbringen darf, ist der sechsjährige Häuptlingssohn fest entschlossen, unzufrieden und voller Groll zu sein.
Vor allem Letzteres liegt ihm sehr am Herzen: Jeden Tag ruft er sich erneut die Schandtaten jener deutschen „Herren“ ins Gedächtnis, von denen er in seinem bisherigen kurzen Leben erfahren hat.
Nein, mit den Feinden aus dem fernen Norden wird Maurice sich niemals anfreunden; und dazu zählen für ihn auch die humanen und freundlichen Klosterbrüder. Er versteht weder seine über alles geliebte Mutter, noch die anderen „Sklaven“, die nach einiger Zeit gewissenhafter Pflichterfüllung vom Vater Prior offiziell freigelassen werden und wählen dürfen, wohin sie gehen wollen. Niemand verlässt das Kloster. Auch die beiden Kinderlosen haben sich mittlerweile fürs Bleiben entschieden.
Jeden Tag redet Elisa ihrem Ältesten gut zu; aber trotzig verharrt der kleine Junge in seiner ablehnenden Haltung.
„Mutter, du selbst hast mich doch geheißen, niemals das Unrecht der weißen Eroberer zu vergessen! Du hast mir auch das Versprechen abgenommen, mich einst zu rächen für die Ermordung meines Vaters Mkwa, des tapferen Häuptlings der Wahehe.
Warum findest du es jetzt in Ordnung, dich mit den Weißen zu verbrüdern? Nur weil die Mönche uns nicht wie Tiere behandeln? Das wäre auch sehr merkwürdig, wo sie doch immer von der Liebe zum Nächsten faseln!“
Elisa vermag den Jungen nicht umzustimmen. Vorerst noch nicht. Sie wird ihn nicht zwingen, sondern abwarten, was die Zukunft bringt; hoffentlich Vernunft und Frieden und Freiheit für ihr Volk. Dass sie insgeheim ähnlich wie ihr Sohn empfindet und seine Gefühle nur zu gut versteht, aber klug zu verbergen weiß, darüber schweigt die stolze Frau. Maurices Mutter Elisa hat sich, der Not gehorchend, wie die meisten ihrer Landsleute mit ihren Feinden, den weißen Okkupanten, abgefunden und bestens arrangiert.
Wohin sollte sie auch gehen? Ihr früheres Dorf haben die deutschen „Schutztruppen“ dem Erdboden gleichgemacht, die Einwohner gefangengenommen und an deutsche Plantagenbesitzer als Arbeitssklaven verteilt. Immerhin werden sie von den Patres ungleich besser behandelt als von den europäischen Pflanzern.
Sie müssen zwar tüchtig arbeiten, sind in ihrem eigenen Land im Grunde unfrei, weil außerhalb des Klosterareals nur brutale Unterdrückung herrscht, aber sie brauchen nicht um ihr Leben zu fürchten, werden anständig ernährt und im Krankheitsfalle nicht davongejagt, sondern medizinisch versorgt, erhalten bis zum Tod ihr Gnadenbrot, um nach ihrem Ableben nicht im Urwald verscharrt, sondern ehrenvoll im Beisein eines Priesters auf dem Klosterfriedhof begraben zu werden.
Die deutschen Missionsschulen in Deutsch-Ostafrika haben zudem das wichtige Bildungsmonopol inne. Das allein gab für Elisa schon den Ausschlag: Bildung für ihre Söhne hat sie sich immer gewünscht!
Bald besucht auch Maurice auf Elisas Drängen hin die Schule der Benediktinermönche. Es gibt kaum staatliche Schulen und die wenigen sind nur im Bereich der Küste des Indischen Ozeans angesiedelt, wo das feuchtschwüle Klima Ungeziefer aller Art gedeihen lässt und selbst für die Einheimischen höchst ungesund und kaum zu ertragen ist.
Zu Beginn versucht Maurice, sich zu weigern, von den „weißen Feinden“ zu lernen. „Das brauche ich nicht, Mama!“, gibt er sich störrisch. „Es genügt mir, groß und stark und ein tapferer Wahehe-Krieger zu werden, um in einigen Jahren die weißen Sklavenhalter aus dem Land zu werfen!“
Mit dieser wenig reflektierten Meinung steht er anfangs unter den übrigen Jungen und selbst den erwachsenen Frauen nicht allein. Elisa hingegen, die dank ihres Weitblicks eine andere Ansicht vertritt, gelingt es dank ihrer Autorität, ihren Sohn sowie ihre weiblichen Stammesangehörigen davon zu überzeugen, dass eine gründliche Schulung in europäischer Bildung und Allgemeinwissen unabdingbar notwendig sein werden, um irgendwann das Joch der Weißen abschütteln zu können.
„Wie willst du jemals von ihnen ernstgenommen werden und später mit ihnen auf Augenhöhe verhandeln können, wenn du ein dummer unwissender Kerl bleibst, Maurice?“, fragt Elisa ihren Ältesten. „Ihren Respekt kannst du dir nur erwerben, wenn du dir ihre Kenntnisse und Fertigkeiten aneignest!
‚Wissen ist Macht!’, sagen die Weißen – also, mein Sohn, richte dich gefälligst danach!“
Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern! Lukas 12, 48.“
O ja! Elisa hat sich vieles von den missionierenden Mönchen gemerkt.
Anhand der Worte des Apostels macht Elisa ihrem Sohn Maurice deutlich, dass er einst als Anführer der Wahehe gefordert sein wird. Und nicht allein, was kriegerische Stärke anbetrifft; sondern er wäre dann verantwortlich für die kluge Führung seines Volkes. Je mehr er von den Weißen gelernt habe, desto besser werde es ihm gelingen, seine Anhänger in die Freiheit zu führen und für das Wohlergehen des Stammes zu sorgen.
„Der kluge Mann besiegt seinen Feind mit dessen eigenen Waffen“, impft die Häuptlingstochter und Wahehe-Prinzessin ihm ein und ihre Söhne Maurice, Henri und später Andi sowie die übrigen Kinder machen sich ganz allmählich diese vernünftige Denkweise zu Eigen.
Fortan wetteifern die schwarzen Kinder miteinander im Lernen. Vor allem Maurice tut sich unter den Schülern der Missionsschule hervor. Es kann dem Jungen, der eine rasche Auffassungsgabe besitzt, auf einmal gar nicht schnell genug gehen mit der Wissensvermittlung … Am liebsten würde er alles auf einmal in sich aufnehmen.
„Er saugt die Lerninhalte quasi in sich auf wie ein trockener Schwamm“, loben ihn die Mönche, die seine Lehrer sind, bei seiner Mutter Elisa, die sehr stolz ist auf ihn.
In der Anfangszeit hat die katholische Schule, in die Maurice und seine Brüder Henri und später auch Andi gehen, leider noch unter Schülermangel gelitten, denn die Unterdrückten in den umliegenden Dörfern sind und bleiben misstrauisch gegenüber den Erziehungsmethoden der christlichen Patres. Das sollte sich erst später, kurz vor Ausbruch des großen Krieges in Europa, ändern …
Maurice Obembe und seine Brüder fallen seinen Lehrern auf als intelligente und strebsame Schüler. Speziell von Maurices tiefer Abneigung gegen sie – betrachtet er doch nach wie vor jeden Weißen als Mörder seines Vaters – bemerken sie allerdings nichts.
Nur einer der Mönche, ein gewisser Pater Bernhard Weingartner, der ihn in Geschichte unterrichtet, scheint ein bisschen weniger naiv als seine Mitbrüder zu sein. Eines Tages spricht er seinen Schüler Maurice, der mittlerweile das Alter von vierzehn Jahren erreicht hat, darauf an:
„Mir ist natürlich klar, dass dein und deiner Brüder Fleiß und Eifer nur wenig mit einem plötzlich erwachten Verlangen nach dem Christentum und weißer Lebensart zu tun hat! Mir scheint vielmehr, euch ist klar geworden, dass ihr in den Kolonien durch gute Schulbildung aus eurem traditionellen Stammesverband ausscheren könnt und im Übrigen auch der Zwangsarbeit für eure weißen Herren zu entgehen vermögt.
Stattdessen kann jeder von euch, der das Zeug dazu hat, bei uns Deutschen Karriere machen. Entweder in Afrika oder vielleicht sogar im fernen Deutschland.“
Maurice Obembe, ein sehr stolzer Heranwachsender, fände es albern, sich dumm zu stellen und vorzutäuschen, der Pater habe Unrecht mit dieser messerscharfen Einschätzung.
„So ist es, Pater Bernhard! Ich, als Sohn eines großen Häuptlings, habe keine Lust, mir später auf den Feldern irgendeines Weißen, der sein Ackerland einem meiner schwarzen Onkel gestohlen hat, den Buckel krumm zu schuften und noch dankbar sein zu müssen, dass der Kerl mich nicht verhungern lässt oder wegen einer geringen Verfehlung totschlägt!
Ich will studieren und dann ein kluger Mann sein, der weitgehend unabhängig leben und arbeiten kann, der Ansehen genießt und seine Familie anständig zu ernähren vermag!“ Davon, dass er plant, die Deutschen eines Tages aus seinem Land zu werfen, lässt er natürlich kein Wort verlauten.
Pater Bernhard Weingartner ist zu dieser Zeit auch der neue Prior des Missionsklosters. Pater Hilarius Hilreiner, der den Flüchtigen seinerzeit Zuflucht gewährt hat, ist kürzlich einem Herzschlag erlegen. Er verspricht Maurice, sich nach dem Erreichen der Hochschulreife für seinen Zögling stark zu machen, auf dass dieser nach Deutschland oder Frankreich gehen und dort studieren könne.
Am besten, wie er meint, eigne sich für einen wie ihn, der logisch zu denken vermöge und ordentlich und fleißig sei, das Studium der Rechtswissenschaften.
Dieser Mönch, dessen Heimatkloster Sankt Ottilien in Bayern ist, nach dem er zugegebenermaßen schreckliches Heimweh empfindet, steigt dadurch ungemein in der Achtung seines schwarzen Musterschülers Maurice. In Zukunft nimmt er den Prior ausdrücklich aus von seiner üblichen, gebetsmühlenartig wiederholten, stillen aber inbrünstigen Verwünschung sämtlicher Weißer.
Elisa sieht die Entwicklung ihres Lieblingssohnes mit großer Erleichterung. Es wäre schrecklich für sie und würde sie todunglücklich machen, falls die Zukunft ihres Ältesten darin bestünde, Zuckerrohr zu schneiden, Kaffee zu pflücken oder Kautschuk zu zapfen für einen weißen Sklavenhalter und sich von „seinem Herrn“, falls diesem danach war, bis aufs Blut auspeitschen zu lassen.
Auch ihre anderen Kinder Henri, Andi sowie die kleine Tochter Greta werden von Elisa zum Lernen angehalten. Alle erzielen gute Zensuren, aber an Maurice reichen sie nicht heran.
Er lässt selbst ältere Schüler weit hinter sich und bekommt zu guter Letzt von den entsprechenden Mönchen „Spezialunterricht“ in den Fächern Deutsch, deutsche Geschichte, Französisch und Mathematik. So ist es ihm möglich, eine Klasse zu überspringen.
Sein Verhalten ist stets tadelsfrei und er duldet auch bei seinen jüngeren Geschwistern weder Faulheit, vorlautes Geschwätz noch irgendwelche Frechheiten gegen die Klosterbrüder.
Greta wächst wie ihre Mutter zu einer schwarzen Schönheit heran und einer der jungen deutschen Kolonialoffiziere verliebt sich unsterblich in sie. „Ich möchte dich unbedingt heiraten, Liebes, und dich mit nach Deutschland nehmen!“
Ein Vorhaben, das dem klugen, bildhübschen Mädchen, das ihn ihrerseits liebt und sehr attraktiv findet, zwar ungeheuer schmeichelt, das jedoch seine militärische Karriere unwiderruflich zerstören würde; ebenso sein gesellschaftliches Ansehen in der Heimat – und daher von der vernünftigen Greta rundweg abgelehnt wird.
„Jetzt, in Afrika, magst du mich zwar aufrichtig lieben, aber in Deutschland würdest du mich unweigerlich nach einiger Zeit hassen, mein Liebster. Du würdest nämlich mir die Schuld dafür geben, dass deine Vorgesetzten, deine Familie und deine Freunde sich von dir abwenden, weil du eine nach ihren Maßstäben ‚Minderrassige’ geheiratet hast!“, gibt sie ihrem Geliebten zu bedenken.
„Unsere Kinder wären Mischlinge – und hätten in Europa vermutlich nicht viel Gutes zu erwarten. Selbst hier in Afrika haben es Gemischtrassige oft sehr schwer. Aber ich danke dir für dein Angebot, denn es zeigt mir, dass du mich zumindest im Augenblick sehr lieb hast!“
Selbst als der junge Mann immer wieder versucht, sie von ihrer Haltung abzubringen, ja, ihr versichert, seine Familie sei überaus aufgeschlossen und habe andere Vorstellungen als die üblichen kleinkarierten, schüttelt Greta nur den Kopf.
„Außerdem liegt mir an einer weiteren militärischen Karriere sowieso nichts!“, versucht der Offizier beinah verzweifelt, ihre ablehnende Haltung zu ändern. Greta bleibt dabei: Eine Ehe zwischen ihnen beiden würde sowohl ihn als auch sie ins Unglück stürzen.
Endlich gibt der verliebte junge Leutnant auf und bittet um seine Zurückversetzung nach Preußen.
Elisa ist unheimlich stolz auf ihre kluge starke Tochter, die sich schweren Herzens gegen ihre eigenen Gefühle entschieden hat und sehr unter dem Verlust ihres Geliebten leidet. Dieser kehrt auch kurz darauf in seine deutsche Heimat, nach Potsdam, zurück.
ORATIO; TAGESGEBET
„Oremus!“ „Lasset uns beten!“
Der allergrößte Wirbel um „den Afrikaner“ im Vatikan ist mittlerweile abgeebbt. Ein Wirbel, wozu der leicht hysterische Jubel über den „Neuen“ und die, von den katholischen Laien verteilten, völlig ungerechtfertigten Vorschusslorbeeren, Leos Pontifikat betreffend, kräftig beigetragen haben.
Als Kardinal ist der Heilige Vater keineswegs durch besondere Leistungen oder Ideen aufgefallen, wie die Lage der Kirche verbessert werden könne. Und jetzt, da er als Oberhaupt des Ganzen eigentlich in der Pflicht stünde, lassen diesbezügliche kluge Einfälle immer noch auf sich warten.
Aber vermutlich ist das einfach so bei jeder göttlichen Inspiration: Sie kommt meist unverhofft … Längst ist wieder eine gewisse Normalität in der katholischen Welt eingezogen, es herrscht Business as usual vor.
Bloß die Altgedienten im Inneren des Vatikan haben sich zähneknirschend damit abfinden müssen, dass neuerdings ein anderer Wind weht, denn Papst Leo hat eine ganze Reihe von teilweise befremdlichen Änderungen durchgesetzt.
Und zwar nicht peu á peu, wie das die meisten seiner Vorgänger mehr oder weniger diplomatisch gehandhabt haben, sondern ganz kurzfristig, sozusagen über Nacht und beileibe nicht immer schmerzlos für die Betroffenen, die sich urplötzlich durch Dunkelhäutige ersetzt sahen.
Große Augen und insgeheim Kopfschütteln gab es – und gibt es vereinzelt immer noch – als kurz nach seinem Amtsantritt zwei ausnehmend gut aussehende schwarze Damen in den Gemächern des Pontifex auftauchten; zweiundvierzig Jahre alt die eine, erst vierundzwanzig die andere.
Zur Erinnerung: Es handelt sich um zwei schlanke, hoch gewachsene und bildschöne Nonnen im schwarzweißen Habit, wovon die ältere angeblich seine leibliche Schwester ist und es sich bei der jüngeren um ihrer beider Nichte handeln soll …
Mit großer Selbstverständlichkeit stellte der Heilige Vater persönlich die beiden Frauen als seine nahen Verwandten vor; wobei er betonte, überaus glücklich zu sein, sie erneut und auf Dauer um sich zu haben. Erinnerten sie ihn doch an seine geliebte Heimat Afrika, nach der er sich zuweilen schmerzlich zurücksehne.
„Bereits als Pfarrer in einem Urwalddorf und später als Bischof in Ghanumbia hat mir beispielsweise Schwester Monique – in Wahrheit immer schon meine Lieblingsschwester aus der Schar meiner Geschwister – zur Seite gestanden; während meine liebe Nichte, Schwester Angélique, mir zusätzlich in den letzten Jahren als Kardinal bei meinen zahlreichen Aufgaben geholfen hat.“
Selbstverständlich gibt es niemanden, der laut die Angaben Seiner Heiligkeit, den engen Verwandtschaftsgrad der frommen Damen betreffend, infrage stellen würde … Und das ist auch gut so.
Dass beide Nonnen denselben Familiennamen wie Seine Heiligkeit führen, erleichtert das Arrangement, besitzt allerdings keine große Aussagekraft: „Obembe“ entspricht in Ghanumbia etwa dem deutschen Meier, Müller, Schulze …
Seine engste Umgebung besteht nur noch, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, aus Schwarzafrikanern. Auf ihre Anwesenheit legt der Heilige Vater großen Wert. So stammen beispielsweise sein Camerlengo, Monsignore Gustave Marengo, sowie die übrigen vertrauten männlichen Diener und sogar sein Beichtvater, Monsignore Pierre Katanga, aus seinem Heimatland Ghanumbia, das im Augenblick dank seines illustren Sohnes einen Touristenboom ohnegleichen erlebt.
Selbst Schwester Monique stellt unumwunden fest: „Schlaue Reiseveranstalter in aller Welt haben unverzüglich den lukrativen Braten gerochen und sowohl Studienreisen als auch Badeferien in kleinen, mückenverseuchten Dörfern am Indischen Ozean, die bisher kein Mensch freiwillig aufgesucht hätte, in ihr Touristikprogramm aufgenommen.
Dass es in Ghanumbia so gut wie keine Hotels gibt, die auch nur andeutungsweise den gehobenen Ansprüchen europäischer oder amerikanischer Reisender gerecht werden, bildet dabei kein Hindernis.“
Es stimmt: „Romantische“, „authentische“ und selbstverständlich mit dem Zauberwort „nachhaltig“ versehene Lehmhütten mit Palmblätterdächern für zwei bis sechs Personen, sind schnell aus dem Boden gestampft und kosten zudem nicht viel, weil man, natürlich wiederum nur aus Gründen der „Authentizität, Originalität und Nachhaltigkeit“, auf europäisch dekadentes Mobiliar wie gepolsterte Stühle, Kleiderschränke und stromfressende Kinkerlitzchen weitgehend verzichtet.
Der schlaue Werbeslogan „Wer wäre nicht glücklich, ein paar Wochen so zu leben, wie es der Heilige Vater in seiner Jugend getan hat und wie es heute noch seine zahlreichen Verwandten praktizieren?“ tut erstaunlicherweise seine Wirkung.
Wobei das Letztere mit Fug und Recht bezweifelt werden darf. Der weit verzweigte Obembe-Clan ist längst saturiert und noch der letzte schlichte, um zehn Ecken herum mit Leo XIV. Verwandte, hat sich längst seinen Anteil am riesigen Kuchen gesichert. Und Leo Africanus hat seine Jugendjahre bestimmt auch nicht in einer primitiven Lehmhütte verbracht.
Die Sippe zeigt ihren Reichtum auch mit ihren Villen an den exklusivsten Orten der Welt, in denen sie, ähnlich den arabischen Ölscheichs, wie Fürsten residieren, mit den Automobilen, Yachten und Privatflugzeugen, die sich ihre Mitglieder leisten, mit den mondänen Hotels und verschwiegenen Clubs, in denen sie sich verwöhnen lassen.
Aber vor allem erweist es sich an den, in der Regel weißen, topgestylten „Hostessen“ und „Models“, mit denen sich der männliche Teil der Familie in aller Öffentlichkeit schmückt.
Lange vorbei und weitgehend vergessen sind die bitteren Jahre der Unterjochung und der schmachvollen Ausbeutung während der Zeit der Kolonisation. Von der jetzigen Generation der Obembes wissen nur noch die wenigsten über die einstigen Vorgänge genau Bescheid. Die Jüngeren interessieren sich auch mehrheitlich nicht mehr dafür. Die schmähliche Vergangenheit ist für sie längst passé und besitzt mittlerweile eher einen romantischen Touch.
Eine der wenigen Ausnahmen bildet Schwester Monique, die sich immer schon von den Alten in der Familie von jenen längst vergangenen düsteren Kapiteln afrikanischer Historie hat erzählen lassen. Auch sie gehört einem entfernten Zweig der Obembe-Sippe an. Für Mädchen ist diese Art von Geschichtsunterricht auch heute noch gar nicht vorgesehen, ja, nicht einmal für die jüngeren Söhne.
Nur der jeweils älteste wird nach wie vor von seinem Vater während der Jahre seines Heranwachsens darüber aufgeklärt, damit jene schmachvolle Periode nicht ganz in Vergessenheit gerät – und um ihm am Tage seiner Volljährigkeit den gleichen Schwur abzunehmen, und zwar Wort für Wort, den einst der kleine Wahehe-Knabe Mauritz, genannt Maurice, getan hat, nachdem er sich mit Mutter und Geschwistern durch Flucht vor einem brutalen Sklavenhalter hatte retten können.