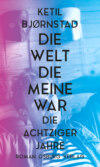Kitabı oku: «Die Welt, die meine war», sayfa 8
US-Präsident Jimmy Carter hat Probleme mit den neuesten Meinungsumfragen, nachdem er zuerst deutlich in Führung lag. Die katastrophal misslungene Geiselaktion im April hat das amerikanische Selbstbewusstsein ins Wanken gebracht. Sie sind enttäuscht von diesem Erdnussfarmer aus Plains in Georgia. Die Verhandlungen von Camp David sind jetzt lange her. Er kann sich nicht mehr im Blitzlichtglanz sonnen. Er hat sich als außenpolitisch unsicher und ungeschickt erwiesen, und dass die amerikanischen Geiseln noch immer im Iran gefangen sind, ist fast nicht zu begreifen für die vielen patriotischen Amerikaner, die sich selbst als einzigartige Vertreter des wichtigsten Volkes auf Erden begreifen. Diese verdammten Khomeinis dürfen keine Nation demütigen, deren Präsident bei allen offiziellen Anlässen Gott um seinen Segen anfleht. God bless America. Soll der Teufel alle holen, die es wagen, das uneingeschränkte Recht auf Freiheit dieses Volkes anzukratzen. Für immer mehr Amerikaner ist es unbegreiflich, dass Carter diese Gefangenen noch nicht befreien konnte. Und der republikanische Präsidentschaftskandidat Ronald Reagan weiß diese Situation auszunutzen.
Aber der, den wir in Norwegen gern den Schah von Persien genannt haben, stirbt in Kairo nach einer längeren Krankheit.
»Der Blutsauger des Jahrhunderts«, schreiben die Khomeini-loyalen Zeitungen in Teheran.
Die amerikanischen Geiseln, die gegen den Schah ausgetauscht werden sollten, sitzen noch immer in Gefangenschaft.
Inzwischen ist es August 1980. An einem ganz anderen Ort, im Hotel Dorchester in der Park Lane in London, ist der 54 Jahre alte Schauspieler Peter Sellers auf dem Weg zu seiner Suite, in der er in der letzten Zeit am Drehbuch zu Romance of the Pink Panther gearbeitet hat, seinem sechsten Film über den ungeschickten und sozial absolut unfähigen Inspektor Clouseau. Für eine ganze Generation, der ich selbst angehöre, sind sein Humor und seine Charakterparodien zu einem Teil des Alltags geworden. »Do you have a reum?« ist ein Codesignal für uns alle. Wir haben ihn geliebt, als unsympathischen und vorausblickenden Berater in Dr. Strangelove. Vorher haben wir über seine Verkleidungskünste in After the Fox gelacht, für viele von uns Filminteressierten auf Sandøya vielleicht der beste seiner Filme, nicht zuletzt, wenn er Jean-Luc Godard als Avantgarde-Regisseur parodiert. Wie oft haben wir uns spätabends ins Gesicht gefasst und gesagt: »My bone-structure?«, »Good morning« und alle anderen Repliken in diesem wahnwitzigen, von Italien inspirierten Plot. Peter Sellers war immer bei uns, wenn wir uns gegenseitig unsere sozialen Katastrophen anvertraut haben. »Birdy, nam-nam« war der verbale Schlüssel zu einem schönen Fest. Wir haben uns mit pochender Blase zusammengekrümmt, genau wie der arme indische Filmstatist, den er in The Party parodiert hat, und zueinander gesagt »I like to watch«, wie der Gärtner Chauncey in Being there.
Weiß Sellers das, wie viel er Menschen überall auf dem Globus bedeutete, die seine Filme geliebt haben, die Tränen gelacht haben über seine vielen Schlägereien mit dem Diener Cato, die gesehen haben, wie er über einer Balkonparodie in der Luft schwebt, wie er krüppelhaft mit kurzen Beinen ankommt wie ein Toulouse-Lautrec oder in seinem Burberry-Mantel als Inspektor Clouseau, der seinen Vorgesetzten immer wieder in Gemütsverdüsterung und totalen paranoiden Wahnsinn treibt?
Gerüchte wollen wissen, dass er vor dem Eingang dieses berühmten Hotels zusammengebrochen ist. Aber in den Zeitungen ist die Rede von einem schweren Herzanfall in seiner Suite, nach dem er ins Middlesex Hospital gebracht wurde, wo seine zweite Frau, Britt Ekland, mit ihrer fünfzehn Jahre alten Tochter Victoria und mit Sellers’ vierter Frau Lynne Frederick bei ihm saß, alles vergeblich. »His heart just faded away«, sagte ein Sprecher des Krankenhauses. Seit Jahren wussten die ihm Nächststehenden von Sellers’ schwachem Herzen. Blake Edwards, der Regisseur der Pink Panther-Filme, sagt in einem Interview, dass sie das Gefühl gehabt hätten, Sellers könne jederzeit sterben. Nur zwei Jahre zuvor war Sellers gefragt worden, ob er auf eine persönliche Frage antworten werde. »Natürlich nicht«, hatte Sellers erwidert. Dennoch machte der Reporter weiter: »Meines Wissens hatten Sie einen Herzinfarkt.« Sellers fiel ihm ins Wort und sagte mit einem Lächeln: »Ja, aber damit will ich aufhören. Ich bin schon auf zwei pro Tag runtergegangen.«
Die rechtsextreme Terrororganisation Nuclei Armati Rivoluzionari hinterlegt eine Bombe im großen Wartesaal des Bahnhofs von Bologna. Es ist Samstagvormittag, sehr viele Reisende sind unterwegs. Die Sprengladung zerstört einen Seitenflügel des wuchtigen Bahnhofs. 83 Menschen kommen ums Leben, mehr als 200 werden verletzt. Das Bombenattentat ist der Protest der Neofaschisten gegen die kommunistische Stadtregierung. Während die kommunistische Partei in Norwegen keine Rolle mehr spielt, sind die kommunistischen Parteien in Italien und Frankreich noch immer relativ stark.
Das Attentat ist das schlimmste in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, und der Bürgermeister der Stadt nennt es ein Verbrechen gegen die Menschheit.
Der Herbst bringt kühle Luft. Einen Hauch von etwas Traurigem, weil ich wieder auf Reisen gehen werde. Dauernde Aufbrüche, die dennoch nicht unwiderruflich sind. Abreisen, zurückkehren. Jemand wartet. Oder wartet sie nicht? Lebt sie ein anderes Leben? Wie gut kennen wir einander eigentlich? Wir sind zusammen, Tag für Tag, streiten uns nicht, lachen viel, merken den Übergang zwischen Arbeit und Muße nicht, können mitten am Tag lange Spaziergänge unternehmen. Die vielen Reisen machen etwas mit mir. Die langen Tourneen, die Hotelzimmer. Ist es etwas Flüchtiges, das mir in diesen Jahren anhaftet? Verändere ich mich als Person? Die Fährfahrkarten und die Flugtickets, die Hotelschlüssel, die Kollegen, das, was wir gemeinsam erschaffen werden, an ganz neuen Orten. Ich muss wieder er schreiben. Er, der reist, wieder und wieder, in dieselben Ortschaften und Städte. Er, der vor den Konzerten in der Garderobe wartet, spürt den Unwillen, jedes einzelne Mal, wenn er auf einer Bühne stehen soll. Die Nervosität, die so tief in ihm sitzt, bis er den Kontakt zum Instrument spürt, dass die Tasten nicht gewandert sind, dass A noch immer A ist und Fis noch immer Fis. Keine zwei Orte sind gleich, keine Stadt ist genau dieselbe. Sie verändern sich zwischen jedem Mal, wenn er aufbricht, verschwindet und zurückkehrt. So, wie er sich selbst verändert, fast unmerklich, von Mal zu Mal. Er kommt nach Stavanger, die neue Ölstadt. Hier hat es angefangen. Sein Sommernachbar Arve Johnsen, allein im Statoilbüro in der allerersten Zeit. Die Ölgesetze von 1971. Dass die nationale Leitung und Kontrolle für jegliche Tätigkeit auf dem norwegischen Kontinentalsockel gewährleistet sein müssen. Dass die Ölfunde so ausgenutzt werden müssen, dass Norwegen so weit wie möglich unabhängig von anderen wird, wenn es um den Import von Rohöl geht. Dass aufbauend auf dem Öl neue Wirtschaftszweige entwickelt werden sollen. Dass die Entwicklung einer Ölindustrie unter Rücksichtnahme auf existierende Wirtschaftszweige und Natur- und Umweltschutz vor sich gehen muss. Dass das Verbrennen von nutzbarem Gas auf dem norwegischen Kontinentalsockel nur für kürzere Versuchszeiträume gestattet ist. Dass Rohöl vom norwegischen Kontinentalsockel in Norwegen an Land gebracht werden soll, mit Ausnahme der seltenen Fälle, wenn gesellschaftspolitische Rücksichten eine andere Lösung nahelegen. Dass der Staat sich auf allen zweckmäßigen Ebenen engagiert, zu einer Vereinheitlichung norwegischer Interessen innerhalb der norwegischen Petro-Industrie beiträgt und den Aufbau einer integrierten norwegischen Ölindustrie mit nationalen und internationalen Zielsetzungen fördert. Dass eine staatliche Ölgesellschaft aufgebaut wird, die die geschäftlichen Interessen des Staates vertreten kann und die eine sinnvolle Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Ölinteressen fördern kann. Dass nördlich des 62. Breitengrades ein Aktivitätsmuster gewählt wird, das die besonderen gesellschaftspolitischen Verhältnisse in diesem Landesteil berücksichtigt. Dass norwegische Ölfunde die norwegische Außenpolitik vor umfassende neue Aufgaben stellen können.
Er sieht, dass es in den Straßen noch mehr neue Läden gibt. Das passiert fast gleichzeitig. Neue, etwas feinere Restaurants werden eröffnet. Alles wird von Mal zu Mal etwas feiner. Er geht in einen dieser Läden und sieht zu seiner Freude, dass er von Größe 36 auf 32 hinuntergegangen ist. Obwohl, in 32 gibt es nur sehr wenige Marken, die er am Leib haben mag. Er steht in der Umkleidekabine und betastet das Fett an seinem Bauch, das doch nie ganz verschwindet, auch wenn die Rippen jetzt auf andere Weise sichtbar sind als vorher. Er nimmt am Oberkörper schneller ab als an den Beinen. Das irritiert ihn. Muss er auf 70 Kilo heruntergehen, um die Beine zu bekommen, die er sich wünscht? Er schafft es nicht, abzunehmen, kann auf das Essen nicht verzichten. Er isst nicht mehr als andere Leute, aber doch zu viel, um dünner zu werden. Deshalb muss das Essen wieder heraus. Dass er so viele Jahre damit verbringen sollte, seinen eigenen Körper zu überlisten! Manchmal vergisst er sich, steht in der Künstlergarderobe und betrachtet sich von der Seite im Spiegel, während er sich die Hand auf den Bauch legt. Einmal hat ihn dabei eine Künstlerin gesehen, die mit ihm zusammen auftreten sollte. Hat er da ein Kichern gehört? Er errötete heftig, aber sie sagten beide nichts. Einmal, in Oslo, saß er am Flügel und gab ein Konzert. Plötzlich, mitten im schwierigsten Stück dieses Konzerts, merkte er, dass er sich übergeben musste. Es kam so plötzlich und unerwartet. Als ob sein Körper glaubte, er habe den Finger in den Hals gesteckt. Er wandte sich abrupt vom Publikum weg, fast wäre ein heftiger Strahl aus ihm herausgebrochen. Was in aller Welt sollte er tun? Er schluckte, schluckte, schluckte. Das durfte nicht passieren! Er dämpfte den Strahl. Es kam nur ein Aufstoßen, wie bei einem Säugling. Er musste weiterspielen. Aber als er sich zum Applaus erhob, verbeugte er sich seitlich und ging in der entgegengesetzten Richtung von der Bühne und nicht in der, aus der er gekommen war. Niemand sollte ihn so sehen, mit seiner eigenen Kotze, die ihm über Schulter und Arm lief.
15.
Pauls Stimme am Telefon.
»Cornelis ist in der Stadt. Er möchte dich treffen.«
Ich war gerade nach einer einwöchigen Tournee nach Sandøya zurückgekehrt. Ich hatte Essen für die nächsten drei Tage mitgebracht. In Oslo gab es neue Geschäfte für Lebensmittel, die in Tvedestrand nicht aufzutreiben waren. Pasta Pronto in Pilestredet. Olivenöl in den Regalen. Tomatensoßen. Basilikum. Ein Duft von Italien. Wir müssen irgendwann mal nach Italien fahren, sagen wir zueinander. Sehen, wie es da so ist.
Die lange Autofahrt zurück nach Oslo. Die Kassetten als Trost. Das Gefühl, dass etwas überhaupt nicht stimmt. Dass alles eines Tages zusammenbrechen wird. Die plötzliche Sehnsucht nach Wein.
Pauls hat Decibel Booking aus einem der prachtvollsten Gebäude an der Karl Johans gate in eine der schönen Villen von Homansbyen verlegt. Dort leitet er Management und Plattenfirma, die er zusammen mit seinem Bruder Helge und mit Ole A. Sørlie betreibt. Paul hat ein Gespür für alles, was sich verkaufen lässt. Jetzt erzählt er von den Schlümpfen. Kleine widerliche Fledermausklumpen, die mit Mäusestimmen lustige Lieder singen. Das verkauft sich wie warme Semmeln. Aber Paul ist keiner, der herumläuft und allen erzählt, wie viel Geld er verdient. Er sitzt an dem ehrwürdigen alten Schreibtisch und nuckelt an seiner Pfeife. Eine greifbare Ruhe umgibt ihn. Vielleicht hat er soeben einen der wichtigsten Künstler für das Kalvøyafestival des nächsten Jahres verpflichtet. Vielleicht ist es Bob Dylan. Van Morrison. Was weiß ich.
»Danke, dass du gekommen bist«, sagt er.
»Ich muss mich doch bedanken.«
»Das weißt du noch nicht. Aber jedenfalls ist Cornelis hier und will mit dir reden.«
»Wo ist er?«
»Im Lorry unten im Parkvei. Da wartet er auf dich. Geh hin.«
»Kommst du nicht mit?«
»Nein, dieses Gespräch müsst ihr allein führen. Ich buche Konzerte und bringe Schallplatten heraus. Ihr schreibt Lieder.«
Ich gehorche. Draußen weht Wind. Er ist Oktober. Die Laubbäume lassen ihre Blätter fallen. Ein Hauch von etwas, fast wie eine Vorwarnung, auf den Trottoirs zwischen den Villen in der Oscarsgate.
Er sitzt am hintersten Tisch vor der weißen Mauer. An diesem Ende des Lokals ist sonst niemand. Er sitzt dort und trinkt still vor sich hin. Wein und Schnaps, ich weiß nicht, welchen. Er strahlt eine Einsamkeit aus, die jeden normalen Menschen sofort aus seiner Nähe vertreiben würde. Gerade jetzt ist er ein sinkendes Schiff, ohne Passagiere, aber mit einer Mannschaft: ihm selbst. Im Boden des Bootes klafft ein Leck. Wasser sickert vom Bug her herein. An Bord gibt es keine Rettungswesten. Kein Funkgerät. Das hier ist ein vorherbestimmter Schiffbruch.
Aber warum sinkt er, frage ich mich, als ich mich ihm gegenüber setze. Als wir Leve Patagonia eingespielt haben, haben wir fast nicht miteinander geredet. Als ob er so wenig mit mir zu tun haben wollte wie möglich. Er wollte vergessen, dass ich diese Lieder geschrieben hatte. Er wollte sie singen, als ob sie von ihm selbst stammten. In diesem Moment herrschte im Studio eine fast feindselige Stimmung. Aber als er ans Mikrofon trat und ich in den Kontrollraum ging, entspannte er sich. Hatte es ihm gefallen, dass ich durchaus Einwände vorbrachte? Dass ich um drei Einspielungen bat, dazu einige Korrekturen? Dass ich nicht der gutgläubige Trottel war, für den er mich gehalten hatte? Dass ich Ideen hatte, Vorschläge für Phrasierungen? Dass er nicht über die Wörter stolpern durfte. In einem künstlerischen Prozess muss man Selbstvertrauen haben. Es war mein Lied. Ich nahm es zurück, als ich mit dem Techniker zusammensaß. Er hörte zu. Er richtete sich nach meinen Anweisungen. Jetzt kam er zu mir zurück. Hatte an mich gedacht. Paul, unser gemeinsamer Manager, hatte offenbar über mich gesprochen. Vielleicht war ja mit mir noch mehr anzufangen?
Cornelis Vreeswijk wirkte so klein und in sich zusammengesunken, als er dort saß, eine Zigarette rauchte, aus dem Rotweinglas trank und aus dem anderen, aus dem es nach Jägermeister roch. Ich hätte ihn gern gefragt, wie es ihm ging. Aber konnte ich ihm solche intimen Fragen stellen?
»Patagonia hat mir gefallen«, sagt er plötzlich. »Lillemor und Ole haben beide verdammt gute Arbeit geleistet.«
»Ja«, sagte ich.
»Du arbeitest jetzt mit Lillemor?«
Er sieht mich an. Soll ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Gibt es Schwierigkeiten zwischen den beiden? Lill sang doch bei ihren Konzerten seine Felicia-Lieder. Ich schaue ihm in die Augen.
»Ja«, sagte ich. »Das hat sehr viel Freude gemacht.«
Er nickt, sagt, vor allem an sich selbst gerichtet: »Das wird ungeheuer verkaufen.«
Mein Magen krampft sich zusammen. »Da bin ich nicht so sicher«, sage ich.
Er nickt. »Nein, man kann nie richtig sicher sein.«
Er scheint abzuschweifen. Ein Zeichen von Müdigkeit? Das Gespräch gerät ins Stocken. Ich versuche nicht, es wieder in Gang zu bringen. Es ist fast, als ob er mich vergessen hätte, wie er da auf der anderen Seite des kleinen Tisches sitzt, einen langen Zug an der Zigarette macht, an meiner Schläfe vorbeistarrt, als wäre er allein.
Ich räuspere mich vorsichtig.
»Ach, richtig!« Jetzt hat er mich wieder entdeckt. »Hamsun«, sagt er. »Knut Hamsun.«
»Ich weiß«, sage ich.
»Was weißt du?«
»Nein, Entschuldigung«, sage ich verlegen. »Ich weiß nicht mehr, als was Paul Karlsen mir gegenüber erwähnt hat, eben, dass du dich mit Hamsun beschäftigst.«
»Ich beschäftige mich nicht mit Hamsun«, sagt er. »Ich will, dass du dich mit Hamsun beschäftigst.«
»Ich?«
Wir reden mehrere Stunden lang. Ich fange ebenfalls an zu trinken. Weißwein. Keiner von uns hat Appetit. Ich weiß, dass er krank ist. Irgendwer hat es mir erzählt. Gibt er nur vor zu trinken? Er bestellt jedenfalls nicht nach. Vielleicht bedeuten die beiden Gläser eine Sicherheit, wie auch die Zigarette. Meine Sicherheit ist der Finger, den ich in den Hals stecke. Aber in den letzten Wochen hatte ich so schlimme Magenschmerzen und so oft unerwartet Brechreiz, dass ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Ist es das, was Todesritt genannt wird? Wenn man sich einen Lebensstil aussucht, der die Innereien ruiniert?
»Der wilde Chor«, sagt Cornelis. »Den solltest du vertonen. Machst du das?«
»Warum machst du das nicht selbst? Niemand schreibt so gute Melodien wie du.«
»Ich vertrockne, verstehst du?«
Ich nicke.
»Aber die Stimme habe ich noch immer«, fügt er hinzu.
Ich kann jetzt meine schmeichelnde Stimme nicht ertragen. Deshalb erzähle ich ihm nicht, dass seine Versionen von Evert Taube und Carl Michael Bellman die allerbesten sind. Dass seine Stimme schon seit vielen Jahren in unserem Haus erklingt, fast jeden Tag, jedenfalls jede Woche.
Aber warum tu ich das nicht? Glaube ich, dass an jeder Straßenecke Leute stehen und ihm Komplimente zurufen?
Das Einzige, was ich sage, ist wie ein Signal unter Verschworenen: »Auf Cajsa Lisas Bett gelegt, am späten Abend.«
Er lächelt. Er weiß, warum ich das sage. Glimmende Nymphe öffnet einen Zipfel des Zeitlosen, als sähen wir plötzlich diese Menschen, die im 18. Jahrhundert in Stockholm lebten und liebten. Er konnte sie so lebendig machen, sie uns zeigen, ihr Begehren, ihre Träume und ihre Armut.
Für Cornelis Vreeswijk Hamsun-Lieder schreiben? Egal, für wen ich schreibe, ich schreibe für Ole. Aber vielleicht wäre es doch möglich?
»Es ist jedenfalls eine große Ehre«, sage ich.
»Hör auf mit dem Blödsinn«, sagt Vreeswijk abwesend, als habe er gar nicht richtig zugehört. »Hamsun, verstehst du? Was will mein Herz, was will mein Fuß? Jedes Dilemma des Lebens. Wann wird man ein großer Dichter? Wenn man schreibt, um zu überleben.«
König Olav fährt auf Staatsbesuch nach Finnland. Er nimmt Außenminister Knut Frydenlund mit.
Zu Hause in Oslo betritt Jens Evensen das Rednerpult bei der Norwegischen Industriearbeitergewerkschaft. Vor einem Jahr wurde er im Außenministerium zum Botschafter und Berater für Völkerrecht ernannt. Jetzt lanciert er die Vorstellung einer atomwaffenfreien Zone im Norden. Einer isolierten kernwaffenfreien Zone, die von den Atommächten respektiert werden würde.
Es ist eine Rede, die alle Friedensbewegten und die ganze Linke begeistert aufnehmen. Vater ist hingerissen. Was ist an diesem Evensen, der Außenminister Frydenlund in den Wahnsinn treibt und bewusst mit der offiziellen Politik der Regierung bricht? Was sorgt dafür, dass er im Jahr darauf beim Kongress der Sozialdemokratischen Partei Unterstützung findet?
Während ich schreibe, muss ich denken: Fängt es hier eigentlich an? Die norwegischen Nachrichtendienste wissen bereits, dass Berge Furre von der linkssozialistischen Partei SV in engem Kontakt zum KGB-Obersten Stanislaw Tschebotok steht. Sie wissen bereits, dass sich Einar Førde und Arne Treholt mit ihrem engen Kontakt zu sowjetischen Diplomaten und Politikern in einer Grauzone bewegen. Vertreten sie die Sache der Sowjetunion? Untergraben sie das Fundament des westlichen Verteidigungsbündnisses? Als Evensens rechte Hand Arne Treholt im selben Jahr zusammen mit dem wichtigen sozialdemokratischen Politiker Thorbjørn Jagland das Buch Atomwaffen und Sicherheitspolitik redigiert, hören alle NATO-Anhänger bedrohliche Signale. Warum verlangt Evensen nicht, dass auch die sowjetischen Atomwaffen auf Kola und in der Ostsee verschwinden sollen? Soll Norwegen zu einem Teil der Sowjetunion werden? Sollen wir jetzt Brotkrusten essen und Wodka trinken? Sollen wir die E-Gitarre durch die Balalaika ersetzen? Sollen wir alle auf dem Youngstorg im Gleichschritt marschieren, umringt von sowjetischen Panzern, und dabei Die Internationale singen? Der norwegische Komiker bringt diese amerikanisierte Angst zur Sprache, als er zusammen mit Totto Osvold im NRK über Iwan und die Pusztabande spricht. Das ist der Kommunistenhasser in einem Format, das selbst Kommunistenhasser zum Lachen bringen kann. Vater und ich liegen keuchend auf dem Boden.
Ich denke an Amalie, die mir die ganze Zeit fehlt. Meine Klavierlehrerin. Meine Freundin. Die mir so viel bedeutet hat und die ich einmal sogar heiraten wollte, obwohl sie älter ist als meine Mutter. Aber wir finden nicht mehr zueinander. Ich will sie nicht mit Musik quälen, die sie nicht interessiert, und ich will sie nicht an ihre Erwartungen an mich erinnern. Jetzt lese ich ihren Bruder, den Kriegshelden und General Johan H. Christie, der zu dem Buch von Treholt und Jagland beigesteuert hat. Er, der am 13. April 1940 an den Kämpfen bei Kongsvinger beteiligt war, der auf Skiern durch dieses gewaltige Waldgebiet nach Westen zum Mjøsa lief, in der Hoffnung, die norwegischen Widerstandstruppen zu finden, nur um feststellen zu müssen, dass sie kapituliert hatten. Er, der zu General Otto Ruge in Målselv in Troms geschickt wurde, wo Ruge & Co die gewaltige Begabung der Sängerin Aase Nordmo Løvberg entdeckten. Er, der am 7. Juni König Haakon und die Regierung auf dem Kreuzer Devonshire nach Schottland begleitete. Er, der dabei war, als Little Norway gegründet wurde, das Trainingslager für Flieger im kanadischen Toronto, ehe er nach London versetzt wurde, um die norwegischen Jagdgeschwader aufzubauen. Weil ich immer von Evensen überzeugt war und gesehen habe, wie die 200-Meilen-Zone an der norwegischen Küste, wo ich regelmäßig auf Tournee war, Bedeutung gewann, hörte ich immer besonders aufmerksam zu, wenn er in den Nachrichten zu Wort kam. Viele Jahre lang war er auch Vaters Held gewesen. Er behielt die skeptische Einstellung der NATO gegenüber, die eine Voraussetzung dafür war, in den sechziger und siebziger Jahren überhaupt der norwegischen Linken anzugehören. Und wer waren diese Menschen, die es wagten, von atomwaffenfreien Zonen zu fabulieren? Christie hatte in der Schwadron 35 gedient. Er hatte Bomben über Deutschland abgeworfen. Sein erster Einsatz über dem Ruhrgebiet endete damit, dass sein Flugzeug mit großen Löchern in Tragflächen und Rumpf und mit einem in Fetzen geschossenen hydraulischen System nach England zurückkehrte. Christie, einer unserer höchstdekorierten Kriegshelden, mit dem Kriegskreuz mit Schwertern, der St. Olavs-Medaille mit Eichenlaub und dem Distinguished Service Order und dem Order of the British Empire, schreibt jetzt: »Wenn ich an die Waffen denke, die wir damals benutzt haben (1940–45) – die pure Steinzeitausrüstung verglichen mit dem, was uns jetzt zur Verfügung steht –, und wenn ich dann versuche, mir vorzustellen, wie Europa nach einem Dritten Weltkrieg aussehen würde, der durchaus nicht undenkbar ist – dann überkommt mich eine tiefe Verzweiflung.« Christie wird zu einem der wichtigsten Akteure in der Organisation Generäle für den Frieden/Generäle gegen Atomwaffen werden, ohne zu wissen, dass er viele Jahre später beschuldigt werden wird, in einer Verbindung zur Stasi und zum KGB-Stützpunkt in Karlshorst in Ostberlin gestanden zu haben. Ja, alle diese profilierten Personen, die jetzt gegen Atomwaffen kämpfen, wissen nicht, dass sie als Spione für die Sowjetunion und die DDR stigmatisiert werden sollen, dass die gesamte Partei SF, die spätere SV, beschuldigt werden wird, üble Kontakte gepflegt zu haben, wodurch am Ende bewiesen werden soll, dass die gesamte norwegische Friedensbewegung der vergangenen zwanzig Jahre eigentlich von der von Moskau finanzierten und zutiefst verdächtigen Organisation Weltfriedensrat gelenkt worden sei.
»Ach was?«, hätte Vater gesagt, wenn er damit konfrontiert worden wäre. »Und wie viele Milliarden schießen die USA dazu? Sind alle Initiativen aus dem Osten von Natur aus falsch? Und was ist mit der Rüstungsindustrie? Wer verdient daran am meisten?«
Atomwaffenfreie Zone im Norden?
Niemals war die Linke innerhalb der norwegischen Sozialdemokratischen Partei so naiv, so wahnsinnig, gesehen mit den Augen von USA und NATO.
Ronald Reagan. Wir sehen ihn jetzt immer häufiger im Fernsehen. Er ist nicht Johan Christie. Er ist nicht über Deutschland geflogen, um sein Land zu verteidigen. Ein halbes Jahr zuvor hätte niemand es für möglich gehalten, dass ein zweitrangiger Schauspieler den amtierenden Präsidenten herausfordern könnte. Ich sitze zusammen mit Vater im Frognervei in der Küche, wie in alten Tagen. Wir wissen nicht alles, was wir später über Reagan erfahren werden, dass er in den Vierzigern in Hollywood als Gewerkschaftsführer Karriere machte, dass er in enger Verbindung zur MCA stand, der Music Corporation of America, seiner früheren Arbeitgeberin. Dass einige seiner mächtigsten Freunde in der amerikanischen Filmindustrie mit der Mafia in Chicago unter einer Decke steckten, dass die Gewerkschaften in einer von Streiks getroffenen Industrie korrupt waren. Dass die Vertrauensleute die Mafia anriefen, um zu fragen, welchen Preis sie verlangen sollten, damit eine Filmproduktion vom Stapel laufen könnte, ohne Unruhen bei der Belegschaft. Wir wussten nicht, dass die MCA eine wichtige Unterstützerin war, als Reagan zum Gouverneur von Kalifornien gewählt wurde. Wir wussten auch nicht, dass Staatsanwälte versetzt und geplante Prozesse wegen Korruption eingestellt werden würden, sowie Reagan an die Macht gekommen wäre.
»Jimmy Carter ist ein honoriger Mann«, erklärt Vater energisch.
»Aber die Geiseln aus dem Iran hat er nicht nach Hause holen können.«
»Was ist das für ein Argument? Die Welt ändert sich. In der Außenpolitik haben die USA gezeigt, dass sie keine Mittel scheuen. Die Diktatoren in Lateinamerika können sich bei ihnen bedanken. Carter wird feige genannt, nur weil er nicht aggressiv ist. Ich verstehe die Welt nicht mehr.«
Und ich sehe es ihm an. Dass sich ein neues Alter in seinem Gesicht festgesetzt hat. Ein Alter, das ich noch nie gesehen hatte, das nicht mit der Anzahl der Falten zusammenhängt, sondern vor allem mit dem Blick, einem Funken, der fehlt, einer Mattigkeit in der Haut, bei der ich an Leder denken muss. Und dann muss ich auch an Tante Svanhild denken, die allein in ihrer Wohnung sitzt und uns auf diesem Weg weit voran ist. Sie ist dort angelangt, wo der Wald dichter wird, wo die Schatten die Sonne verdecken. Vielleicht denke ich an das Gedicht von Halldis Moren Vesaas. Halldis, die mir immer so nahekommt, wenn wir für Aschehoug auf Tournee gehen. Die geschrieben hat: »Mein Wort soll danke sein / mein Weg biegt ab / und wird getrennt von deinem / biegt ab in ein Land, wo aller Schmerz rein ist / und das Antlitz des Todes mild.«
»Ich fürchte mich jetzt vor der Welt«, sagt Vater plötzlich.