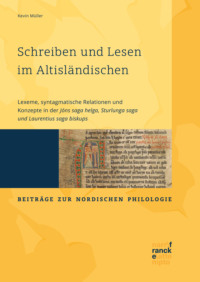Kitabı oku: «Schreiben und Lesen im Altisländischen», sayfa 15
6.3. Die Frames von dikta der Jóns saga helga und der Laurentius saga biskups im Vergleich
Die Frames von dikta in den beiden Sagas ergeben ein sehr ähnliches Bild. Der Kernframe besteht aus den Attributen AUTOR als Agens und TEXT als Thema. Als Werte für den AUTOR gibt es diverse geistliche Ränge: biskup ‚Bischof‘, erkibiskup ‚Erzbischof‘, kórsbróðir ‚Chorherr‘, prestr ‚Priester‘. Ausserdem spielen auch in diesem Zusammenhang die geistliche Bildung (klerkdómr) und Lateinkompetenz (kunna latínu) eine Rolle, welche Attribute des AUTOR-Frames darstellen. Dazu gehören auch das Gedächtnis und der vorbildliche Lebenswandel. Die Werte für den TEXT sind diverse Textsorten wie bréf ‚Brief‘, saga ‚Geschichte‘ und vers ‚Vers‘. Eine Ausnahme bildet wie schon erwähnt der Wert várrar frúar psaltari ‚der Psalter Unserer Frau‘, der für einen bestimmten Text steht. Daneben sind in beiden Sagas die Attribute QUALITÄT als Adverb und AUFTRAGGEBER als Dativobjekt oder als Subjekt in Kausativkonstruktionen belegt. Das Attribut QUALITÄT hat die Adverbien heiðarliga ‚ehrenvoll‘ und val ‚gut‘ als Werte, die beide positiv sind und in Übereinstimmung mit der Bildung des Autors stehen, d.h. es besteht ein Constraint zwischen den Werten der Attribute AUTOR und QUALITÄT. Das Attribut AUFTRAGGEBER hat die Werte erkibiskup und herra ‚Herr‘, beides Titel für ranghohe Personen. Die Laurentius saga biskups hat ausserdem das Attribut SPRACHE im Präpositionalobjekt á e-t mit dem Wert latína ‚Latein‘. Dieser Wert kommt auch im Kontext häufig vor und hat eine enge Beziehung zum TEXT, was die Komposita latínubréf ‚Lateinbrief‘ und -saga demonstrieren. Zwischen den Werten der beiden Attribute besteht folglich ein weiterer Constraint. Im Kontext lassen sich weitere bekannte Attribute finden: QUELLE mit dem Wert ellri menn ‚ältere Leute‘, SCHRIFTTRÄGER mit den Werten bolli, bréf, rolla und psaltari. Diese gehören zum Attributframe TEXT. Die Lexeme efni und mál verweisen auf mögliche Attribute wie INHALT, SITUATION und ANGELEGENHEIT. Diese Attribute kommen aber nicht als Ergänzung von dikta vor. Ein Abgleich mit den Belegen aus dem ONP (dikta) erweitert diesen Frame kaum. In drei Belegen hat dikta die Ergänzung af e-m/-u (Cahill 1983: 6, Unger 1871: 573, Unger 1874: 863), die bei den anderen verba scribendi auf das Attribut STOFF verweist. In diesen Rahmen lassen sich auch efni und mál einordnen. Ein Beleg aus den Exempla weist die Ergänzung með mikilli snild (vgl. Gering 1882: 79) ‚mit grosser Gewandtheit‘ auf, die sich ebenfalls bei setja saman nachweisen lässt und sich auf die elocutio bezieht. Diese Gewandtheit hängt eng mit der Qualität des Textes zusammen, so dass die Adverbien val und heiðarliga auch hier einzuordnen sind und die Bezeichnung elocutio besser auf das Attribut zutrifft.
Soweit das Belegmaterial eine Schlussfolgerung erlaubt, stehen bei dikta die rhetorischen, insbesondere die formalen Aspekte der elocutio im Vordergrund. Dafür sprechen die Nennung der Textsorten, der Sprache und der Gewandtheit. Die Attribute ANGELEGENHEIT, INHALT, QUELLE, SITUATION und TEIL verdeutlichen dies ebenfalls, weil sie als Ergänzung von dikta nicht belegt sind und in Beziehung zur inhaltlichen Seite des Textes stehen. Eine Ausnahme bildet das Attribut STOFF. Die inhaltliche Seite kann bei keinem Text ausgeschlossen werden. Sie steht bei dikta aber deutlicher im Hintergrund als etwa bei setja saman, wo Teile aus in Quellen überlieferten Stoffen zu einem Text zusammengefügt werden. Dies gilt auch für den SCHRIFTTRÄGER, der als Ergänzung nicht nachzuweisen ist und in materieller Beziehung zum Text steht. Dies spricht zusätzlich für die vom Schreiben und Vorlagen unabhängige rhetorische Konzeption des Textes.
7. segja fyrir
Das Partikelverb segja fyrir bedeutet laut Baetke (2002: 522) „voraussagen; anordnen, bestimmen; vorschreiben“, aber in einem schriftlichen Kontext auch „diktieren, verfassen“. Fritzner (1886–96: III, 197) übersetzt die Konstruktion „segja fyrir e-u“ mit „sige hvorledes der skal gjøres, hvorledes det skal være eller gaa med noget“ ‚sagen, wie es gemacht werden soll, wie es sein oder mit etwas gehen soll‘ und erwähnt keine Bedeutung ‚diktieren, verfassen‘, obwohl er den unten noch zu analysierenden Beleg aus der Sturlunga saga zitiert. Dabei berücksichtigt Fritzner nicht, dass bei diesem Beleg fyrir den Akkusativ regiert. Baetkes Übersetzung ist dagegen nicht ganz unberechtigt, da segja fyrir eine Lehnübersetzung von lat. dictare sein könnte, welches neben ‚diktieren‘ auch ‚vorsagen, befehlen etc.‘ bedeuten kann (vgl. Georges 1998: I, 2139), und somit dem altnordischen Pendant semantisch entspricht. Mundal (2012: 222f.) erwähnt einen Beleg von segja fyrir, das sie mit nengl. decide übersetzt, aus dem Prolog zur Sverris saga in der Flateyjarbók „ok hann fyrir sagde hue rita skylldi edr huernig setja skylldi“ (Unger/Vigfússon 1860: II, 533) mit der Übersetzung „and he [= King Sverrir, KM] decided what to write and how to word it.“ Die Übersetzung ist aber ungenau, weshalb hier folgende, wörtlichere Übersetzung vorgeschlagen wird: ‚Und er sagte vor, wie man es schreiben sollte oder auf welche Weise man es setzen sollte‘. König Sverrir kannte seine Biographie, war also an der inventio beteiligt, und ‚sagte vor‘, wie man sie schreiben und anordnen sollte, was stark auf die elocutio und dispositio hindeutet. Somit war König Sverrir gemäss diesem Prolog an allen rhetorischen Akten beteiligt und segja fyrir wäre eine altnordische Entsprechung von lat. dictare.
Im hier untersuchten Korpus gibt es nur zwei Belege in einem schriftlichen Kontext, in der Sturlunga saga und in der Laurentius saga biskups. Der eine Beleg von segja fyrir in einem schriftlichen Kontext1 aus der Sturlunga saga stammt aus dem sogenannten Prolog (s. a. Kap. II.3.2.1.):
a) Enn þær sogor, er siþan hafa gorz, voro lit ritaþar aðr Sturli skalld Þorþar son sagði fyrir Islendinga sogor, oc hafdi hann þar til visindi af froþvm monnum, þeim er voro a avndverþvm davgom hans, enn svmt eptir brefvm þeim, er þeir ritvþv, er þeim voro samtiþa, er sogornar erv fra. Marga lvti matti hann sialfr sia, þa er a hans davgvm gerdvz til stortiþinda (StS1 119f.).
Aber jene Geschichten, welche danach geschehen sind, wurden ein wenig vorher geschrieben, als der Dichter Sturla Þórðarson die Geschichten der Isländer vorsagte, und er hatte dafür das Wissen von klugen Leuten, welche in seinen frühen Jahren lebten, und manches aus den Briefen, welche jene schrieben, welche in der Zeit lebten, aus der die Geschichten stammen. Viele Dinge konnte er selbst sehen, die in seinen Tagen zu Grossereignissen gemacht wurden (Übers. KM).
Subjekt von segja fyrir ist Sturla Þórðarson und Akkusativobjekt sǫgur ‚Geschichten‘. Das polyseme Lexem saga kann als Wert für das Attribut TEXT stehen, das Genitivattribut Íslendinga ‚Isländer (Gen. Pl.)‘ hingegen für den INHALT. Dieser Text ist selbst Teil der Kompilation Sturlunga saga mit dem modernen Titel Íslendinga saga (im Singular). Das Resultat seines ‚Vorsagens‘ ist also ein Text, es ist bei diesem Beleg aber unklar, wie stark Sturla Þórðarson am Entstehen dieses Textes beteiligt war. Der Kontext weist Parallelen zum Prolog der Sverris saga auf. Sturla war einerseits wie König Sverrir Zeuge des Geschehens (marga hluti mátti hann sjálfr sjá ‚viele Dinge konnte er selbst sehen‘), andererseits verwendet er Quellen: vísindi af fróðum mǫnnum ‚das Wissen von klugen Leuten‘ und bréf ‚Briefe‘. Sturla war also sicher an der inventio beteiligt. Das Epitheton skáld ‚Skalde‘ spricht aber auch für seine elocutio, auch wenn sich diese auf metrische Dichtung bezieht. Es ist in diesem Kontext am wahrscheinlichsten, dass segja fyrir die altnordische Entsprechung für lat. dictare ist. Deshalb steht das Agens für das Attribut AUTOR oder eventuell KOMPILATOR, weil Quellen erwähnt sind. Das Thema steht wie oben schon angenommen für den TEXT. Die Attribute INHALT und QUELLE kommen im Kontext zwar vor, sind an dieser Stelle aber keine Ergänzung von segja fyrir.
In der Laurentius saga biskups ist segja fyrir mit einem möglicherweise schriftlichen Text nur einmal an einer Stelle belegt, welche wegen einer Lakune in der B-Redaktion nur in der A-Redaktion erhalten ist: b) „manudaginn birte [bisku]penn sira Þorsteine. ath hann villde giora testamentum sitt. og alla skipan sina. […] sagdi hann þa fyrer sialfur þuilika skipan hann [gior]di“ (LSB 138). ‚Am Montag offenbarte der Bischof Priester Þorsteinn, dass er sein Testament machen wolle und seinen [letzten] Willen. […] Er sagte dann selbst vor, welchen [letzten] Willen er hatte‘ (Übers. KM). Subjekt ist der im Sterben liegende Bischof Laurentius. Das Akkusativobjekt enthält das Lexem skipan ‚[letzter] Wille‘.2 Skipan ist eine Substitution von testamentum, welches an sich nicht schriftlich sein muss. Dass ein Teil von Laurentius‘ letztem Willen schriftlich festgehalten wurde, zeigt ein Satz am Ende des Kapitels: „[…] skrifande med honum til Gudmundar abota huad hann skipade klaustrinu.“ (LSB 139). ‚[…] und gab ihm ein Schreiben an Abt Guðmundr mit, was er dem Kloster vermachte‘ (Übers. KM). Das Verb skipa ‚bestimmen‘, von dem das Substantiv skipan abgeleitet ist, stellt den Sprechakt dieses Schreibens dar, nämlich was Laurentius dem Kloster testamentarisch verfügt. Dass der Schriftträger des Testaments ein Brief sein könnte, zeigt auch das im ONP (testamentumbréf) erwähnte Kompositum testamentumbréf ‚Testamentbrief‘ mit vier Belegen aus norwegischen und isländischen Urkunden aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Als Absender eines Testamentbriefes war er sicher an der inventio beteiligt. Wenn er denn Inhalt diktierte, gehörten aber auch die dispositio und elocutio dazu, was aber auch ein Schreiber übernehmen konnte. Bei diesem Beleg verbindet segja fyrir die Attribute AUFTRAGGEBER oder AUTOR und INHALT oder TEXT.
Die geringe Zahl der Belege erschwert ein eindeutige Zuteilung der Ergänzungen des Verbs zu den Attributen des Frames. Es gibt jedoch in den beiden Belegen aus dem Korpus sowie in jenem aus der Flateyjarbók auffallende Parallelen. Das Agens steht mit grösster Wahrscheinlichkeit für das Attribut AUTOR, KOMPILATOR oder den AUTRAGGEBER mit den Werten biskup ‚Bischof‘ und sturlungr ‚Sturlunge‘, sowie konungr ‚König‘ in der Flateyjarbók. Das Thema steht für den TEXT mit dem Wert saga oder den INHALT mit dem Wert skipan. In diesem Punkt unterscheidet sich der Prolog der Flateyjarbók, weil das Akkusativobjekt leer ist, die Leerstelle könnte aber auf die Sverris saga verweisen, wodurch ein Wert für den TEXT vorhanden wäre. Wegen der dünnen Beleglage muss dieses Verb in einem breiteren Korpus analysiert werden. Das ONP (segja) führt unter dem Partikelverb segja fyrir zahlreiche Belege an, welche zu einem grossen Teil die Bedeutungen ‚voraussagen, prophezeien‘ oder ‚befehlen, bestimmen‘ haben, die mit Baetke (2002: 522) übereinstimmen. Einige wenige Belege stehen in Bezug zur Schrift, von denen zwei die obige Analyse noch ergänzen können.
Der erste Beleg aus der Hirðskrá beschreibt eine Pflicht des Kanzlers („skyllda kancelers“) folgendermassen: „at […] gera þau bref sem konongr sægir honum firir“ (Keyser/Munch 1848: 409) ‚die Briefe zu machen, die ihm der König vorsagt‘ (Übers. KM). Subjekt ist der König. Das Akkusativobjekt ist von der Relativpartikel sem besetzt, die auf bréf im Hauptsatz referiert. Das Dativobjekt honum steht für den Kanzler. Das Briefemachen (gera bréf) umfasste sowohl Schreiben als auch dispositio und elocutio (vgl. Kap. II.9.4.). Segja fyrir beinhaltet bei diesem Beleg wahrscheinlich nur die inventio.
Der zweite Beleg stammt ebenfalls aus der Flateyjarbók: „Gledi gud allzualldandi þaa er skrifadu ok þann er fyrir sagdi ok iumfru sancta Maria“ (Unger/Vigfússon 1860: I, [-1]). ‚Der allmächtige Gott erfreue jene, die schrieben, und jenen, der vorsagte, und die heilige Maria‘ (Übers. KM). Wer das Buch schrieb, ergibt sich aus dem Kontext, denn davor wird erwähnt, dass die Priester Jón Þórðarson und Magnús Þórhallsson das Buch geschrieben („skrifat“) haben. Die Relativpartikel er im Subjekt des in obigem Zitat rekurrierenden skrifa muss auf diese verweisen. Segja fyrir stellt hingegen keine Rekurrenz dar. Am Anfang des Prologs steht, dass Jón Hákonarson das Buch besitzt („aa“). Er ist die einzige Person, auf welche die Relativpartikel er im Subjekt von segja fyrir noch verweisen kann. Es ist am warscheinlichsten, dass er als Besitzer des Buches dieses auch in Auftrag gegeben hat. Somit nimmt er die Rolle AUFTRAGGEBER ein. So deutet es auch Würth (1991: 27).
Diese beiden zusätzlichen Belege ergeben ein klareres Bild. Im Briefverkehr ist das Agens von segja fyrir mit dem Absender identisch. Könige und Bischöfe hatten Sekretäre, welche das Schreiben und zu einem gewissen Grad das Verfassen der Briefe übernahmen. Der Absender war also nur an der inventio beteiligt. Die Rolle ABSENDER im Korrespondenzframe ist mit dem AUFTRAGGEBER im Schreibframe vergleichbar. Diese trifft sowohl auf König Sverrir als Auftraggeber seiner Biographie als auch auf Jón Hákonarson als Auftraggeber der Flateyjarbók zu und müsste folglich auch für Sturla Þórðarson gelten. Es lässt sich allerdings nicht überprüfen, wie stark der Einfluss des Auftraggebers auf die Entstehung des Textes war.
8. setja saman
Das Partikelverb setja saman ist polysem. Die bisherige Forschung zum Schreiben ordnet ihm die Bedeutungen ‚verfassen‘ und ‚kompilieren‘ zu. Baetke (2002: 529) übersetzt es mit „zusammensetzen, errichten; verfassen, schreiben“ und gibt weder syntaktische Ergänzungen noch Zitate an, um die verschiedenen Bedeutungen zuordnen zu können. Fritzner (1886–96: III, 217) übersetzt es mit „sammensætte, af flere Dele“ ‚zusammensetzen, aus mehreren Teilen‘, „istandbringe noget“ ‚etwas zustandebringen‘. Die Bedeutung ‚schreiben‘ wie in Baetke (2002: 529) fehlt. Fritzner zitiert aber mehrere Beispiele mit den Akkusativobjekten bók und sǫgu und setzt das Lemma mit lat. compōnere in Verbindung, welches laut Georges (1998: I, 1357–62) auch die Bedeutung „mündlich oder schriftlich zusammensetzen, aufsetzen, verfassen, abfassen, entwerfen“ hat. Es handelt sich also wahrscheinlich um eine Lehnübersetzung aus dem Lateinischen. Im ONP (setja) sind die Belege von setja saman nach dem Akkusativobjekt gegliedert. Für die Substantive bók seit 1280 und saga seit 1270 gibt es mehrere Belege. Für die Bedeutungen ‚verfassen‘ oder ‚schreiben‘ scheint ein schriftlicher Bezug des Akkusativobjekts entscheidend zu sein. Setja saman ist in allen Sagas des vorliegenden Korpus ausser der S-Redaktion der Jóns saga helga belegt.
8.1. Die L-Redaktion der Jóns saga helga
In der Jóns saga helga ist setja saman nur in der jüngeren L-Redaktion an zwei Stellen belegt, welche beide in Kommentaren vorkommen. Die eine nennt den Mönch Gunnlaugr Leifsson (gest. 1218/19) als Autor der verloren gegangenen lateinischen Version der Jóns saga helga (vgl. Foote 2003: CCXV, CCLXXXIII):
a) let hann setia skola heima þar aa staðnum vestr fra kirkiu dyrum ok let smiða val ok vandliga. huern wer sáám meðr vorum augvm. segir brodir Gunnlaugr er latinu sǫghuna hefir saman sett (JSH 82).
Er liess zu Hause an der Stelle westlich der Kirchentür eine Schule errichten und liess sie gut und sorgfältig bauen, sagt Bruder Gunnlaugr, welcher die Geschichte auf Latein zusammengesetzt hat (Übers. KM).
Die Relativpartikel er besetzt das Subjekt und verweist auf den Mönch Gunnlaugr. Das Akkusativobjekt enthält das Kompositum latínusaga, bestehend aus dem Kopf saga ‚Geschichte‘ als Wert für das Attribut TEXTSORTE und dem Modifikator latína ‚Latein‘ als Wert für das Attribut SPRACHE, welche die lateinische von der vorliegenden altisländischen Version der Jóns saga helga unterscheiden soll. Der INHALT ergibt sich aus der Situation, weil die vorliegende Jóns saga helga gemeint ist. Da nicht eine bestimmte Textsorte, sondern ein Text ‚zusammengesetzt‘ wird, steht die TEXTSORTE metonymisch für den TEXT. So verbindet setja saman in diesem Beleg die Attribute AUTOR und TEXT.
Die andere Stelle befindet sich in der Erzählung zwischen dem Ableben und dem Begräbnis Bischof Jóns, wo die mündlichen Quellen der Saga erwähnt werden:
b) MEÐR þi at wer siaaum at gudligh miskunn auðsynir ok fagrliga birtir meðr berum jarteinum ok haaleitum taaknum. / dyrdar fulla uerdleika heilags Ions Hola byskups. er oss hardla naud synligt at rita ok saman setia. þa luti er honum eru til lofs ok dyrdar. eptir þi sem til vaar er komit af Roksamligri fra sogn margra skilrikra manna (JSH 98).
Weil wir sehen, dass die göttliche Gnade mit eindeutigen Wundern und erhabenen Zeichen die ruhmvollen Verdienste des heiligen Bischofs Jón von Hólar offenbart und auf schöne Weise zeigt, halten wir es kaum für notwendig, die Teile aufzuschreiben und zusammenzusetzen, welche ihm zu Lob und Ehre gereichen, gemäss dem was vom zuverlässigen Bericht vieler rechtschaffener Leute zu uns gekommen ist (Übers. KM).
Das Verb ist Teil eines Infinitivsatzes, so dass das Subjekt fehlt. Die Leerstelle kann aber mithilfe des Pronomens oss ‚uns‘ aus dem Hauptsatz gefüllt werden, bei dem unklar ist, ob es sich auf eine oder mehrere beim Verfassen und Schreiben beteiligte Personen bezieht. Im selben Satz mit demselben Agens ist auch das Verb rita/ríta belegt, so dass wahrscheinlich eine Person Autor oder Kompilator und die andere der Schreiber war (vgl. Kap. II.3.1.2.g.). Grundsätzlich können auch beide Handlungen von derselben Person ausgeführt werden, was die Laurentius saga biskups mit der Paarformel skrifa ok dikta ‚schreiben und verfassen‘ demonstriert (vgl. LSB 14) oder auch Beispiele von Ludwig (2005: 129) belegen. Das Akkusativobjekt enthält þá hluti ‚die Teile‘ mit einem Relativsatz, welcher den Zweck dieser Teile mit der Paarformel lof ok dýrð ‚Lob und Ehre‘ beschreibt. Im Gegensatz zum ersten Beleg enthält hier das Akkusativobjekt nicht den TEXT, sondern die TEILE aus denen der Text zusammengesetzt wird. Nach welchem Kriterium sie ausgewählt werden, gibt das Attribut ZWECK an. Darauf folgt das Präpositionalobjekt eptir því ‚nach/gemäss dem‘, welches auf das Attribut QUELLE verweist. Der abhängige Relativsatz nennt verschiedene mögliche Werte, von denen frásǫgn aber am nächsten liegt (vgl. Kap. II.3.1.2.g.). Bei den Quellen ist ausserdem fraglich, ob sie mündlich oder schriftlich sind. Gerade bei schriftlichen Quellen wäre Gunnlaugr eher ein Kompilator als ein Autor. Somit verbindet setja saman die Attribute AUTOR/KOMPILATOR, TEIL und QUELLE und steht also für das Auswählen und Zusammenfügen der Teile aus den Quellen, während rita/ríta sich auf das Aufschreiben bzw. Abschreiben beschränkt. Die Frage, wie stark diese Textteile vom Autor verändert wurden, bleibt offen, und kann für die Jóns saga helga nicht überprüft werden, weil die Quellen nicht mehr erhalten sind. Folglich bleibt auch bei Gunnlaugr offen, ob er Autor oder Kompilator war. Würth (2007) stellt bei Übersetzungen ins Altnordische fest, dass mit den Textteilen äusserst verschieden umgegangen wurde, d.h. gewisse wurden wörtlich, andere sehr frei übersetzt bzw. nacherzählt. Es ist also fraglich, ob eine Trennung zwischen Autor und Kompilator überhaupt sinnvoll ist. Deshalb soll im Folgenden vorläufig das Attribut AUTOR verwendet werden, im Bewusstsein, dass das mittelalterliche Autorenkonzept sich von dem modernen unterscheidet.
Der Frame von setja saman in der L-Redaktion der Jóns saga helga hat folgende Attribute: AUTOR mit dem Wert bróðir, TEIL, wofür das Lexem hlutr steht, TEXT mit dem Wert saga und die QUELLE mit dem Wert frásǫgn ‚Erzählung‘. In enger Beziehung zu diesen Attributen stehen noch jene Attribute, welche nicht als Ergänzung von setja saman belegt sind: SPRACHE mit dem Wert latína, welcher einen Constraint zum TEXT darstellt, und ZWECK mit den Werten dýrð und lof, welche einen Constraint zum TEIL darstellen.