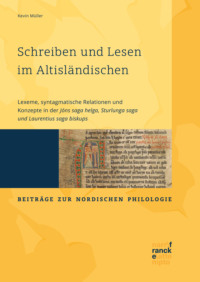Kitabı oku: «Schreiben und Lesen im Altisländischen», sayfa 16
8.2. Sturlunga saga
In der Sturlunga saga ist setja saman fünfmal belegt. Bis auf einen Beleg, bei dem unsicher ist, ob ein schriftlicher Text verfasst wurde, stehen die Belege im Kontext der Autorentätigkeit der Sturlungen. Zunächst soll der unsichere Beleg analysiert werden. Er stammt aus der Þorgils saga ok Hafliða und ist nur in neuzeitlichen Abschriften erhalten:
a) Hrólfr frá Skálmarnesi sagði sǫgu frá Hrǫngviði víkingi ok frá Óláfi liðsmanna-konungi ok haugbroti Þráins ok Hrómundi Grips-syni ok margar vísur með. En þessarri sǫgu var skemt Sverri konungi, ok kallaði hann slíkar lygisǫgur skemtiligstar, ok þó kunna menn at telja ættir sínar til Hrómundar Gripssonar. Þessa sǫgu hafði Hrólfr sjálfr saman setta (StS1 22).
Hrólfr von Skálmarnes erzählte die Geschichte von Hrǫngviðr víkingr, Óláfr liðsmanna-konungr, Þráins Hügelbruch und Hrómundr Gripsson und dazu viele Strophen. Mit dieser Geschichte wurde König Sverrir unterhalten und er nannte solche Lügengeschichten sehr unterhaltsam. Und doch konnten Leute ihre Vorfahren auf Hrómundr Gripsson zurückführen. Diese Geschichte hatte Hrólfr selbst verfasst (Übers. KM).
Subjekt ist Hrólfr von Skálmarnes, ein gesetzeskundiger Mann und Geschichtenerzähler (sagnamaðr, vgl. StS1 9). Akkusativobjekt ist saga, das auf die zu Beginn des Zitates erwähnte Geschichte von Hrǫngviðr et al. rekurriert.1 Es wird da auch erwähnt, dass er die Geschichte erzählte (sagði) und nicht etwa las (las o.ä.). Es gibt auch keinen Hinweis auf einen Schriftträger. Die Szene handelt im Jahr 1119, so dass es unwahrscheinlich ist, dass die Saga in schriftlicher Form vorhanden war, weil es aus dieser Zeit keine isländischen Handschriften gibt. Mundal (2012: 222) deutet es aus diesem Grund als „composition at the oral stage“. Jedoch muss die Stelle kritischer betrachtet werden. Sie ist nur in einer Handschrift aus dem 17. Jh. erhalten, die auf Handschriften aus dem 13. und 14. Jh. zurückgeht. Die Saga war wahrscheinlich kurz vor 1240 geschrieben worden (vgl. Thórsson 1988: III, xxivf.). Die Szene findet somit zwar Anfang des 12. Jh. statt, ist aber erst frühestens im 13. Jh. aufgeschrieben worden. In diesem Kontext trifft es durchaus zu, dass das Konzept von setja saman einen Bezug zur Schriftlichkeit hat.
Die übrigen vier Belege mit den Sturlungen als Autoren stehen hingegen eindeutig in einem schriftlichen Kontext. Der erste davon aus der Íslendinga saga ist in der Króksfjarðarbók überliefert. Es handelt sich um die älteste Erwähnung überhaupt und einzige in der Sturlunga saga der literarischen Tätigkeit Snorri Sturlusons (vgl. Haraldsdóttir 1998: 98):
b) Nv tok at batna með þeim Snorra ok Sturlu, ok var Sturla lǫngvm þa i Reykia-hǫllti ok lagði mikinn hvg aa at lata rita sogv-bækr eptir bokvm þeim, er Snorri setti saman. (StS1 421).
Nun begann es zwischen Snorri und Sturla besser zu werden und Sturla war dann lange in Reykholt und war sehr daran interessiert, Geschichtenbücher von den Büchern, die Snorri verfasste, abschreiben zu lassen (Übers. KM).
Das Verb ist aktiv und hat Snorri Sturluson als Subjekt. Das Akkusativobjekt besetzt die Relativpartikel er, welche sich auf das Substantiv bók ‚Buch‘ im Hauptsatz bezieht. Die QUELLE, sofern es eine gegeben hat, ist eine Leerstelle. Es ist auch unklar, um was für Werke es sich handelt.2 Es lässt sich also nicht überprüfen, ob Snorri Sturluson bei diesem Beleg als Autor oder Kompilator arbeitet und welche seiner Werke gemeint sind. Bók ist ein Wert für den SCHRIFTTRÄGER oder auch das SKRIPT und steht bei diesem Beleg wahrscheinlich elliptisch für das Kompositum sǫgubók ‚Sagabuch‘, mit dem Modifikator saga als TEXTSORTE, sodass [sǫgu]bók metonymisch für den TEXT steht und setja saman wie in der Jóns saga helga wieder die Attribute AUTOR und TEXT verbindet. Wie in der Jóns saga helga kontrastieren auch hier die beiden Verben rita/ríta und setja saman. Ersteres steht in diesem Fall für das Abschreiben und letzteres für das Kompilieren oder Verfassen.
Die drei übrigen Belege kommen alle an derselben Stelle im Sturlu þáttr vor, der nur in Abschriften aus dem 17. Jahrhundert erhalten ist:
c) Ok lítlu síðarr kom Sturla í ina mestu kærleika við konunginn, og hafði konungr hann mjǫk við ráðagerðir sínar ok skipaði honum þann vanda at setja saman sǫgu Hákonar konungs fǫður síns eptir sjálfs hans ráði ok inna vitrustu manna forsǫgn. – En áðr konungr lét setja sǫguna saman, hafði Hákon konungr andaz í Orkneyjum, ok þótti mǫnnum þat mikil tíðindi um ǫll Norðrlǫnd ok inn mesti skaði. Ok þá í annarri utanferð Sturlu var hann enn með Magnúsi konungi vel haldinn ok mikils metinn. Þá setti hann saman sǫgu Magnúss konungs eptir bréfum ok sjálfs hans ráði (StS2 327).
Und ein wenig später kam Sturla [Þórðarson] in ein sehr herzliches Verhältnis mit König [Magnús] und der König hatte ihn oft bei seinen Beratungen dabei und beauftragte ihn, die Geschichte König Hákons, seines Vaters, gemäss seiner Bestimmung und der Aussage der weisesten Leute zu verfassen. – Aber bevor der König die Geschichte verfassen liess, war König Hákon auf den Orkneys verstorben, und man hielt es für eine grosse Nachricht in allen Nordländern und für einen sehr grossen Schaden. Und dann auf Sturlas zweiter Norwegenreise hatte er es immer noch gut mit König Magnus und war sehr geschätzt. Dann verfasste er die Geschichte des Königs Magnus gemäss den Briefen und nach dessen Plan (Übers. KM).
Beim ersten Beleg befindet sich setja saman in einem Infinitivsatz, dessen Agens eine Leerstelle ist, aber auf Sturla Þórðarson (honum) im Hauptsatz referiert. Das Akkusativobjekt enthält die TEXTSORTE saga, determiniert durch das Genitivattribut mit der Hauptperson König Hákon. Die Konstituente saga Hákonar konungs ‚die Geschichte des Königs Hákon‘ verbindet die Attribute TEXTSORTE und INHALT. Das Präpositionalobjekt mit eptir enthält die Substantive ráð ‚Bestimmung‘ und forsǫgn ‚Aussage‘. Sie stellen an sich keine Quellen dar, gehören aber zu Attributen des Attributframes wie AUTORITÄT oder TEXT (vgl. II.3.1.2.g.). Die Personen König Magnús und die weisesten Leute (vitrastir menn) in den Genitivattributen sind Werte für das Attribut ZEUGE oder auch AUTOR, wenn es sich um schriftliche Quellen handelt.
Der zweite Beleg ist eine Kausativkonstruktion mit König Magnús im Subjekt als AUFTRAGGEBER. Das Akkusativobjekt enthält wiederum das Lexem saga, welches elliptisch für saga Hákonar konungs steht, so dass TEXTSORTE und INHALT wieder dieselben Werte haben. Das Agens ist eine Leerstelle, welche aber auf Sturla Þórðarson verweist. Beim ersten Beleg ist der AUFTRAGGEBER König Magnús Subjekt im Hauptsatz, von dem der Infinitivsatz mit setja saman abhängt.
Beim dritten Beleg im Aktivum kommt Sturla wieder im Subjekt (hann) vor. Das Akkusativobjekt enthält wieder saga für die TEXTSORTE, wobei das Genitivattribut nun durch König Magnús besetzt ist, so dass der INHALT einen anderen Wert erhält. Die Quellen sind wieder in einem im Präpositionobjekt mit eptir enthalten, mit den Werten bréf ‚Brief‘ für das Attribut QUELLE und ráð ‚Bestimmung‘ für das oben schon erwähnte Attribut AUTORITÄT. Das Genitivattribut verweist wieder auf König Magnús als ZEUGEN. Der AUFTRAGGEBER ist wegen der Diathese eine Leerstelle, aber man muss auch hier annehmen, dass es sich um König Magnús handelt.
In allen drei Belegen kommen also die gleichen vier Attribute vor: AUFTRAGGEBER, AUTOR, TEXT, und QUELLE. Das Attribut AUFTRAGGEBER ist im Sturlu þáttr neu und fehlt sowohl in der Jóns saga helga als auch in der Íslendinga saga. Es kann nicht überprüft werden, wie stark Sturla Þórðarson beim Verfassen dieser beiden Sagas beteiligt war, da nicht mehr alle Quellen der Hákonar saga Hákonarsonar erhalten sind (vgl. Jakobsson/Hauksson 2013: XXX). Noch schwerer lässt sich dies anhand der Magnús saga Lagabœtis überprüfen, welche nur noch in einem Fragment erhalten ist (vgl. Jakobsson/Hauksson 2013: LX). König Magnús war sicher an der inventio beteiligt, was Sturla aber nicht ausschliesst. Übrig bleiben die dispositio und elocutio. Für die elocutio spricht, dass Sturla sich davor als guter Geschichtenerzähler und sehr grosser Skalde (it mesta skáld) beweist (vgl. StS2 325f.).3 Setja saman liegt semantisch sehr nahe an lat. dispositio ‚Ordnen und Verteilen des Stoffs, (kunstgerechte) Anordnung‘ (vgl. Georges 1998: I, 2218), so dass dieser rhetorische Akt bei diesem Verb wohl im Vordergrund steht.
Der Frame in der Sturlunga saga unterscheidet sich von jenem in der Jóns saga helga in einigen Attributen. Gemeinsam haben beide Texte die Attribute AUTOR als Agens, TEXT als Thema und QUELLE als Präpositionalobjekt eptir e-u. In der Sturlunga saga kommt der AUFTRAGGEBER als Subjekt im Kausativ hinzu. In der Jóns saga helga ist dieser auch nicht aus dem Kontext zu erschliessen. Das Attribut TEIL fehlt wiederum in der Sturlunga saga sowohl als Ergänzung als auch im Kontext. Die Tatsache, dass mehre Quellen vorhanden sind, impliziert, dass Teile daraus in einen neuen Text eingefügt werden. Zwischen den Attributen TEXT, TEIL und QUELLE bestehen also Constraints. Hierzu kann auch der Auftraggeber gerechnet werden, der im Falle von König Magnús selbst als Quelle fungiert und auf die inventio Einfluss nimmt. Die Attribute SPRACHE und ZWECK lassen sich in der Sturlunga saga weder als Ergänzung noch im Kontext nachweisen. Für Erstere gilt wohl bei allen fünf Belegen der Wert norrœna, der im Falle der überlieferten Hákonar saga Hákonarsonar und Magnús saga Lagabœtis gesichert ist. Der Inhalt von Snorris sǫgubók ist nicht näher bekannt. Das Kompositum sǫgubók impliziert auch einen SCHRIFTTRÄGER mit dem Wert bók und die Genitivattribute zu saga im Sturlu þáttr enthalten Werte für den INHALT. Die Werte dieser beiden Attribute ergeben sich in der Jóns saga helga aus der Situation.
8.3. Laurentius saga biskups
In der Laurentius saga biskups gibt es in beiden Redaktionen zusammen 14 Belege für setja saman, acht davon in der A-Redaktion und sechs in der B-Redaktion, sechs weitere kommen in beiden Redaktionen parallel vor. Sieben Belege sind in Kommentaren des Autors an drei verschiedenen Stellen der Saga enthalten, welche als erstes analysiert werden. Die erste Stelle unterscheidet sich in den beiden Redaktionen abgesehen von der Graphie nur in zwei Wörtern: Im Hauptsatz steht nach var ‚war‘ das Pronomen ek ‚ich‘, so dass das Verb in der 1. Person Singular steht, und das Substantiv ævi ‚Leben‘ ist durch das Adjektiv fyrri ‚früher‘ determiniert. Das der Analyse zugrundeliegende Zitat richtet sich nach der A-Redaktion:
a) þuiat saa sem þessa sogu hefer saman sett uar aa minntur af honum sialfum j minne *hallda hueria hlute hann sialfr fram sagdi. hueriu fram hafdi farit vm hans æfe adur hann uard byskup a Holum (LSB 1).
Denn derjenige, der diese Geschichte zusammengesetzt hat, wurde von ihm selbst daran erinnert, in Erinnerung / im Gedächtnis zu behalten, welche Dinge er selbst erzählte, was von seinem Leben geblieben war, bevor er Bischof von Hólar geworden war (Übers. KM).
In diesem Kommentar erwähnt der Autor der Saga sich in der dritten Person mit dem Demonstrativpronomen sá ‚dieser‘, auf das sich die Relativpartikel sem bezieht, welche die Position des Subjekts von setja saman besetzt. Der Autor der Saga ist anonym, es wird aber Einarr Hafliðason (1307–93) vermutet, welcher selbst in der Saga als Person vorkommt (vgl. Grímsdóttir 1998: LXIVf.). Im Akkusativobjekt steht die TEXTSORTE saga ‚Saga, Geschichte‘. Das Demonstrativpronomen þessi verweist auf den dem Leser vorliegenden Text, die Laurentius saga biskups. Somit können die Werte der Attribute SCHRIFTTRÄGER, SCHRIFT, SPRACHE und INHALT aus der Situation inferiert werden, so dass es sich wieder um eine metonymische Verschiebung zum TEXT handelt. Im Falle der Handschrift AM 406 a I, 4to ist der SCHRIFTTRÄGER ein Pergamentkodex (s. Kap. I.3.4.), die SPRACHE Altisländisch, die SCHRIFT das lateinische Alphabet, der INHALT des Textes die Biographie des Bischofs Laurentius Kálfsson. Eine weitere Leerstelle, ergibt sich hingegen aus dem Kontext, nämlich die QUELLE, gemäss der Angabe des Autors handelt es sich um Bischof Laurentius selbst. Das Lexem ævi ‚Leben‘ könnte ein Wert für das Attribut INHALT oder STOFF darstellen. Auf die TEILE, welche Laurentius selber erzählt, verweist das Lexem hlutr ‚Teil‘. Das Prädikat í minni halda ‚in Erinnerung / im Gedächtnis behalten‘ kann einerseits darauf verweisen, dass der Autor die Teile im Gedächtnis behalten oder sie zur Erinnerung schriftlich festhalten soll. Dies bedeutet entweder, dass das Gedächtnis des Autors zwischen den Quellen und seinem eigenen Text steht oder dass das Erinnern ein Wert zum Attribut ZWECK ist. Diesen stellt Glauser (2010: 314f.) auch beim Prolog der Hungrvaka fest, deren Autor den Text aus dem Gedächtnis aufschreibt, um eben dieses Wissen vor dem Vergessen zu bewahren. In diesem Beleg kommen fast alle bekannten Attribute des Frames von setja saman vor: AUTOR, TEIL, TEXT, QUELLE und möglicherweise STOFF und ZWECK.
Auch die zweite Stelle ist in beiden Redaktionen überliefert, die sich bis auf die Graphie und einzelne Wörter voneinander nicht unterscheiden, auf die unten eingegangen wird. Das folgende Zitat richtet sich wieder nach der A-Redaktion und enthält zwei Belege von setja saman und daneben noch einen von setja inn:
b) Eru hier og marger hlutir saman settir af ymissum ath burdum sem fram hafa farith aa ymsum londum epter þui sem aannalar til uisa huerir mestann frodleik syna. suo og eru marger hlutir inn setter. af byskupum og odrum weralldar hofdingium. sem samtida hafa uerith. þesse fraa sogn. Og þo ath þad uerdi nockud o nyttsamligt [stor]f saaman ad setia. þuilika hlute sem birtazt og audsynast maa j þessu maale. er þo verra ath heyra og gamann henda ath sogum [heid]inna manna (LSB 2).
Hier sind auch viele Teile von verschiedenen Ereignissen zusammengesetzt, welche in verschiedenen Ländern geschehen sind, gemäss dem, worauf die Annalen hinweisen, welche das grösste Wissen zeigen. So sind auch viele Teile von den Bischöfen und anderen weltlichen Häuptlingen eingesetzt, welche zur Zeit dieser Erzählung gelebt haben. Und obwohl es eine unnütze Arbeit wird, derartige Teile zusammenzusetzen, wie es sich in dieser Erzählung erweisen und offenbaren mag, ist es doch schlimmer, die Geschichten der Heiden zu hören und sich an ihnen zu erfreuen (Übers. KM).
Setja saman ist passiv mit hlutir ‚Teile‘ als Subjekt. Das Lexem hlutr bezeichnet das Attribut TEIL. Das Adverb hér ‚hier‘ verweist bei diesem Beleg wieder auf die Situation, die Laurentius saga biskups als vorliegenden Text in der Handschrift AM 406 a I, 4to. Damit ist der Text ein Raum, in dem sich die Textteile befinden, so dass hier zum ersten Mal TEXT und TEXTTEILE gleichzeitig als Ergänzungen vorkommen. Der Text hat auch wieder denselben Autor, so dass das leere Agens über den Text inferiert werden kann. Folglich besteht zwischen den Werten der Attribute TEXT und AUTOR ein Constraint.
Das Präpositionalobjekt eptir því verweist wieder auf das Attribut QUELLE. Der Wert annálar ‚Annalen‘ ist im davon abhängigen Relativsatz enthalten. Im Präpositialobjekt mit af ist neu der Erzählstoff beschrieben, welcher aus Ereignissen (atburðum) besteht. Die Präposition af steht nicht nur für ein Teil-Ganzes-Verhältnis, welches zwischen STOFF und TEIL besteht, sondern verweist auch auf das Material, aus dem etwas hergestellt wird, was auch beim Stoff-Textteil-Verhältnis wiederum zutrifft (vgl. Baetke 2002: 4). Der in den QUELLEN überlieferte STOFF besteht aus Ereignissen, aus dem TEILE entnommen und als TEXT zusammengesetzt werden. In diese ‚Zusammensetzung‘ von Ereignissen werden nun weitere ‚Teile‘ (hlutir) ‚eingesetzt‘ (inn settir), das an dieser Stelle rekurrierende Verb setja wird mit dem Richtungsadverb inn ‚hinein, herein‘ statt saman ‚zusammen‘ ergänzt. Die übrigen Ergänzungen von setja inn sind fast gleich wie bei setja saman: margir hlutir ‚viele Teile‘ als Subjekt und der STOFF im Präpositionalobjekt af biskupum ok ǫðrum veraldar hǫfðingjum ‚von den Bischöfen und anderen weltlichen Häuptlingen‘. Die QUELLE bildet hier allerdings eine Leerstelle. In der B-Redaktion gibt es noch eine weitere, ellipitische Ergänzung, die lediglich aus der Präposition í besteht. Die Leerstelle könnte durch das Lexem saga gefüllt werden, so dass die Konstituente vollständig inn [í sǫgu] ‚in die Geschichte hinein‘ lautete. Darin wäre dann die Rolle des Textes als Raum enthalten, in dem sich Textteile befinden und auch weitere hinzugefügt werden können.
Der zweite Beleg von setja saman ist Teil eines Infinitvsatzes, so dass das Agens wie beim Passiv eine Leerstelle bildet. Im Akkusativobjekt rekurriert das Lexem hlutr ‚Teil‘. Die übrigen Attribute bleiben Leerstellen, deren Werte aus dem ersten Belegs inferiert werden können.
Die dritte Stelle kommt nur in der A-Redaktion vor, wo der Autor nun in der 1. Person Plural (vér) erwähnt, dass er von Laurentius’ Lebensweise erzählen wolle (viljum […] segja, vgl. LSB 97). Dann begründet er, warum er diesen Erzählstoff zusammengestellt hat: c) „hofum vier þad eina vm hans hattu og sid ferde hier sam sett ad vier vilium fyrer Gude suara“ (LSB 97). ‚Wir haben dieses eine über seine Lebensweise und Lebensführung hier zusammengesetzt, weil wir es vor Gott verteidigen wollen‘ (Übers. KM). Das Pronomen vér im Subjekt bezieht sich wie schon erwähnt auf den Erzähler. Im Akkusativobjekt befindet sich der Inhalt der ‚Zusammensetzung‘ bzw. der Abschnitt der Saga, den er kommentiert. Die Verwendung der Konstituente þat eina ‚das eine (n. Sg.)‘ ist kataphorisch, denn sie bezieht auf den nachfolgenden Teil in der Erzählung und steht also für das Attribut TEIL. Die dritte Ergänzung ist das Präpositionalobjekt um hans háttu ok siðferði ‚über seine Lebensweise und Lebensführung‘. Die Präposition um hat verschiedene Funktionen, von denen die thematische ‚bezüglich, hinsichtlich, was anlangt‘ (vgl. Baetke 2002: 673) in diesem Kontext am besten zutrifft. Sie steht stärker für einen Bezug zwischen TEIL und INHALT als die Präposition af, welche auf das Verhältnis zwischen STOFF und TEIL fokussiert. Dieser inhaltliche Bezug betrifft die Gewohnheiten (hættir) und Lebensführung (siðferði) der Hauptperson der Saga. Das Attribut INHALT bekommt bei diesem Beleg nun auch eine Ergänzung. Das Adverb hér ‚hier‘ verweist wie oben schon auf die Situation, so dass die Werte zu den Attributen wie TEXT oder SCHRIFTTRÄGER inferiert werden können.
Diese sieben Belege aus den Kommentaren haben gemein, dass sie sich beim Text immer auf die Laurentius saga biskups beziehen und dass das Agens der Autor dieser Saga ist, auf welche auch tatsächlich das Lexem saga im ersten Beleg referiert. Damit ist ein Wert für die TEXTSORTE gegeben. Das Lokaldeiktikum hér verweist auf die Situation mit allen zum TEXT-Frame gehörigen Attributen wie SCHRIFTTRÄGER, INHALT oder SPRACHE etc. Thema ist in allen Fällen TEILE (hlutir). Der INHALT ist zwar schon aus der Situation bekannt, bekommt aber zusätzlich aus dem Präpositionalobjekt um e-t die Werte siðferði und háttr. Auf den STOFF referiert das Präpositionalobjekt af e-u und enthält den Wert atburðr aus dem Kontext ergibt sich noch der Wert ævi ‚Leben‘ für die Attribute INHALT oder STOFF. Die QUELLE ist eine Leerstelle, aber der Kontext nennt Laurentius. Da die Hauptperson der Saga auch Quelle ist, kann man hier tatsächlich beim Agens von einem Autor sprechen, denn er hat die Saga mit dem Wissen von Laurentius selbst geschrieben und nicht wie ein Kompilator aus schon bestehenden Texten zusammengefügt. Im Kontext ist mit dem Lexem minni ‚Erinnerung, Gedächtnis‘ auch ein möglicher Wert für das Attribut ZWECK oder eine Bezeichnung für ein Attribut GEDÄCHTNIS des Attributframes AUTOR enthalten.
Wie sich die Belege in den Kommentaren um den Autor der Saga reihen, betreffen die drei nächsten Belege an zwei Stellen in der Saga einen anderen Autor, nämlich Bergr Sokkason. Er war Mönch im Kloster Þingeyrar, sowie Prior und später Abt des Klosters Munkaþverá. Ihm werden die Mikjáls saga hǫfuðengils ‚die Geschichte von Erzengel Michael‘ und eine Version der Nikuláss saga erkibiskups ‚die Geschichte von Erzbischof Nikulás‘ in den bewahrten Handschriften explizit zugeschrieben. Ausserdem wird vermutet, dass er an einer Reihe anderer Werke beteiligt war, darunter die L-Redaktion der Jóns saga helga (vgl. Johansson 2007: 85–87). Die erste Stelle enthält in beiden Redaktionen je einen Beleg, die sich aber leicht unterscheiden. In der A-Redaktion lautet er wie folgt:
d) Vard hann hinn fremste kl[er]kur. songare harlla sæmiligr. og mælsku madur mikill. so at hann sette saman margar. soghu [bæ]kur. heilagra manna j norrænu maale med mikille snilld (LSB 73).
Er wurde ein herausragender Kleriker, ein sehr angesehener Sänger und ein grosser Redner, so dass er viele Geschichtenbücher über Heilige in der nordischen Sprache mit grosser Gewandtheit zusammensetzte (Übers. KM).
Das Subjekt von setja saman ist hann ‚er‘, welches für den herausragenden Kleriker Bergr Sokkason steht, der ausserdem als grosser Redner und Sänger beschrieben wird. Im Akkusativobjekt ist wie in der Sturlunga saga (vgl. Kap. II.8.2.b.) das Kompositum sǫgubók ‚Geschichtenbuch‘ enthalten, welches metonymisch für den TEXT steht und ausserdem Werte für die Attribute TEXTSORTE und SCHRIFTTRÄGER impliziert. Auf den INHALT referiert das Genitivattribut heilagra manna ‚Heiliger (Gen. Pl.)‘. Das Präpositionalobjekt í e-u enthält das Lexem mál ‚Sprache‘ als Bezeichnung für das Attribut SPRACHE und den Wert norrœna ‚nordisch‘ und jenes mit með das Lexem snild als Bezeichnung für ein Attribut GEWANDTHEIT mit einem Wert mikill ‚gross‘. Das Adjektiv mikill ist auch ein Attribut des Substantivs mælskumaðr ‚Redner‘. Dieser Verweis auf Bergr Sokkasons rhetorische Begabung zeigt, dass diese bei setja saman eine Rolle spielt und zwischen den Werten der Attribute Autor und Gewandtheit ein Constraint besteht. Die QUELLE wird nicht genannt. Es handelt sich entweder um die lateinischen Originale, welche Bergr Sokkason ins Altnordische übersetzt, oder es sind bereits altnordische Vorlagen, welche er in einem Buch kompiliert. Die rhetorische Gewandtheit des Autors äussert sich somit entweder in der elocutio der Übersetzung oder in der dispositio und elocutio der Kompilation. Die Attribute STOFF und TEIL bilden Leerstellen, was aber die inventio nicht ausschliessen muss.
Die B-Redaktion ist syntaktisch gleich strukturiert, aber lexikalisch knapper: e) „uard hann hinn framazti klerkur ok mælsku madr allmikill. suo hann setti saman margar sogur heilagra manna j norrænv med mikille snilld“ (LSB 73). ‚Er wurde ein hervorragender Gelehrter und ein sehr grosser Redner, so dass er viele Heiligengeschichten in der nordischen Sprache mit grosser Gewandtheit zusammensetzte‘ (Übers. KM). Die Information ‚Sänger‘ wird ausgelassen, weil sie für die Autorentätigkeit Bergr Sokkasons wohl nicht relevant ist, der hier ebenfalls Subjekt von setja saman ist. Das Akkusativobjekt unterscheidet sich hingegen, weil das Lexem bók fehlt, so dass kein Wert für den SCHRIFTTRÄGER vorhanden ist. Die Werte für TEXTSORTE und INHALT bleiben gleich. Die beiden Präpositionalobjekte mit í und með stehen für dieselben Attribute und Werte wie in der A-Redaktion, wobei hier das Substantiv mál ‚Sprache‘ fehlt.
Die Stelle mit dem dritten Beleg ist nur in der A-Redaktion erhalten. Es handelt sich um eine Rekurrenz des obigen Beleges. Der Mönch Bergr Sokkason wird von Bischof Laurentius zum Abt von Munkaþverá gewählt. Im Anschluss werden noch einmal seine Qualitäten und seine Autorentätigkeit betont: f) „saman sette hann margar *heilagra manna sogur j norrænu sem birtazt mun og audsynast medan þetta land er bygt“ (LSB 103). ‚Er setzte viele Geschichten von Heiligen auf Nordisch zusammen, wie sich erweisen und offenbaren wird, solange dieses Land bewohnt ist‘ (Übers. KM). Hier kommen alle Füllungen der vorherigen Stelle (s. Belege d. und e.) bis auf die GEWANDTHEIT und den SCHRIFTTRÄGER noch einmal vor. Die drei Belege verbinden die Attribute AUTOR, TEXT, SPRACHE und GEWANDTHEIT.
Die nächsten vier Belege verteilen sich auf drei Stellen in der Saga und gehören alle in den Briefverkehr. Der Autor in diesen vier Belegen ist nun Laurentius. Der erste Beleg enthält nur in der B-Redaktion setja saman, während in der A-Redaktion „saman lesith“ ‚zusammengelesen‘ anstelle von „saman sett“ steht. Der Priester Laurentius liest Bischof Jǫrundr einen Brief mit Anklagepunkten gegen ihn vor, den er dem Erzbischof zukommen lassen will: g) „las L(aurencius) þa upp fyrir honum alla þa hluti er hann hafdi saman sett. af vandrækt ok o logligvm fram ferdum biskups“ (LSB 46). ‚Laurentius las ihm dann alle die Teile vor, welche er von der Nachlässigkeit und dem ungesetzlichen Verhalten des Bischofs zusammengesetzt hatte‘ (Übers. KM). Setja saman ist aktiv in einem Relativsatz mit Priester Laurentius als Subjekt. Die Relativpartikel er verweist auf die Konstituente alla þá hluti ‚alle die Teile‘ im Hauptsatz und das Präpositionalobjekt mit af auf den STOFF mit den Werten vanrœkt ‚Nachlässigkeit‘ und ólǫglig framferð ‚ungesetzliches Verhalten‘. TEXTSORTE und SCHRIFTTRÄGER ergeben sich im Folgenden aus der Erzählung, wo das Lexem bréf belegt ist. Eine QUELLE oder VORLAGE entfällt, weil Laurentius Augenzeuge der Ereignisse ist. Es fehlt auch ein AUFTRAGGEBER, da Laurentius aus eigenen Antrieb handelt.
Die folgende Stelle enthält je einen Beleg in den beiden Redaktionen, welche sich neben der Graphie auch in den Füllungen unterscheiden. Als erstes wird hier die A-Redaktion analysiert:
h) vm vorit epter paska aa Ions dag Hola byskups senndi hann sira Pal Þo[rsteinsson] J Skalhollt med brefum. hafdi hann saman sett stortt bref. j huert hann sette allegationes [iu]ris. ad […] (LSB 111).
Im Frühling nach Ostern am Tag des heiligen Bischofs Jón von Hólar schickte er Priester Páll Þorsteinsson mit Briefen nach Skálholt. Er hatte einen grossen Brief zusammengesetzt, in welchen er die allegationes iuris ‚Geltendmachungen des Rechts‘1 setzte, dass […] (Übers. KM).
Das Verb hat die Diathese Aktivum und das Subjekt hann steht für Bischof Laurentius. Das Akkusativobjekt ist stórt bréf ‚grosser Brief‘ als Wert für den TEXT. Das Attribut TEIL ist eine Leerstelle, ergibt sich aber aus dem nachfolgenden Relativsatz, wo das Verb setja ‚setzen‘ mit dem Präpositionalobjekt í e-t für den TEXT (bréf) und dem Akkusativobjekt allegationes iuris als Wert für das Attribut TEIL rekurriert.
Die B-Redaktion fasst die Füllungen der Verben setja saman e-t und setja í e-t ‚etw. in etw. setzen‘ in der Konstruktion setja saman í e-t ‚etw. in etw. zusammensetzen‘ zusammen: i) „litlu sidar senndi hann sudr j Skalholt sira Pal Þorsteinsson med stort bref til Jons biskups j hvert hann hafdi saman sett allegaciones juris at […]“ (LSB 111). ‚Ein wenig später schickte er den Priester Páll Þorsteinsson mit einem grossen Brief in den Süden nach Skálholt, in welchen er die allegationes iuris zusammensetzte, dass […]‘ (Übers. KM). Hier steht das Subjekt hann wie in der A-Redaktion für Bischof Laurentius, die anderen Ergänzungen sind hingegen jene von setja e-t í e-t in der A-Redaktion: Der TEIL allegationes iuris befindet sich im Akkusativobjekt und das Präpositionalobjekt í hvert bezieht sich auf den TEXT bréf im Hauptsatz.
SPRACHE, QUELLE, STOFF und AUFTRAGGEBER sind bei beiden Belegen Leerstellen. Die Rolle des Auftraggebers nimmt Bischof Laurentius als ABSENDER dieses Briefes selber ein (vgl. LSB 111). Anhaltspunkte für die SPRACHE gibt der Latinismus allegationes iuris einerseits, andererseits der Absender und der Empfänger, welche beide Bischöfe und des Lateinischen mächtig sind. Bezüglich QUELLE und STOFF gibt es im Kontext hingegen keine Werte. Diese müssen in der Korrespondenz nicht unbedingt gegeben sein, weil es primär um das Verfassen einer schriftlichen Botschaft geht, was allerdings nicht ausschliesst, dass Quellen verwendet und ein gewisse Stoffe verarbeitet werden.
Der letzte Beleg ist nur in der A-Redaktion enthalten, während in der B-Redaktion skrifa anstatt setja saman steht (vgl. Kap. II.3.2.5.):
j) Sendi herra Laur(encius) byskup erchibyskupinum sæ[m]iligar presentur. skrifanndi med honum alla processum. senndanndi honum huoru tueggiu sęttar giord. skrifade hann eina sedula. huat hann hafdi saman sett af kirkiunnar logum (LSB 121).
Bischof Laurentius sandte dem Erzbischof ehrenvolle Präsente und schickte den ganzen Prozess als Schreiben mit und schickte ihm beide Vergleiche. Er schrieb ein Blättchen, was er aus Kirchengesetzen zusammengesetzt hatte (Übers. KM).
Subjekt ist das Pronomen hann, welches für Bischof Laurentius steht, Akkusativobjekt das Interrogativpronomen hvat ‚was‘, das sich nicht auf schedula f. ‚Blättchen‘ beziehen kann, da die beiden Lexeme im Genus nicht kongruieren. Es handelt sich also nicht um einen Relativsatz, der durch ein Interrogativpronomen eingeleitet wird, sondern um einen Explikativsatz, welcher das Skript auf dem Blättchen ausführt. Bei diesem Beleg kontrastieren skrifa und setja saman (s. a. Kap. II.4.2.7.a.). Bischof Laurentius schreibt auf, was er ‚zusammengesetzt‘ hat. Das Resultat des Schreibens ist das Skript, jenes des Zusammensetzens der Text, so dass das Akkusativobjekt hvat also für den TEXT steht. Das Präpositionalobjekt mit af steht wieder für den STOFF, aus dem der Text zusammengesetzt ist, nämlich die Kirchengesetze, welche auch gleichzeitig die QUELLE, und den INHALT implizieren, wobei nicht genannt wird, welche Kirchengesetze Laurentius verwendet.
Der Frame der Laurentius saga biskups unterscheidet sich von jenen der Jóns saga helga und der Sturlunga saga in diversen Attributen. Im Kern ist der Frame gleich aufgebaut, mit dem AUTOR als Agens und dem TEIL oder TEXT als Thema. Gewisse Unterschiede äussern sich aber schon in den Ergänzungen: Wenn der TEIL Thema ist, kann mit dem Präpositionalobjekt í e-t auf den TEXT verwiesen werden. Das Präpositionalobjekt mit í e-u verweist hingegen auf die SPRACHE (mál). Dann kommen zwei Attribute, welche in den anderen beiden Texten im Kontext zu finden sind, auch als Ergänzung vor: der INHALT als Präpositionalobjekt um e-t und der STOFF als Präpositionalobjekt af e-u. Neu ist das Attribut GEWANDTHEIT (snild) im Präpositionalobjekt með e-u. Im Gegensatz zu den anderen Texten kommen die Attribute AUFTRAGGEBER und QUELLE nicht als Ergänzung von setja saman vor, wobei Quellen im Kontext erwähnt werden, wo auch einmal ein potentielles Attribut ZWECK genannt wird.