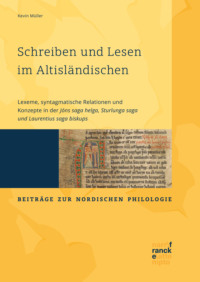Kitabı oku: «Schreiben und Lesen im Altisländischen», sayfa 24
2.3.6. lesa sǫgu ‚eine Geschichte lesen‘
In der Jóns saga helga kommt das Substantiv saga als Wert für die TEXTSORTE im Kontext zwar vor, bildet jedoch keine Ergänzung des Verbs lesa. In der Sturlunga saga gibt es dagegen zwei Belege mit saga als Thema. Der erste stammt aus einem Teil der Þorgils saga skarða, welcher nur in neuzeitlichen Abschriften der Reykjarfjarðarbók erhalten ist. Kålunds Edition richtet sich bei diesem Beleg nach der Handschrift Brit. Mus. Addit. 11, 127 (vgl. StS2 272). Þorgils skarði reitet nach Hrafnagil, wo man ihn herzlich empfängt und ihm u.a. Geschichten (sǫgur) als Unterhaltung anbietet:
a) Honum var sagt, at til væri saga Tómás erkibiskups, ok kaus hann hana, því at hann elskaði hann framarr en aðra helga menn. Var þá lesin sagan, ok alt þar til er unnit var á erkibiskupi í kirkjunni ok hǫggin af honum krónan (StS2 295).
Ihm [= Þorgils skarði] wurde gesagt, dass die Geschichte vom Erzbischof Thomas vorhanden sei, und er wählte diese, denn er liebte ihn mehr als andere Heilige. Die Geschichte wurde dann gelesen, und zwar bis zu der Stelle, wo der Erzbischof in der Kirche niedergeschlagen und sein Kopf abgeschlagen wurde (Übers. KM).
Das Verb lesa steht im Passiv und hat saga als Subjekt, welches elliptisch für die im vorhergehenden Satz genannten Tómass saga erkibiskups steht. Diese Konstituente umfasst die TEXTSORTE saga und den INHALT Tómas erkibiskup (Erzbischof Thomas von Canterbury) als Genitivattribut. Das Agens ist eine Leerstelle, welche auch nicht mithilfe des Kontexts geschlossen werden kann. Die ZUHÖRER neben Þorgils skarði ergeben sich allerdings aus dem Kontext, nämlich die Leute (menn) des Hofes Hrafnagil, von dem auch der LESER stammen dürfte.
Der zweite Beleg stammt aus einem wegen einer Lakune in der Króksfjarðarbók fehlenden Teil, den Kålund mithilfe der neuzeitlichen Handschrift Stockh. pap. 8, 4to ergänzt (vgl. StS1 474). Bischof Guðmundr Arason von Hólar kann wegen seiner Blindheit nicht mehr lesen, was dazu führt, dass ihm vorgelesen werden muss: „Hann sǫng lǫngum eða lét lesa fyrir sér sǫgur heilagra manna á latínu, þá er hann vakti“ (StS1 489). ‚Er sang lange oder liess sich die Geschichten heiliger Leute auf Latein vorlesen, wenn er wach war‘ (Übers. KM). Lesa ist Teil einer Kausativkonstruktion, deren Subjekt mit dem Pronomen hann auf Bischof Guðmundr als AUFTRAGGEBER verweist. Das Agens bildet eine Leerstelle, die nicht aus dem Kontext gefüllt werden kann. Das Akkusativobjekt enthält die Konstituente sǫgur heilagra manna ‚Geschichten heiliger Leute‘, mit der TEXTSORTE saga und dem INHALT helgir menn. Das Präpositionalobjekt fyrir sér ‚vor sich‘ steht für den ZUHÖRER und ist wegen des Reflexivpronomens identisch mit dem Subjekt. Hinzu kommt noch das Präpositionalobjekt á latínu ‚auf Latein‘ mit einem Wert für das Attribut SPRACHE. Der RAHMEN ist hier wahrscheinlich die Erbauung eines Kranken, worauf das Lexem sótt ‚Krankheit‘ im Kontext verweist (vgl. StS1 489) und der beispielsweise als Ergänzung í sóttinni in der Laurentius saga biskups vorkommt (vgl. Kap. III.2.4.3.).
2.3.7. Der Frame von lesa in der Sturlunga saga
Der Kernframe von lesa besteht auch in der Sturlunga saga aus den Attributen LESER als Agens und TEXT als Thema. Ersteres ist jedoch meistens eine Leerstelle, zumal die Diathesen Passiv und Kausativ relativ häufig sind. Die wenigen Werte für den LESER in der Sturlunga saga sind biskup ‚Bischof‘, prestr ‚Priester‘, Mitglieder von Magnatenfamilien (sturlungr, svínfellingr), die Laien sind, aber über eine gewisse Bildung verfügen, und einmal maðr ‚Mann‘. Letzteres ist in fast allen Fällen eine Füllung mit verschiedenen Werten: am häufigsten bréf ‚Brief‘, je zweimal psalmr ‚Psalm‘ und saga ‚Geschichte, Saga‘, und je einmal bannsetning ‚Exkommunikation‘, letania ‚Litanei‘, miserere, psaltari ‚Psalter‘ und stafkarlaletr ‚Bettlerschrift‘. Die Zuordnung zu Attributen des Attributframes ist nicht immer ganz so eindeutig, dies gilt insbesondere für die polysemen Lexeme bréf (SCHRIFTTRÄGER, SKRIPT, TEXTSORTE) und saga (TEXTSORTE, INHALT), aber auch für psaltari, welches den SCHRIFTTRÄGER bók ‚Buch‘ und den TEXT psalmar ‚Psalmen‘ impliziert. Psalmr und letania gehören zur TEXTSORTE. Miserere kann dem TITEL und stafkarlaletr der SCHRIFT zugeordnet werden.
Die Kausativkonstruktionen erweitern die Valenz, so dass auch der AUFTRAGGEBER als Füllung vorkommt, mit den Werten biskup und sturlungr. Die STIMME bekommt nur einmal mit dem Adverb opinberliga einen Wert. Die ZUHÖRER ergeben sich in fast allen Fällen aus dem Kontext, jedoch gibt es in zwei Belegen einen ZUHÖRER als Füllung. Der eine hat den Wert biskup ‚Bischof‘ im Präpositionalobjekt fyrir e-m. Der andere stellt wie in der Jóns saga helga mit dem Präpositionalobjekt yfir e-m einen Sonderfall dar, weil der ZUHÖRER Inhalt eines performativen Sprechaktes ist, indem er durch das Rezitieren eines geschriebenen Textes von einer bösen Macht befreit wird. Jedoch stellt auch das Verlesen des Kirchenbannes oder von Urkunden einen performativen Sprechakt dar, so dass dies nicht im Konzept von lesa inhärent ist. Der Sprechakt hängt folglich nicht nur von der Konstruktion lesa yfir e-m und dem Wert des Attributs ZUHÖRER ab, sondern auch von jenen der Attribute TEXT, LESER oder RAHMEN.
Die ZUHÖRER sind oft Teil eines sozialen Rahmens. Das Attribut RAHMEN kann einerseits in den meisten Fällen aus dem Kontext erschlossen werden, andererseits ist es als Füllung im Präpositionalobjekt at e-u einmal mit dem Wert veizla ‚Fest‘ belegt. Weitere Werte im Kontext sind fundr und stefna ‚Versammlung‘, sowie möglicherweise sótt ‚Krankheit‘. Ein letztes Attribut ist die SPRACHE, welche einmal mit dem Lexem tunga benannt ist und auf welche das Präpositionalobjekt mit á e-t mit den Werten norrœnn und latína referiert.
Das Attribut ZEIT kommt in der Sturlunga saga auch in einem liturgischen Rahmen vor mit dem Adverb lengi und dem Präpositionalobjekt í nótt vor. Auf das Attribut INTENTION wird nur indirekt mit einem Konsekutivsatz verwiesen, der keinen konkreten Wert dazu enthält.
Der Kernframe der Sturlunga saga wie auch die Attribute AUFTRAGGEBER, STIMME und ZUHÖRER entsprechen trotz der unterschiedlichen Werte dem Frame der Jóns saga helga. Auch der Frame des Attributs TEXT besteht aus fast denselben Attributen TITEL, TEXTSORTE, INHALT und SCHRIFTTRÄGER. In der Sturlunga saga kommt noch die SCHRIFT hinzu. Im Gegensatz zur Jóns saga helga sind die Attribute SPRACHE und RAHMEN als Ergänzungen von lesa belegt. Die Attribute GEFAHR und ZIEL lassen sich in der Sturlunga saga weder als Ergänzung noch im Kontext nachweisen. Die Kollokation lesa messu, welche einen anderen Frame evoziert, ist in der Sturlunga saga nicht belegt.
2.4. Laurentius saga biskups
Die Belege von lesa sind in der Laurentius saga biskups in beiden Redaktionen relativ gleichmässig verteilt. In der A-Redaktion gibt es 39 Belege und in der B-Redaktion 37. 18 Belege kommen in beiden Redaktionen bis auf geringe graphische, lexikalische und syntaktische Unterschiede gleich vor. Elf befinden sich zwar an der gleichen Stelle in der Erzählung, weisen aber trotzdem deutliche Unterschiede auf. Zehn Belege sind nur in der A-Redaktion enthalten, von denen sechs in der B-Redaktion aufgrund von Lakunen fehlen. Acht Belege sind hingegen nur in der B-Redaktion vorzufinden, von denen vier wiederum in der A-Redaktion fehlen, weil sie an den jeweiligen Stellen Lakunen aufweist. Wegen der inhaltlichen und sprachlichen Ähnlichkeit beider Redaktionen wird das Kapitel zur Laurentius saga biskups nicht nach den Redaktionen aufgeteilt. Die Kapitelüberschriften enthalten die jeweiligen Kollokationen, welche aber nach dem Rahmen im Kontext geordnet werden. Der grösste Teil der Belege lässt sich nach zwei schon bekannten Rahmen zuordnen. Dazu gehört einerseits der Briefverkehr, in welchem einzig die Kollokation lesa bréf vorkommt, und andererseits die religiösen Praxis, deren Kollokationen vielfältiger sind. Dazu gehören Belege für das Lesen des Psalters (lesa psaltara), eines Gebets (lesa bœn), der Tischlesung (lesa lectionem), des Stundengebets (lesa tíðir) und des Evangeliums (lesa evangelium/guðspjall). Zum diesem Rahmen gehört auch eine Gruppe von Belegen ohne Akkusativobjekt, welche anschliessend analysiert wird. Zum Schluss folgen drei Kapitel mit Stellen in speziellen Rahmen mit dem Lesen von Geschichten, Gesetzen und Versen (lesa sǫgu, lǫg und vers).
2.4.1. lesa bréf ‚einen Brief lesen‘
Der Briefverkehr macht knapp die Hälfte der Belege beider Redaktionen aus. Davon kommen 13 in beiden Redaktionen ähnlich vor, zwei mit deutlichen Unterschieden an den gleichen Stellen und sechs sind nur in je einer Redaktion belegt, wovon einer in der B-Redaktion sich durch eine Lakune in der A-Redaktion erklärt. Die Belege dieses Kapitels sind zuerst nach den Diathesen Kausativ, Passiv und Aktiv strukturiert, danach folgen jene mit den Präpositionalobjekten fyrir und yfir e-m.
2.4.1.1. Kausativ
Die drei Belege mit der Kausativkonstruktion láta lesa bréf unterscheiden sich nicht wesentlich von jenen in den oben besprochenen beiden Sagas. Die erste Stelle enthält in der A-Redaktion, die nachfolgend zitiert wird, einen Beleg von lesa im Kausativ, welcher im Aktiv rekurriert, während in der B-Redaktion, welche sich sonst nur unwesentlich unterscheidet, beide Belege im Aktiv sind: a) „krafde Sniolfur Laur(encium) ad lata lesa urskurdar bref sitt. og epter þad las Laur(encius) brefit“ (LSB 40). ‚Snjólfr verlangte, dass Laurentius seinen Urteilsbrief vorlesen lasse, und danach las Laurentius den Brief‘ (Übers. KM). Der erste Beleg hat Priester Laurentius als Causer bzw. AUFTRAGGEBER und órskurðarbréf ‚Urteilsbrief‘ als Thema bzw. TEXT. Dieses Kompositum hat mit dem Modifikator órskurðr ‚Urteil‘ zudem einen Wert für das Attribut BOTSCHAFT. Das reflexive Possessivpronomen sitt verweist auf den ABSENDER Priester Laurentius. Dieser befolgt die Forderung des Priesters Snjólfr nicht und liest seinen Brief selbst vor, wie der zweite Beleg von lesa zeigt, mit Priester Laurentius als Subjekt bzw. LESER – diese Rollenverteilung gilt in der B-Redaktion für beide Belege. Das Akkusativobjekt bréfit steht elliptisch für órskurðarbréf, denselben TEXT wie beim ersten Beleg. Die ZUHÖRER Priester Snjólfr, Abt Þórir von Munkaþverá und noch andere ergeben sich aus dem Kontext, wo auch die Materialität des Briefes verdeutlicht wird, als Þórir und Snjólfr ihn zerreisen und das Siegel entfernen. Diese destruktive Reaktion bestätigt, dass die Anwesenden ihn gehört haben und Laurentius folglich den Brief laut gelesen hat.
Der zweite Beleg im Kausativ ist nur in der B-Redaktion überliefert, denn in A steht lesa upp anstelle von lesa (vgl. Kap. III.3.2.2.b.). Darin verkündet der Priester Koðrán, der vom Erzbischof zum Mitgehilfen (coadiutor) des im Sterben liegenden Bischofs Jǫrundr ernannt wurde, den Inhalt der Briefe des Erzbischofs im Bistum Hólar: b) „um vorit kom sira Ko<d>ran þar. ok liet lesa þar sem annars stadar þau bref sem honum hafdi erkibiskupinn ut gefit“ (LSB 62f.). ‚Im Frühling kam Priester Koðrán dort [= Kloster Munkaþverá] an und liess dort wie andernorts die Briefe verlesen, welche der Erzbischof ihm mitgegeben hatte‘ (Übers. KM). Im Subjekt steht der Priester Koðrán als AUFTRAGGEBER. Das Agens bzw. der LESER bildet eine Leerstelle und das Thema ist wieder bréf. Die BOTSCHAFT der Briefe wird zwar nicht explizit im Kontext genannt, es kann sich aber nur um Koðráns Ernennung zum Mitgehilfen (coadiutor) handeln. Die Adverbien þar ‚da‘, das auf Laurentius‘ Aufenthaltsort Munkaþverá referiert, und annars staðar ‚anderswo‘, das sich nicht näher bestimmen lässt, beziehen sich auf das Attribut ORT.
Beim dritten Beleg, der nur in der A-Redaktion vorkommt, während in B lesa fehlt, lässt der Erzbischof seinen Brief vor den Chorherren verlesen: c) „Let erchibyskupinn nu lesa þad bref sem hann hafdi þar vt gefit vm samþycktu þa allir kors brædur med erchibyskupinum þessa giord“ (LSB 129). ‚Der Erzbischof liess nun den Brief vorlesen, den er herausgegeben hatte. Dann waren sich alle Chorherren mit dem Erzbischof über den Inhalt einig‘ (Übers. KM). Der AUFTRAGGEBER im Subjekt ist der Erzbischof. Das Agens bzw. der LESER ist eine Leerstelle und das Thema bréf ist ein Wert für den TEXT. Die Chorherren als ZUHÖRER ergeben sich aus dem nachfolgenden Satz. Die BOTSCHAFT des Briefes wird nicht explizit genannt, jedoch ein Wert für die ANGELEGENHEIT, nämlich im Kompositum Mǫðruvalla-mál (vgl. LSB 129), bestehend aus dem Kopf mál als Bezeichnung für das Attribut und dem ORT Mǫðruvellir als Modifikator. Der Kontext liefert auch die SPRACHE latína ‚Latein‘ als Modifikator von bréf (vgl. LSB 128).
2.4.1.2. Passiv
Die Laurentius saga biskups enthält drei weitere Belege von lesa im Passiv. An der ersten Stelle mit zwei Belegen, beschuldigen die Chorherren Laurentius u.a., einen Brief gefälscht zu haben. Darauf werden mehrere Briefe gelesen, welche Klagen gegen Laurentius enthalten. Das Zitat stammt aus der A-Redaktion, von der sich die B-Redaktion nur in der Graphie unterscheidet: a) „uar þa lesit bref þad er þeir hofdu giortt. […] þa voru lesinn bref. þau sem Jor(undur) byskup af Holum. hafdi skrifat honum til þunga“ (LSB 51f.). ‚Es wurde dann jener Brief verlesen, den sie [= die Chorherren] geschrieben hatten. […] Dann wurden jene Briefe verlesen, welche Bischof Jǫrundr von Hólar ihm [= Laurentius] zu Lasten geschrieben hatte‘ (Übers. KM). Das Subjekt ist in beiden Fällen bréf, jedoch unterscheiden sich die beiden Briefe in den Attributen ABSENDER und BOTSCHAFT, wie die Relativsätze zeigen. Das Agens bzw. der LESER ist eine Leerstelle. Die ZUHÖRER liefert der Kontext, nämlich den Angeklagten Laurentius und die Chorherren.
Der dritte Beleg ist in beiden Redaktionen bis auf die Graphie gleich überliefert und etwas schwieriger zu beurteilen, weil es zu lesa nur Leerstellen gibt. Das folgende Zitat stammt aus der A-Redaktion: b) „hafdi þad og verid nordan sagt. ad hefdi uerid lesid“ (LSB 40). ‚Es wurde auch aus dem Norden mitgeteilt, dass [er] verlesen wurde‘ (Übers. KM). Das Partizip Präteritum, welches mit dem Subjekt kongruiert, ist ein Neutrum, so dass es sich auf das in der Saga davor genannte Neutrum órskurðarbréf ‚Urteilsbrief‘ bezieht. Der Urteilsbrief führt zur Szene zurück, in der Laurentius im Kloster Munkaþverá das Urteil mit einem offenen Brief verhängt („leggiande aa vr skurd med opnu brefi“). Als ZUHÖRER kommt der Abt in Frage, wenn nicht noch weitere Personen anwesend waren (vgl. LSB 39). Jørgensen (1982: 74) intepretiert in seiner Übersetzung Laurentius als Leser des Briefes und übersetzt den Satz im Aktiv mit Laurentius als Subjekt („han havde læst“ ‚er hatte gelesen‘), was sehr plausibel ist, obwohl im Original nicht explizit steht, dass er den Urteilsbrief verlesen hat. Es gibt jedoch keine andere Möglichkeit, als dass dieser kurze Satz im Passiv auf diese Szene referiert. Dieser Beleg zeigt, dass die Kohäsion im Text zum Teil sehr weit reichen kann. Trotz der Leerstellen können über die Kongruenz und Rekurrenz folgende Werte inferiert werden: Laurentius als LESER, der Abt (ábóti) als ZUHÖRER und órskurðarbréf als TEXT. Da es neben dem LESER mindestens einen ZUHÖRER gibt, handelt es sich auch um Lesen mit Stimme.
2.4.1.3. Aktiv
Eine weitere Reihe von Belegen hat die Diathese Aktivum. Beim ersten Beleg handelt es sich um eine Rekurrenz von láta lesa, die oben schon besprochen wurde (vgl. Kap. III.2.4.1.1.a.). Beim zweiten Beleg schicken Bischof Jǫrundr und Bruder Bjǫrn den Priester Snjólfr mit einem Brief nach Munkaþverá, den er dort Bischof Laurentius und Herrn Þórðr vorliest. Das Zitat stammt aus der B-Redaktion, die A-Redaktion hat stattdessen das Verb lesa upp (vgl. Kap. III.3.2.1.a.): a) „las Sniolfur bref brodr Biarnar at hann gaf orlof til at […] (LSB 40) ‚Snjólfr las den Brief Bruder Bjǫrns, dass er die Erlaubnis gab, zu […]‘ (Übers. KM). Subjekt ist Snjólfr, so dass das Attribut LESER den Wert prestr bekommt. Das Akkusativobjekt enthält das Substantiv bréf, einen Wert für das Attribut Text. Die Werte biskup und herra des Attribut ZUHÖRER lassen sich aus dem Kontext inferieren.
Weitere drei Belege stammen aus demselben Kapitel 48 nach der A-Redaktion bzw. 57 nach der B-Redaktion, in welchem der Diakon Þórðr Guðmundarson mit einem Vorladungsbrief (stefnubréf) von Bischof Jón und Abt Þorlákr in die Kirche kommt, während Bischof Laurentius die Messe hält. Die Zitate der ersten beiden Belege richten sich nach der A-Redaktion, welche sich nur unwesentlich von der B-Redaktion unterscheidet. Beim ersten Beleg sagt Laurentius, als er Þórðr hört: b) „fyrer byd eg þier Þordur | ath lesa nockud bref og ad gera rugl edur hareysti j heilogu messu embette.“ (LSB 113f.). ‚Ich verbiete dir, Þórðr, irgendeinen Brief zu verlesen und Verwirrung oder Unruhe während des heiligen Messamts zu stiften‘ (Übers. KM). Der LESER im Subjekt des ersten Belegs ist Diakon Þórðr und der TEXT im Akkusativobjekt ist bréf, als Ellipse des Kompositums stefnubréf mit dem Modifikator stefna ‚Vorladung‘ als Wert für die BOTSCHAFT. Dass Þórðr mit Stimme liest, verdeutlicht das nur in der A-Redaktion erwähnte Verb heyra. Der Kontext liefert ausserdem den RAHMEN messa, welcher eine grössere Zahl von Zuhörern impliziert.
Beim zweiten Beleg rekurriert lesa mit demselben Subjekt und Akkusativobjekt: c) „tok þa Þordur at lesa bref vt fyrer kirkiu dyrum j stoplinum“ (LSB 113f.). ‚Þórðr ging dann nach draussen, um den Brief vor den Kirchentüren im Kirchturm zu verlesen‘ (Übers. KM). Hier unterscheiden sich aber die Werte für die Attribute ORT (ausserhalb der Kirche) und RAHMEN (ohne Zuhörer). Dennoch ist anzunehmen, dass Þórðr den Brief mit Stimme verlas. Er nagelt ihn danach an die Kirchentür, worauf der dritte Beleg von lesa folgt, der nur in der A-Redaktion vorkommt: d) „enn prestar og lærder menn sau brefit fest aa kirkiuhurdina a Holum. og lasu var þetta latinu bref heidarliga diktad“ (LSB 114). ‚Aber die Priester und Gelehrten sahen den Brief an der Kirchentür in Hólar befestigt und lasen [ihn]. Dieser Lateinbrief war hervorragend geschrieben‘ (Übers. KM). Die Werte für das Attribut LESER im Subjekt sind prestr ‚Priester‘ und lærðr maðr ‚gelehrter Mann‘. Das Akkusativobjekt ist eine Leerstelle, welche auf das vorhergenannte bréf als Wert für den TEXT verweist. Der letzte Satz nennt noch den Wert latína für das Attribut SPRACHE als Modifikator von bréf.
Zwei weitere Belege im Aktivum kommen im Kapitel 14 nach der A-Redaktion bzw. 17 nach der B-Redaktion vor. Der Priester Laurentius wird vom Erzbischof mit einem Brief zu den Chorherren geschickt, um drei von ihnen zu exkommunizieren. Beim ersten Beleg von lesa unterscheidet sich der Kontext in den beiden Redaktionen. In der A-Redaktion heisst es: e) „geck sira Laur(encius) vpp a kór. epter bode erchibyskups og las bref rumor *pestiferus“ (LSB 20). ‚Priester Laurentius ging gemäss dem Befehl des Erzbischofs zum Chor hinauf und las den Brief rumor pestiferus‘ (Übers. KM). Der LESER im Subjekt ist Laurentius und der TEXT im Akkusativobjekt ist bréf. Die Apposition lat. rumor pestiferus ‚vergifteter Ruf‘ war vermutlich der Anfang des Briefes (vgl. Grímsdóttir 1998: 248, Anm. 2). Die B-Redaktion unterscheidet sich im Akkusativobjekt und hat eine weitere Ergänzung: f) „gieck L(aurencius) vpp aa kor ok las bref erkibiskups eptir hans bodi“ (LSB 20). ‚Laurentius ging zum Chor hinauf und las den Brief des Erzbischofs nach seinem Befehl‘ (Übers. KM). Das Genitivattribut erkibiskups ist ein Wert für den ABSENDER. Die Konstituente eptir hans boði enthält das Substantiv boð ‚Befehl‘. Das Possessivpronomen hans verweist auf den Erzbischof, der sowohl ABSENDER des Briefes als auch AUFTRAGGEBER der Lesung ist (vgl. LSB 19). Eptir boði e-s ‚nach jds. Befehl‘ ist somit eine Konstruktion, um auf das Attribut Auftraggeber zu verweisen. Der Beleg zeigt zudem, dass der AUFTRAGGEBER beim Verlesen nicht anwesend sein muss.
Das Verb lesa rekurriert dann mit zwei Adverbien in beiden Redaktionen, die sich nur in der Graphie unterscheiden. Das folgende Zitat richtet sich nach der A-Redaktion: g) „las Laur(encius) so hatt og sniallt. ad þeir heyrdu giorlla þa suaradi Siguatur enn til. so seigiandi. eigi þarftu Islendingr so hatt ad ępa. þui vier heyrum huad þu seiger“ (LSB 20). ‚Laurentius las so laut und gewandt, dass sie es genau hörten. Darauf antwortete Sighvatr, indem er sagte: „Isländer, du brauchst nicht so laut zu schreien, denn wir hören, was du sagst“‘ (Übers. KM). Der LESER im Subjekt bleibt Laurentius. Der TEXT bréf ist allerdings eine Leerstelle. Die beiden Adverbien hátt ‚laut‘ und snjallt ‚gewandt‘ sind Werte für das Attribut STIMME. Das Lesen mit Stimme verdeutlichen ausserdem die Substitutionen segja ‚sagen‘ und œpa ‚schreien‘, ebenfalls mit dem Adverb hátt, sowie das Verb heyra ‚hören‘, die Konversion von lesa, dessen Subjekt vér ‚wir‘ auf das Substantiv kórsbrœðr ‚Chorherren‘ verweist, den Wert für das Attribut ZUHÖRER.
Der letzte Beleg hat ebenfalls zwei Adverbien als Ergänzung und ist nur in der B-Redaktion überliefert, weil an dieser Stelle die A-Redaktion eine Lakune aufweist: h) „Næsta dag þann sem hatid bar a. las sira Laurencius bref biskups eptir gudspiall j messo. suo hatt ok skyrt at Sigurdr ok allir þeir er j kirkiune uoru heyrdu“ (LSB 12). ‚Am nächsten Tag, der ein Feiertag war, verlas der Priester Laurentius den Brief des Bischofs nach dem Evangelium in der Messe so laut und deutlich, dass Sigurðr und all jene, die in der Kirche waren, ihn hörten‘ (Übers. KM). Das Subjekt enthält den Priester Laurentius als LESER. Der TEXT im Akkusativobjekt ist bréf mit dem Genitivattribut biskups einem Wert für den ABSENDER, der wieder zugleich AUFTRAGGEBER ist. Auch hier ist er nicht beim Verlesen answesend. Die Konstituente eptir guðspjall í messu nennt einerseits den RAHMEN messa und andererseits den ZEITPUNKT, nach der Lesung des Evangeliums (guðspjall). Die beiden Adverbien hátt ‚laut‘ und skýrt ‚deutlich‘ sind Werte für die STIMME. Das konverse Verb heyra verdeutlicht zusätzlich, dass Laurentius mit Stimme liest und enthält in seinem Subjekt den Wert allir í kirkju ‚alle in der Kirche‘ für das Attribut ZUHÖRER.