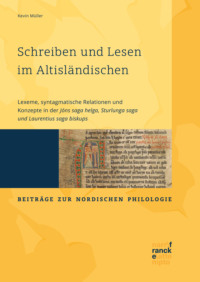Kitabı oku: «Schreiben und Lesen im Altisländischen», sayfa 25
2.4.1.4. lesa fyrir/yfir e-m ‚jdm vorlesen‘
Bei allen bisherigen Belegen ergaben sich Werte für das Attribut ZUHÖRER aus dem Kontext oder über die Werte anderer Attribute wie RAHMEN und AUFTRAGGEBER. Das zeigt, dass zwischen diesen Attributen Werteconstraints bestehen. In der nächsten Beleggruppe ist der ZUHÖRER nun auch eine Ergänzung des Verbs lesa in den schon bekannten Präpositionalobjekten fyrir und yfir e-m. Zwei dieser Belege mit fyrir sind aktiv und erscheinen im oben schon erwähnten Kapitel 48/57, in dem Bischof Laurentius dem Diakon Þórðr Guðmundarson das Vorlesen des Briefes verweigert, als Þórðr vor der Szene in der Kirche (vgl. Kap. 2.4.1.3.a–d) bei Laurentius ankommt. Die Stelle ist nach der A-Redaktion zitiert, welche sich von der B-Redaktion nur unwesentlich unterscheidet:
a) kuadi Þordur byskupinn. segiandi honum at hann hafde bref ok bod skap byskups Jons. at lesa fyrer honum. byskupinn suaradi. […] þarftu Þordur ecki þig ad bera ad l[e]sa nockur stefnu bref fyrer mier hier a stadnum. þuiat eg vil þau einginn heyra (LSB 112f.).
Þórðr begrüsste den Bischof und sagte ihm, dass er Brief und Geheiss des Bischofs Jón ihm vorzulesen habe. Der Bischof antwortete […]: „Þórðr, du brauchst dir nicht die Mühe zu machen, mir hier an diesem Ort / auf diesem Bischofssitz irgendwelche Vorladungsbriefe vorzulesen, denn ich will sie keineswegs hören“ (Übers. KM).
Subjekt des ersten Belegs von lesa ist Þórðr als LESER, das Akkusativobjekt enthält die Lexeme bréf und boðskapr ‚Geheiss‘ als Werte für den Text. Im Attributframe stünde bréf allerdings als Wert für die Attribute TEXTSORTE oder SCHRIFTTRÄGER und boðskapr für das Attribut BOTSCHAFT. Das Genitivattribut biskups Jóns ‚Bischof Jóns‘ verweist auf den ABSENDER. Das Präpositionalobjekt fyrir honum steht für Laurentius als ZUHÖRER. Der zweite Beleg von lesa ist in einem Infinitivsatz, nach dem Hauptsatz zu beurteilen, mit demselben LESER und dem Akkusativobjekt stefnubréf als Wert für den TEXT. Das Kompositum mit dem Modifikator stefna ‚Vorladung‘ enthält einen Wert für das Attribut BOTSCHAFT. Das Präpositionalobjekt fyrir mér verweist wieder auf Laurentius als ZUHÖRER. Neben Laurentius sind aber noch andere Geistliche und der Diakon Gregorius anwesend. Die Botschaft des Briefes ist aber eindeutig an Laurentius gerichtet, d.h. das Präpositionalobjekt fyrir e-m schliesst nur den EMPFÄNGER und nicht alle ZUHÖRER ein. Das anschliessend erwähnte Verb heyra ‚hören‘ verdeutlicht zusätzlich das Lesen mit Stimme. Die Ortsangabe hér á staðnum lässt zwei Interpretationen zu: Jørgensen (1982: 140) übersetzt es völlig korrekt mit „her på bispesædet“ ‚hier auf dem Bischofssitz‘, allerdings ist auch ‚hier an diesem Ort‘ möglich. Dass sich Laurentius an seinem Bischofssitz Hólar aufhält, wird in der Saga davor schon erwähnt. Genauer empfängt er Þórðr in der Sakristei (skrúðhús), wo sein Ornat abgenommen wird. Mit der Ortsangabe ist aber wohl der Bischofssitz, Laurentius’ Machtbereich gemeint, in dem er keine Eingriffe eines anderen Bischofs duldet. Das Verlesen des Briefes ist ein Sprechakt, welcher in einem Raum seine Wirkung zeigt, was Laurentius zu verhindern versucht. Þórðr erfüllt seinen Auftrag dann doch, indem er den Brief vor der Kirche verliest (vgl. Kap. III.2.4.1.1.c.). Bei diesem Beleg kommt das Attribut ORT mit dem Wert staðr ‚Ort, Bischofssitz‘ zur Sprache. Das Lesen hat eine räumliche Wirkung, die sich schon bei den performativen Sprechakten erwiesen hat. Die damit verbundenen Ergänzungen fyrir und yfir e-m enthalten Lokalpräpositionen, die LESER und ZUHÖRER in ein räumliches Verhältnis setzen. Die Präposition fyrir ist auch bei diesem Beleg gegeben. Das Lesen beschränkt seine Wirkung aber nicht nur auf Laurentius als Person, sondern erweitert sie auf den ganzen Bischofssitz mit der Angabe hér á staðnum. Ein drittes Mal steht die Kollokation im Passiv, die so nur in der A-Redaktion vorkommt, während in der B-Redaktion anstatt lesa e-t yfir steht (vgl. Kap. III.4.d.): b) „oll bref og skilriki hans voru gripin fra honum og lesinn fyrer kors brædrum“ (LSB 49). ‚Alle seine Briefe und Beweise wurden ihm [= Laurentius] weggenommen und den Chorherren vorgelesen‘ (Übers. KM). Das Subjekt enthält die Substantive bréf und skilríki. Ersteres ist ein typischer Wert für das Attribut TEXT, es ist jedoch unklar, in welcher schriftlichen Form die Beweise existierten. Das Präpositionalobjekt fyrir e-m verweist auf die Chorherren als ZUHÖRER, welche zwar nicht die vorgesehenen EMPFÄNGER dieser Briefe und Beweise sind, aber die intendierten Zuhörer der Lesung. Das Agens ist eine Leerstelle, die mithilfe des Kontextes nicht gefüllt werden kann.
Die Konstruktion lesa e-t yfir e-m ist je viermal in beiden Redaktionen belegt, im Gegensatz zu den obigen Sagas allerdings mit dem Thema bréf, was bezüglich den von Fritzner/Hødnebø (1972: 222) postulierten bösen Mächten Fragen aufwirft. Die drei Belege beziehen sich immer auf dasselbe Ereignis, nämlich als Laurentius im Auftrag des Erzbischofs die Exkommunikation dreier Chorherren verlesen muss. Bei der Erzählung dieser Szene, auf welche die drei Belege sich beziehen, kommen lediglich die Verben lesa und lesa upp vor, jedoch ohne die Ergänzung yfir e-m (vgl. LSB 19f., Kap. III.2.4.1.3.e–g. III.3.2.3.c.). Der erste Beleg unterscheidet sich in beiden Redaktionen unwesentlich und wird nach der A-Redaktion zitiert: c) „sijdan hann las brefid yfer kors brædrum“ (LSB 22) ‚seitdem er [= Laurentius] den Brief über den Chorherren las‘ (Übers. KM). Subjekt ist Laurentius als LESER, Akkusativobjekt ist der TEXT bréf und die Chorherren im Präpositionalobjekt yfir e-m die ZUHÖRER, aber auch Inhalt des Sprechaktes. Aus der Erzählung ist bekannt, dass die BOTSCHAFT aus einer Exkommunikation besteht.
Der zweite Beleg ist in beiden Redaktionen ähnlich überliefert, wobei in B die Ortsangabe á kór ‚im Chor‘ fehlt. Folgendes Zitat richtet sich nach der A-Redaktion: d) „voru þeir Eilifur og Audon þungaster Laur(encio) þui ad hann hafdi adur lesid bannsetningar bref. aa kor yfer þeim“ (LSB 50). ‚Eilífr und Auðunn waren gegenüber Laurentius sehr feindselig, denn er hatte früher den Exkommunikationsbrief im Chor über ihnen verlesen‘ (Übers. KM). Die Werte der Attribute LESER und ZUHÖRER sind bei diesem Beleg gleich. Das Akkusativobjekt enthält das Kompositum bannsetningarbréf, dessen Modifikator bannsetning ‚Exkommunikation‘ ein Wert für das Attribut BOTSCHAFT ist. Neu ist in der A-Redaktion die Ortsangabe á kór ‚im Chor‘, welche aber auch in der Szene vorkommt, auf welche der Beleg referiert. Das Substantiv kór ist wieder ein Wert für das Attribut ORT. Es steht in enger lexikalischer Beziehung zu den Chorherren (kórsbrœðr), dem Wert zu den Attributen ZUHÖRER bzw. EMPFÄNGER, und unterstreicht den Sprechakt, der nicht nur vor den Adressaten, sondern auch in ihrem sakralen Raum stattfindet.
Beim dritten Beleg erinnern die Chorherren Laurentius beim Verhör an die Exkommunikationsszene. Der Satz in der direkten Rede der Chorherren ist in den beiden Redaktionen lexikalisch unterschiedlich überliefert, es handelt sich jedoch um teilweise partielle Synonyme: œptir/hrópaðir ‚schriest/riefst‘, þá/er ‚als‘, bannsetningarbréf/bannsbréf ‚Bannbrief‘. Das folgende Zitat stammt aus der A-Redaktion: e) „allt æpter hærra þu sira Lafrans þa þu last bannsetningar <bref> yfer oss“ (LSB 51f.). ‚Du schriest viel lauter, Priester Laurentius (Lafrans), als du den Bannbrief über uns lasest‘ (Übers. KM). Die Werte für die Attribute LESER, TEXT und ZUHÖRER sind gleich wie beim zweiten Beleg. Hier rekurriert nicht nur lesa, sondern auch œpa ‚schreien‘ bzw. hrópa ‚rufen‘, welches wieder auf das Attribut STIMME referiert.
Beim vierten Beleg, der bis auf die Wortstellung in beiden Redaktionen gleich und nach der A-Redaktion zitiert wird, erinnert der Erzbischof Eilífr den Bischof Auðunn von Hólar, die davor beide Chorherren waren, in der direkten Rede an die Exkommunikationsszene: f) „þa er hann var med Jor(unde) erchibyskupe er hann las | yfer ockur bannsetninghar bref“ (LSB 81). ‚Als er [= Laurentius] bei Erzbischof Jǫrundr war, las er über uns beiden den Exkommunikationsbrief‘ (Übers. KM). Auch hier kommen wieder die gleichen Werte für die gleichen Attribute wie oben vor.
Die vier Belege haben alle die gleiche Struktur mit dem LESER als Subjekt, dem TEXT als Akkusativobjekt und den ZUHÖRER im Präpositionalobjekt mit yfir, der aber auch gleichzeitig Inhalt des Sprechaktes ist. Die Bedeutung der Kollokation lesa e-t yfir e-m ist also nicht so eng gesteckt wie in Fritzner/Hødnebø (1972: 222) mit der Übersetzung „lese en formel til hjelp mot vonde makter“ ‚eine Formel zur Hilfe gegen böse Mächte lesen‘. Es geht viel eher darum, einen ‚Leseakt‘, d.h. einen schriftlich gebundenen Sprechakt, an einer Person auszuführen, was Fritzner/Hødnebøs engere Deutung einschliesst.
Ein letzter Beleg, welcher nur in der B-Redaktion so vorkommt, hat Präpositionalobjekte mit yfir und fyrir: g) „uar þat bref lesit yfir kor at Holvm ok aa Modrv uollum fyrir brædrum ok uida annars stadar“ (LSB 130). ‚Dieser Brief wurde über dem Chor in Hólar und in Mǫðruvellir vor den Brüdern und weitherum an anderen Orten verlesen‘ (Übers. KM). Subjekt von lesa im Passiv ist bréf ‚Brief‘ als Wert für das Attribut TEXT. Es handelt sich um den Brief des Erzbischofs wegen der Mǫðruvellir-Angelegenheit, den Laurentius aus dem Lateinischen ins Nordische übersetzt hat (vgl. LSB 130). Dies impliziert den Wert norrœnn ‚nordisch‘ für das Attribut SPRACHE. Das Präpositionalobjekt mit yfir enthält wieder das Lexem kór ‚Chor‘, welches aber nicht die Chorherren in Nidaros betrifft, was die Werte Hólar und Mǫðruvellir für das Attribut ORT einschränken. Die Ortsangaben haben hier also keine erweiternde, sondern eine einschränkende Funktion. Der Chor der Kirche steht also metonymisch für die Geistlichen des Bischofsitzes und des Klosters. Von lesa hängt hier auch das Präpositionalobjekt mit fyrir ab, mit dem Substantiv brœðr ‚Brüder‘, also die Mönche des Klosters Mǫðruvellir, als Wert für das Attribut ZUHÖRER. Das Agens ist eine Leerstelle, welche auch nicht mithilfe des Kontexts gefüllt werden kann.
2.4.1.5. Zusammenfassung zu lesa bréf
Nach diesen vier Unterkapiteln ist es nötig, die verschiedenen Ergebnisse zusammenzufassen: Der Kernframe besteht aus den Attributen LESER als Agens mit den Werten djákni ‚Diakon‘, lærðr maðr ‚Gelehrter‘ und prestr ‚Priester‘ und TEXT als Thema mit dem Wert bréf, der teilweise als Kopf von Komposita die Modifikatoren bann ‚Kirchenbann‘, bannsetning ‚Exkommunikation‘, órskurðr ‚Urteil‘ und stefna ‚Vorladung‘ als Werte für die BOTSCHAFT sowie latína für die SPRACHE hat. Als Apposition kommen noch in der Paarformel mit bréf der Wert boðskapr ‚Geheiss‘ für die BOTSCHAFT und der TITEL rumor pestiferus vor. Ausserhalb dieses Kernframes ist das Attribut AUFTRAGGEBER mit den Werten erkibiskup ‚Erzbischof‘ und prestr ‚Priester‘ als Subjekt von Kausativkonstruktionen sowie biskup ‚Bischof‘ im Kontext belegt. Auf den AUFTRAGGEBER kann auch die Konstruktion eptir boði e-s ‚nach jemandes Auftrag‘ verweisen. Das Attribut STIMME hat die Werte hátt ‚laut‘, snjallt ‚gewandt‘, skýrt ‚klar‘ als Adverbien. Sie werden genannt, als der junge Priester Laurentius die Exkommunikation dreier Chorherren verliest. Positive Werte zu diesem Attribut scheinen bei einem jungen und unerfahrenen Kleriker nicht dem Standard entsprochen zu haben, so dass diese in der Erzählung hervorgehoben werden. Auf das Attribut ZUHÖRER wird entweder mit den Präpositionalobjekten fyrir e-m oder yfir e-m verwiesen, welche die Werte biskup ‚Bischof‘, kórsbræðr ‚Chorherren‘ und kumpánar ‚Kameraden‘ enthalten. Die beiden Präpositionalobjekte schliessen allerdings nicht alle anwesenden Zuhörer mit ein, sondern nur die intendierten ZUHÖRER der Lesung. Zwischen den Präpositionen gibt es, soweit man es anhand dieser Belege beurteilen kann, keinen weiteren semantischen Unterschied.
Für das Attribut RAHMEN gibt es nur den einen Wert messa ‚Messe‘ im Präpositionalobjekt í e-u. Eng verbunden mit dem RAHMEN und auch dem ZUHÖRER ist der ORT, welcher in der Laurentius saga biskups häufiger als Ergänzung von lesa belegt ist mit den Präpositionalobjekten á kór ‚im Chor‘, á staðnum ‚an dem Ort / auf dem Bischofssitz‘, á Mǫðruvǫllum ‚in Mǫðruvellir‘, at Hólum ‚in Hólar‘, fyrir kirkjunni ‚vor der Kirche‘, yfir kór ‚über dem Chor (der Kirche)‘. Diese Orte implizieren verschiedene sakrale Räume und Machträume, sowie verschiedene Rahmen von Öffentlichkeit, Privatheit etc, d.h. zwischen den Attributen ORT, RAHMEN und ZUHÖRER bestehen Constraints. Mit dem RAHMEN ist auch die einzige Nennung der ZEIT eptir guðspjall ‚nach dem Evangelium‘ eng verknüpft, weil der Wert das Verlesen in den Ablauf der Messe einordnet.
2.4.2. lesa psaltara ‚den Psalter lesen‘
Das Lesen des Psalters wird auch in der Laurentius saga biskups zweimal erwähnt. Beim ersten Beleg liest ihn Bischof Auðunn von Hólar. Es ist nur in der B-Redaktion lesa belegt, während in der A-Redaktion das Verb syngja ‚singen‘ steht: a) „Rodd hans var svo haa ok fogr at mikil lyst uar at heyra hans savng. bæna hallz madr uar hann mikill. hann las þridivng Dauids psalltara huern dag. ok þridiung uorrar fru psalltara“ (LSB 70). ‚Seine Stimme war so hoch und schön, dass es eine grosse Freude war seinen Gesang zu hören. Er war ein frommer Mann und las jeden Tag ein Drittel des Davidspsalters und ein Drittel des Marienpsalters‘ (Übers. KM). Das Pronomen hann im Subjekt verweist auf Bischof Auðunn als LESER. Das Akkusativobjekt enthält zweimal das Numerale þriðjungr ‚Drittel‘ mit je einem Genitivattribut psaltara ‚des Psalters‘ als Wert für den TEXT und je einem weiteren Genitivattribut, welches den Text determiniert: der Personenname David verweist auf die biblischen Psalmen und vár frú ‚unsere Frau‘ (d.h. Maria) auf den Marienpsalter, der Anselm von Canterbury zugeschrieben wurde (vgl. Grímsdóttir 1998: S. 328, Anm. 2). Das Numerale ist ein Wert für das Attribut TEIL, das im Frame von rita und skrifa ebenfalls vorkommt. Die Temporaladverbiale hvern dag ‚jeden Tag‘ ist ein Wert für das Attribut FREQUENZ. Im Kontext wird das Attribut STIMME (rǫdd) mit den beiden Adjektiven hár ‚hoch‘ und fagr ‚schön‘ als Werten und das konverse Verb heyra erwähnt.
Der zweite Beleg ist in beiden Redaktionen erhalten und wird nach der A-Redaktion zitiert. Er nennt das Lesen des Psalters im Schlafzimmer (svefnstofa) als tägliche Aktivität von Bischof Laurentius: b) las hann leinge psalltara (LSB 100). ‚Er las lange den Psalter‘ (Übers. KM). Das Personalpronomen hann im Subjekt verweist auf Laurentius als LESER. Das Akkusativobjekt enthält das Substantiv psaltari als Wert für den TEXT. Das Adverb lengi ‚lange‘ ist ein Wert für das Attribut ZEIT. Die Attribute ZEIT und TEIL sind einem Attributconstraint unterworfen, weil der Umfang der ZEIT und des TEILS einander bedingen. Obwohl bei den Psalmen das auswendige Rezitieren im Vordergrund stand, wird im Kontext noch erwähnt, dass Laurentius davor eine Blendleuchte (skons) gebracht wurde (vgl. LSB 100). Dies deutet daraufhin, dass Laurentius aus einem Buch las oder dieses als Hilfe bei der Rezitation benötigte. Es kann allerdings auch sein, dass das Licht allein der Präsenz des Schriftträgers diente.
Das Verb lesa rekurriert in beiden Redaktionen ohne Akkusativobjekt. Das folgende Zitat richtet sich nach der A-Redaktion: c) „las hann jnne medann hann klæddizt og þuozst“ (LSB 100). ‚Er las drinnen, während er sich ankleidete und wusch‘ (Übers. KM). Das Personalpronomen im Subjekt verweist wieder auf Bischof Laurentius und das Adverb inni ‚drinnen‘ bezieht sich auf das oben erwähnte Schlafzimmer (vgl. Beleg b.). Somit kommt ein neuer Wert svefnstofa für das Attribut ORT hinzu. Die Leerstelle des Akkusativobjekts verweist vermutlich auf den oben erwähnten Psalter (vgl. Beleg b.). Der durch meðan eingeleitete Temporalsatz enthält einen Wert für das Attribut ZEIT. Der Umstand, dass Laurentius mit dem Ankleiden und Waschen beschäftigt war, deutet daraufhin, dass Laurentius hier sicher einen Teil auswendig rezitierte.
2.4.3. lesa bœn ‚ein Gebet lesen‘
Das Lesen eines Gebets (bœn) hat nur einen Beleg in der A-Redaktion, an dessen Stelle die B-Redaktion eine Lakune aufweist. Bischof Laurentius liegt im Sterben: „let hann jafnan j sottenne lesa fyrer ser ex *posiciones. sæls Gregori paua og Augustini bæn“ (LSB 139f.). ‚Er liess sich in der Krankheit immer die expositiones des seligen Papstes Gregor und ein Augustinus-Gebet vorlesen‘ (Übers. KM). Subjekt der Kausativkonstruktion láta lesa ist Bischof Laurentius als AUFTRAGGEBER. Das Akkusativobjekt enthält die Lexeme expositiones ‚Auslegungen‘ (vgl. Georges 1998: I, 2595) und bœn ‚Gebet‘ als Werte für das Attribut TEXT mit den Autoren Papst Gregor I. und Augustin im Genitivattribut. Bei Ersterem handelt es sich vermutlich um die Auslegungen Gregors I. zum 1. Buch der Könige und zum Hohen Lied, bei letzterem vermutlich um dasselbe Gebet wie das Beichtgebet in der Handschrift AM 461 12mo aus dem 16. Jahrhundert, in welchem der heilige Augustin sagt, dass mit diesem Gebet jene Sünden vergeben werden, die man beim Beichten vergessen hat (vgl. Grímsdóttir 1998: S. 439, Anm. 4.). Das Präpositionalobjekt fyrir sér steht für den ZUHÖRER, dessen Reflexivpronomen auf das Subjekt zurückverweist. AUFTRAGGEBER und ZUHÖRER sind somit identisch. Das Adverb jafnan ‚immer‘ ist ein Wert für die ZEIT und das Präpositionalobjekt í sóttinni ‚in der Krankheit‘ einer für den RAHMEN, da es sich um eine Lesung zur Erbauung eines Kranken wie in der Sturlunga saga handelt (vgl. Kap. III.2.3.6.b.), wo der Wert sótt auch im Kontext bezeugt ist.
2.4.4. lesa lectionem ‚die Lectio lesen‘
Zu den religiösen Lesepraktiken gehört auch die Tischlesung (lectio) mit einem Beleg in der A-Redaktion, für welchen die B-Redaktion eine Lakune aufweist: „jafnann let hann einn huern klerk lesa lectionem fyrer bordi sinu. giordi þad jdugligast Oblaudur diakne Þorsteinsson“ (LSB 101). ‚Er liess immer einen Kleriker die lectio vor seinem Tisch lesen. Dies tat sehr häufig der Diakon Óblauðr Þorsteinsson‘ (Übers. KM). Lesa ist bei diesem Beleg Teil der Kausativkonstruktion mit láta + Inf. Das Personalpronomen hann im Subjekt verweist auf Bischof Laurentius als AUFTRAGGEBER. Das erste Akkusativobjekt hvern klerk ‚jeden Kleriker‘ ist das Agens bzw. LESER, und das zweite lectionem ‚Lesung‘ das Thema. Lat. lectio bedeutet ‚Lesung‘ (vgl. Georges 1998: II, 600f.), es handelt sich also um das Lesen als Handlung im Allgemeinen, und die Tischlesung im Besonderen. Es liegt somit eine typische metonymische Verschiebung von der Handlung zum Gegenstand der Handlung vor (vgl. Fritz 2006: 45). Das Substantiv lectio steht folglich für den TEXT, der während derselben gelesen wird. Das Präpositionalobjekt fyrir borði sínu ‚vor seinem Tisch‘ steht für den ORT, welcher den RAHMEN der Tischlesung mit dem Lexem borð noch verdeutlicht. Der Kontext verengt die Gruppe der Kleriker in einem Fall noch auf den Rang des Diakons (djákni) und nennt mit dem Adverb iðuliga ‚häufig‘ noch einen Wert für das Attribut FREQUENZ.
2.4.5. lesa tíðir ‚das Stundengebet lesen‘
Das altnordische Substantiv tíð bedeutet eigentlich ‚Zeit‘, steht aber im Plural tíðir häufig als Lehnübersetzung des lat. horae canonicae für das Stundengebet. Ausserdem kann es auch Gottesdienst oder Messe bedeuten (vgl. Fritzner 1886–96: III, 687). Für die Kollokation lesa tíðir gibt es in der Laurentius saga biskups fünf Belege.
Der erste Beleg aus der A-Redaktion, befindet sich am Ende der Saga, das in der B-Redaktion fehlt. Der im Sterben liegende Bischof Laurentius liest da trotz Schwäche noch sein Stundengebet: a) „Ad enndadre oliun aa þridiu dagin sem nu var fra sagt. minkade æ mattinn. enn þo suo ath hann las [sinar] tider“ (LSB 139). ‚Nach beendeter Ölung, am Dienstag, wie nun erzählt wurde, nahm seine Kraft immer mehr ab, aber er las immer noch sein Stundengebet‘ (Übers. KM). Subjekt ist Bischof Laurentius, das Akkusativobjekt tíðir, welches eigentlich ein Wert für den RAHMEN wäre, welcher hier aber metonymisch zum TEXT verschoben ist, der in diesem Rahmen gelesen wird. Das reflexive Possessivpronomen sínar deutet daraufhin, dass es sich um eine individuelle Andacht handelt. Es ist trotzdem anzunehmen, dass Laurentius der Liturgie entsprechend laut las oder auswendig rezitierte.
In der Erzählung über Bischof Laurentius’ Alltag gibt zwei weitere Belege, die sich in den beiden Redaktionen unterscheiden. Die A-Redaktion wird zuerst zitiert: b) „Sem hringde til ottu songs. las hann Mariu tider medan hann klæddizt. suo ed sama lasu klerkar Mariu tider vte j kỏr medann hringdi“ (LSB 99). ‚Als es zum Stundengebet läutete, las er [= Laurentius] die marianische Antiphon, während er eingekleidet wurde, zugleich lasen die Kleriker die marianische Antiphon draussen im Chor, während es läutete‘ (Übers. KM). Das Verb lesa ist zweimal mit dem Akkusativobjekt Maríu-tíðir belegt, welches in keinem Wörterbuch als Lemma vorkommt. Der Modifikator María deutet daraufhin, dass das Stundengebet in Bezug zur Mutter Gottes steht, so dass es sich um eine marianische Antiphon handelt, welche zum Abschluss der täglichen Stundengebete gesungen wurde (vgl. Gjerløw 1966: 276–278). Das Subjekt der beiden Belege ist unterschiedlich: beim ersten ist es Laurentius beim zweiten klerkar ‚Kleriker‘. Der zweite Beleg hat ausserdem die Ergänzung í kór ‚im Chor (der Kirche)‘ für den ORT. Laurentius wurde wahrscheinlich in der Sakristei mit dem Ornat versehen, während die übrigen Kleriker bereits in der Kirche waren. Das im Kontext genannte Substantiv óttusǫngr ‚Matutin‘ ist wieder ein Wert für den RAHMEN. Die Konjunktion meðan leitet einen Temporalsatz ein, welcher auf das Attribut ZEIT referiert, welches dann in der B-Redaktion einen konkreten lexikalischen Wert bekommt: c) „hann klæddizt jafnan vm ottu saungs hringingar ok las medan vorar fru tidir ok suo skylldu þa ok lesa adrir klerkar j kor“ (LSB 99). ‚Er zog sich immer zum Matutingeläut an und las während dessen die marianische Antiphon und so sollten [sie] dann auch die anderen Kleriker im Chor lesen‘ (Übers. KM). Die Subjekte sind wie in der A-Redaktion verteilt, das Akkusativobjekt ist hingegen nur beim ersten Beleg eine Füllung mit tíðir und dem Genitivattribut várrar frú ‚unserer Frau‘ anstelle des synonymen Modifikators María. Die Leerstelle beim zweiten Beleg verweist auf denselben TEXT. Beim zweiten Beleg ist auch derselbe ORT eine Füllung. Das elliptische Präpositionalobjekt meðan ‚während [dessen]‘ verweist mit seiner Leerstelle auf das vorhergenannte Kompositum óttusǫngshringingar ‚Matutingeläut‘, dessen Modifikator denselben Wert für den RAHMEN enthält wie in der A-Redaktion.
Der vierte Beleg ist nur in der A-Redaktion überliefert, weil die B-Redaktion an dieser Stelle eine Lakune aufweist, und gehört ebenfalls in die Erzählung über Bischof Laurentius’ Alltag: d) „geck byskupinn þegar vt til kirkiu vm fyrstu *hringing. lesanndi so salu tider med klerkum“ (LSB 101). ‚Der Bischof ging schon beim ersten Glockenläuten in die Kirche hinaus und las dann die Fürbitten für die Verstorbenen mit den Geistlichen‘ (Übers. KM). Lesa ist in einem Partizipialsatz enthalten mit Bischof Laurentius als Agens. Das Akkusativobjekt enthält das Kompositum sálutíðir, welches Baetke (2002: 514) mit sálumessa ‚Seelenmesse‘ gleichsetzt. Fritzner (1886–96: III, 162) übersetzt es allgemeiner als „Bønner som læses til bedste for de afdødes Sjæle“ ‚Gebete, welche den Seelen der Verstorbenen zum Besten gelesen werden‘. Fritzners Deutung ist bei diesem Beleg aus folgendem Grund vorzuziehen: Im Kontext wird der ZEITPUNKT um fyrstu hringing ‚beim ersten Glockenläuten‘ erwähnt, mit dem wohl die Prim gemeint ist. Die Totenfürbitte findet also im Rahmen dieses Stundengebets statt, in den ursprünglich auch die Seelenmesse gehörte (vgl. Johansson 1960: 112f.). Seelenmesse ist spezifischer als Totenfürbitte und muss in diesem Kontext nicht zutreffen. Die Konstituente með klerkum ist eine Ergänzung zum Agens, d.h. die übrigen Geistlichen sind ebenfalls LESER. Der Kontext nennt ausserdem noch den Wert kirkja ‚Kirche‘ zum Attribut ORT. Die Werte der Attribute LESER, ORT und ZEIT schränken bei diesem Beleg jene der Attribute TEXT, STIMME und RAHMEN ein.
Beim fünften Beleg liegt der Priester Laurentius von Sorgen geplagt im Bett und im Traum erscheint ihm ein Mann im Gewand eines Geistlichen, der ihm einen Rat gibt. Das Zitat stammt aus der A-Redaktion, welche sich nur unwesentlich von der B-Redaktion unterscheidet: e) „Enn eg legg þad rad til med þier. sem til betranar mun snuast vm þitt efni ef þu helldur þui. Les dagliga heilags anndatijder og gleym þui eigi. og mun heilags annda miskun hugga þig. og leysa þina kuol. og þraut“ (LSB 60). ‚Und ich gebe dir den Rat, der deine Situation zur Besserung wendet, wenn du dich daran hältst. Lies täglich das Stundengebet des Heiligen Geistes und vergiss es nicht. Und die Gnade des Heiligen Geistes wird dich trösten und dich von deiner Qual und Last erlösen‘ (Übers. KM). Wegen des Imperativs ist das Subjekt leer (in der B-Redaktion ist das Personalpronomen „þv“ ‚du‘ genannt). Der Befehl richtet sich mit oder ohne Personalpronomen an den Priester Laurentius. Der Wert für das Attribut LESER ist also prestr. Das Akkusativobjekt ist heilags anda tíðir ‚Stundengebet des Heiligen Geistes‘. In der B-Redaktion lautet es „tider af helgvm annda“ ‚Stundengebet vom Heiligen Geist‘. Jørgensen (1982: 178) erklärt die „Helligåndens tider“ mit „særlige tidebønner til Helligånden, hovedsagelig beregnede til at indgå i gudstjenesten på dennes festdag“ ‚besondere Stundengebete für den Heiligen Geist, hauptsächlich dafür gedacht, um sie an dessen Festtag im Gottesdienst einzusetzen‘. Damit gehört dieser Wert einerseits zum RAHMEN, aber auch zum TEXT, da dieses Stundengebet gesondert in einem individuellen Rahmen gelesen wird und nicht Teil eines Gottesdienstes in der Kirche bildet. Das Adverb dagliga ‚täglich‘ ist ein Wert für das Attribut FREQUENZ. Da der Befehl vom Mann in der Erscheinung stammt, ist dieser AUFTRAGGEBER. Im Kontext kommt noch das Attribut ZWECK in beiden Redaktionen in der Präpositionalphrase til betranar ‚zur Besserung‘ zum Zug und mit dem Heiligen Geist (heilagr andi) auch der ZUHÖRER.
Ein weiterer Beleg nennt das Stundengebet auch deutlich als Rahmen. Die A- und B-Redaktion unterscheiden sich an dieser Stelle nur in der Graphie. Das folgende Zitat richtet sich nach der A-Redaktion: f) „var honum. feingit. þad herbergi. sem aa uar gluggr. og hann matte lesa uit tider sinar“ (LSB 52). ‚Ihm [Laurentius] wurde das Zimmer gegeben, in dem es ein Fenster gab, und er konnte bei seinem Stundengebet lesen‘ (Übers. KM). Subjekt ist Priester Laurentius als LESER. Das Akkusativobjekt ist eine Leerstelle. Das Präpositionalobjekt við tíðir sínar ‚bei seinem Stundengebet‘ steht für den RAHMEN. Der Kontext liefert den Wert herbergi ‚Zimmer‘ für den ORT. Sowohl dieses Zimmer, in dem Laurentius gefangen gehalten wird, als auch das reflexive Possessivpronomen sinn, welches sich auf Laurentius bezieht, deuten auf eine individuelle Andacht hin. Das Zimmer hat Fenster, welche das für das Lesen nötige Licht in den Raum lassen. Diese Situation erinnert an die obige Stelle mit dem Psalter (vgl. Kap. III.2.4.2.b.), mit denselben Möglichkeiten, dass das Licht zum Lesen, zum Finden der Textstellen oder zur Präsenz des Schriftträgers benötigt wurde.
Ein letzter Beleg verweist ebenfalls auf einen Teil des Stundengebetes, das canticum Audite, ein Lobgesang aus dem Alten Testament (5. Mose, 32), das jeden Samstagmorgen bei der Matutin gesungen wurde (vgl. Grímsdóttir 1998: 274, Anm. 1). Diesen Lobgesang muss der Priester Eilífr bei einer Prüfung auf Laurentius‘ Vorschlag hin vortragen, worauf es im folgenden Beleg nach der A-Redaktion heisst: g) „kunni hann vist eigi. ad lesa audite“ (LSB 36). ‚Er konnte sicher nicht das Audite lesen‘. In der B-Redaktion ist noch das Adverb rétt ‚richtig‘ ergänzt (vgl. LSB 36). Dort folgt noch ein zweiter Beleg von lesa, an dessen Stelle syngja in der A-Redaktion steht: „Audsynt er þat sagdi L(aurenci)us at sialldan hefr þu lesit fialiter“ (LSB 36) ‚Es ist offensichtlich, sagte Laurentius, dass du selten f[er]ialiter gelesen hast‘ (Übers. KM). LESER ist in beiden Belegen und Redaktionen der Priester Eilífr im Subjekt. Beim ersten Beleg besetzt das lateinische audite ‚hört!‘ die Position des Akkusativobjekts. Es handelt sich wohl um eine Ellipse von canticum Audite, das vorher in der Saga inkorrekt als „canticanum audite“ belegt ist (vgl. LSB 36). Das lateinische canticum ‚Gesang, Lied‘ (vgl. Georges 1998: I, 966) wäre ein Wert für die TEXTSORTE und Audite einer für den TITEL. Die beiden Belege der B-Redaktion nennen auch noch je ein Adverb: 1. rétt als bekannter Wert für das Attribut STIMME und 2. lat. ferialiter, welches in Georges (1998) fehlt. Es handelt sich um ein Adverb des von feriae ‚Feiertage‘ abgeleiteten Adjektivs ferialis. Grímsdóttir (1998: 274, Anm. 3) übersetzt es ohne Quellenangaben mit „dagskipað helgihald“ ‚der für den Tag angeordnete Gottesdienst‘. Dies ist wohl so zu verstehen, dass Eilífr den Gottesdienst nicht den Anordnungen entsprechend las. Wahrscheinlich ist lesa im zweiten Beleg metonymisch verschoben im Sinne von lesa messu zu verstehen, d.h. das Ausüben des Gottesdienstes im Allgemeinen. Es kann aber durchaus enger aufs Lesen bezogen verstanden werden, weil die Liturgie die Art und Weise der Rezitation der Texte vorgab. Lat. ferialiter wäre folglich ein Wert für das Attribut STIMME. Auf jeden Fall führt es dazu, dass Eilífr die Erlaubnis verliert, die Messe zu halten (vgl. LSB 36).