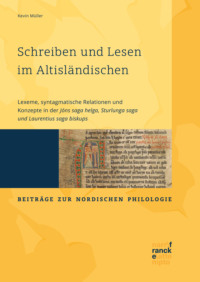Kitabı oku: «Schreiben und Lesen im Altisländischen», sayfa 26
2.4.6. lesa evangelium/guðspjall ‚das Evangelium lesen‘
In der religiösen Praxis ist die Messe und insbesondere das Lesen des Evangeliums in diesem Rahmen ein zentraler Bestandteil, was eine Stelle thematisiert, die in beiden Redaktionen unterschiedlich überliefert ist. Das erste Zitat stammt aus der A-Redaktion:
a) hann s[agdi] sig vera messu diakn og baudzt til at lesa ewangelivm j messvnne. var honum feinginn stola og sem hann byriade at lesa gudspiall þa sloknudu oll liosenn j kirkiunne. […] geck fram lesturinn diakna enn lios vrdu ecki kueickt. […] til bar hann og sig j odrum stad i kirkiu at lesa guds spiall. […] kenndizt hann at hafdi lesit tuo tima guds spiall. opinberliga j messu (LSB 131f.).
Er sagte, dass er Hilfspriester sei und bot an, das Evangelium in der Messe zu lesen. Ihm wurde eine Stola gegeben und er begann das Evangelium zu lesen, als alle Lichter in der Kirche erloschen. […] Die Lesung des Hilfspriesters setzte sich fort, aber die Lichter wurden nicht mehr angezündet. […] Er bot sich auch an einem anderen Ort an, in der Kirche das Evangelium zu lesen. […] Es wurde bekannt, dass er zweimal das Evangelium öffentlich in einer Messe gelesen hatte (Übers. KM).
Das Verb lesa ist an dieser Stelle viermal belegt. Agens ist immer ein namenloser Hilfspriester (messudjákni) als LESER. Das Akkusativobjekt wechselt zwischen den Synonymen guðspjall und evangelium ‚Evangelium‘ als Werte für den TEXT. Die einzelnen Belege haben nun noch weitere Ergänzungen: der erste í messunni ‚in der Messe‘ als RAHMEN, der dritte í kirkjunni ‚in der Kirche‘ als ORT, der vierte hat neben í messu (hier ohne enklitischen Artikel) noch die beiden Ergänzungen tvá tíma ‚zweimal‘ für die FREQUENZ, und opinberliga ‚öffentlich‘ für die STIMME. Die Hervorhebung des Öffentlichen hängt mit dem Weihegrad des Geistlichen zusammen, dem es nicht erlaubt ist, das Evangelium bei der Messe in der Kirche zu lesen. Eine individuelle Lesung ausserhalb eines sakralen Rahmens wäre dagegen erlaubt gewesen. Die Anmassung dieses Hilfspriesters führt dazu, dass die Lichter in der Kirche erlöschen.
Der Text in der B-Redaktion ist ähnlich jedoch mit unterschiedlichen Ergänzungen:
b) […] ok sagdizt vera messu diakn at uigslu. ok Mariv messu hina fyrre baudz hann at lesa ewangelium. var honum feinginn stola ok suo sem hann ætladi upp at byria. *sloknudu lios oll j kirkiuni ok urdv alldri kueikt medan hann las huerir sem til foru […] þuilikt uard j odrum stad er hann bar sig til at lesa <e>wangelium at lios oll sloknodu. […] kenndizt hann þa at hann hafdi tvo tima lesit <e>wangelium opinberliga j messu (LSB 131f.).
[…] und er sagte, dass er die Weihe eines Hilfspriester habe. Und an Mariä Himmelfahrt bot er an, das Evangelium zu lesen. Ihm wurde eine Stola gegeben und als er vorhatte anzufangen, erloschen alle Lichter in der Kirche und wurden nicht wieder angezündet, während er las, wer auch immer es versuchte. […] So geschah es auch an einem anderen Ort, als er sich dazu anschickte das Evangelium zu lesen, dass alle Lichter erloschen. […] Es wurde dann bekannt, dass er zweimal das Evangelium öffentlich in einer Messe gelesen hatte (Übers. KM).
Agens in allen vier Belegen ist der Hilfspriester als LESER. Das Akkusativobjekt den Wert evangelium für das Attribut TEXT. Nur der vierte Beleg hat ausserdem die Ergänzungen tvá tíma für die FREQUENZ, opinberliga für die STIMME und í messu für den RAHMEN. Der Wert kirkja für den ORT fehlt hingegen. Das Interrogativpronomen hverjir ‚wer (Nom. Pl. m.)‘ deutet im Zusammenhang mit den Anzündeversuchen der Lichter auf weitere Anwesende hin, d.h. es gab ZUHÖRER. Diese Stelle demonstriert in beiden Redaktionen, dass beim Lesen insbesondere sakraler Texte der Ort und der Rahmen eine wichtige Rolle spielen. Das öffentliche Lesen sakraler Texte in sakralem Rahmen und Räumen ist nur bestimmten Weihegraden vorbehalten. Dies verursacht auch das Erlöschen der Lichter.
2.4.7. lesa ohne Akkusativobjekt
Das Verb lesa ist transitiv und hat in der Regel ein Akkusativobjekt, welches aber in der Laurentius saga biskups bei einer Reihe von Belegen fehlt, obwohl es für das Verstehen dieses polysemen Lexems entscheidend ist. Der Kontext spricht jedoch bei allen Belegen für die Bedeutung ‚(Schrift) lesen‘. Die Belege lassen sich in drei Gruppen teilen: 1. Das Lesen als alltägliche Aktivität von Geistlichen, wie sie auch oben schon bei bestimmten Texten und Rahmen vorgekommen ist, 2. das richtige Lesen Geistlicher in Ausbildung, welches auch oben schon beim Priester Eilífr Thema war und 3. das Lesen als performativer Sprechakt mit dem Präpositionalobjekt yfir e-m, das auch schon vom Verlesen der Exkommunikation bekannt ist.
Die erste Gruppe umfasst zwei Belege, die in beiden Redaktionen vorkommen. Beim ersten, der sich in beiden Redaktionen deutlich unterscheidet, erzählt der Priester Laurentius einem alten und kundigen, aber namenlosen Priester bei der gemeinsamen Lektüre seinen Traum. Als erstes wird die A-Redaktion zitiert: a) „þeir lasu vm morginin epter tider bader saman. Laur(encius) sagdi honum dravm sinn“ (LSB 57). ‚Sie lasen am Morgen nach dem Gottesdienst beide zusammen. Laurentius erzählte ihm seinen Traum‘ (Übers. KM). Das Subjekt þeir báðir ‚sie beide‘ steht für die beiden Priester als LESER. Das Adverb saman ‚zusammen‘ verdeutlicht das gemeinsame Lesen. Die Präpositionalobjekte um morgininn ‚am Morgen‘ und eptir tíðir ‚nach dem Gottesdienst‘ sind Werte für die ZEIT, wovon letzterer schliesst auch den Rahmen des Stundengebets ausschliesst. Es handelt sich also um eine Lektüre ausserhalb der Liturgie zur Meditation, Erbauung o.ä. Wie die gemeinsame Lektüre vonstattenging, kann man wie in der Jóns saga helga (vgl. Kap. III.2.1.c.) nur ahnen. Die beiden Priester lasen beide individuell, zusammen oder einander vor.
Die B-Redaktion ist bezüglich Ergänzungen viel knapper: b) „Einum presti gomlum ok uelkvnnanda komnum um heidi s(agdi) hann þenna draum er þeir lasu um morginn“ (LSB 57). ‚Einem alten und sehr kundigen, über das Hochland gekommenen Priester erzählte er diesen Traum, als sie am Morgen lasen‘ (Übers. KM). Hier verweist das Personalpronomen þeir auf die beiden Priester als Leser und das Präpositionalobjekt um morgin auf die ZEIT. Ein liturgischer Rahmen kann im Gegensatz zur A-Redaktion also nicht ausgeschlossen werden.
Der zweite Beleg ist in beiden Redaktionen ähnlich und aus der A-Redaktion zitiert. Er beschreibt Laurentius‘ Tätigkeiten als Mönch (munkr) im Kloster Þingeyrar: c) „hans idn uar ecki [anna]t enn lesa kenna og studera j bokum“ (LSB 73). ‚Seine Tätigkeit bestand aus nichts anderem als Lesen, Unterrichten und dem Studium der Bücher‘ (Übers. KM). Subjekt ist der Mönch Laurentius als LESER, weitere Ergänzungen fehlen. Die Lexeme munkr, bók, kenna und studera evozieren einen Schriftlichkeitsframe, so dass lesa in diesem Kontext sicher ‚lesen‘ bedeutet. Der Wert munkr des Attributs LESER schränkt andere Werte aber ein. Lesen ist im Mönchtum von zentraler Bedeutung, in der Meditation, Andacht und Liturgie (vgl. Parkes 1999: 138f., Schnyder 2006: 432–437), so dass lesa hier ganz offen all diese Formen des monastischen Lesens mit den entsprechenden Werten zu den Attributen TEXT, STIMME und RAHMEN umfasst.
Die zweite Gruppe umfasst vier Belege, von denen zwei in beiden Redaktionen vorkommen. Beim ersten Beleg unterscheiden sich die beiden Redaktionen in der Wortwahl. Die A-Redaktion wird als erstes analysiert: d) „klerka þa sem syngia attu eda lesa. diakna og klerka let h[ann] suo tyfta ath þeir skylldu þad riettliga giora“ (LSB 97). ‚Jene Geistlichen, welche zu singen oder zu lesen hatten, Diakone wie Geistliche liess er züchtigen, damit sie es richtig machen würden‘ (Übers. KM). Die einzige Ergänzung ist das Subjekt klerkar ‚Geistliche‘, auf welche die Relativpartikel sem verweist. Das Modalverb eiga ‚haben, müssen‘ referiert auf die Pflicht dieser Geistlichen, wahrscheinlich liturgische Texte zu lesen und zu rezitieren. Lesa wird im Folgesatz durch gera ‚tun, machen‘ substituiert, von dem das Adverb réttliga ‚richtig‘ abhängt, das einen Wert für das Attribut STIMME bildet. Die liturgischen Texte müssen korrekt rezitiert werden, worauf auch die Sanktionen abzielen.
In der B-Redaktion hat lesa eine zusätzliche Ergänzung: e) „klerka þa sem lesa attv edr singia j heilagri kirkiu liet hann þa suo typta at þeir gerdi sem fagrligazt ok best“ (LSB 97). ‚Jene Geistlichen, welche in der heiligen Kirche zu lesen oder zu singen hatten, liess er züchtigen, damit sie es so schön und gut wie möglich machen würden‘ (Übers. KM). Das Präpositionalobjekt í heilagri kirkju steht für den ORT. Von der Substitution gera hängen im Unterschied zur A-Redaktion die Adverbien fagrligast ‚sehr schön‘ und bezt ‚sehr gut‘ ab, die ebenfalls Werte für das Attribut STIMME darstellen, von denen ersterer im Gegensatz zur A-Redaktion ästhetische Anforderungen stellt.
Der zweite Beleg ist ebenfalls in beiden Redaktionen überliefert, der dritte allerdings an derselben Stelle jedoch nur in der A-Redaktion, so dass diese als erstes analysiert wird:
f) gengu til skola iafnan. fimtan edur fleire. skilldu þeir sem lesa attu hafa yfer vm kuelldit adur fyrer skola meistara. og taka hirtinngh af honum er þeir lęsi eigi riett edur syngi (LSB 98).
Es gingen immer fünfzehn oder mehr zur Schule. Diejenigen, die zu lesen hatten, sollten am Abend zuvor vom Schulmeister geprüft werden und eine Strafe von ihm entgegennehmen, wenn sie nicht richtig läsen oder sängen (Übers. KM).
Da lesa hier im Rahmen der Schule (skóli) erscheint, in der Lesen und Schreiben einen zentralen Bestandteil bilden, kann die Bedeutung ‚sammeln‘ sicher ausgeschlossen werden. Das Lexem skóli kann also als Wert für das Attribut RAHMEN genommen werden. Die Bedeutung der Partikelverbs hafa yfir ist unsicher, weil es nur in dieser Szene belegt ist. Fritzner (1886–96: I, 685) versieht seine Deutung „blive overhørt, blive underkastet Prøve eller Examen?“ ‚überprüft werden, einer Prüfung oder einem Examen ausgesetzt werden?‘ mit einem Fragezeichen. Subjekt beider Belege von lesa sind die Kleriker (klerkar), auf welche das Pronomen þeir ‚sie (m. Pl.)‘ referiert. Das Akkusativobjekt fehlt bei beiden. Der dritte Beleg ist zusammen mit dem Verb syngja durch das Adverb rétt ‚richtig‘ als Wert für die STIMME ergänzt. Es geht also wieder nicht darum, was, sondern wie gelesen wird. Dass das Geschriebene korrekt wiedergegeben werden muss, haben oben schon die Belege aus der Jóns saga helga gezeigt, wo ein Priester nicht richtig und auch sonst schlecht liest (vgl. Kap. III.2.1.a. und 2.2.1.).
Die B-Redaktion teilt nur den zweiten Beleg von lesa mit der A-Redaktion: g) „skylldu þeir sem lesa attu hatidardaga. skylldv æ sia fyrir um kvelldit fyrir skola meistara ok taka hirting fyrir þat sem aa fatt er“ (LSB 98). ‚Diejenigen, die an den Feiertagen lesen sollten, sollten sich immer am Abend vor dem Schulmeister darum kümmern und und eine Rüge für das entgegennehmen, was mangelhaft ist‘ (Übers. KM). Das Personalpronomen þeir im Subjekt verweist wie in der A-Redaktion auf die Geistlichen (klerkar). Der Akkusativ hátíðardaga ‚an den Feiertagen‘ ist temporal zu verstehen und liefert somit einen Wert für das Attribut ZEIT, welcher zudem einen entsprechenden RAHMEN wie die Messe, das Stundengebet oder die Tischlesung impliziert. Die STIMME wird ebenfalls im Kontext mit dem Wert fátt ‚wenig, fehlend‘ thematisiert.
Der dritte Beleg ist nur in der A-Redaktion erhalten, weil die B-Redaktion an dieser Stelle eine Lakune aufweist und berichtet nach welchen Kriterien Laurentius Geistliche höher weiht: h) „adur hann villde þa fram [vigia. f]or hann mest ad þui huerssu þeir sungu og lasu j heilagre kirkiu“ (LSB 104). ‚Bevor er sie höher weihen wollte, kümmerte er sich meistens darum, wie sie in der heiligen Kirche sangen und lasen‘ (Übers. KM). Das Personalpronomen þeir im Subjekt referiert auf klerkar (vgl. LSB 103). Das Präpositionalobjekt í heilagri kirkju bezieht sich auf den ORT. Das attributive Adjektiv heilagr ‚heilig‘ betont den sakralen Raum der Kirche. Das Interrogativadverb hversu ‚wie‘, welches den indirekten Fragesatz einleitet, ist eine Füllung des Attributs STIMME, welche in anderen Belegen funktional gleich Modaladverbien als Werte hat.
Die dritte Gruppe hat nur einen Beleg, der wegen einer Lakune in der B-Redaktion nur in der A-Redaktion überliefert ist. Der Priester Snjólfr bekommt, nachdem er Bischof Laurentius gekränkt hatte, in der Nacht Schwellungen. Er ruft nach Bischof Laurentius und bittet ihn um Vergebung. Laurentius sagt, dass er dazu bereit sei, und darauf heisst es: i) „las byskupinn þa yfer honum batnade honum þa med Gudz vilia“ (LSB 107). ‚Der Bischof las dann über ihm. Darauf ging es ihm mit Gottes Willen besser‘ (Übers. KM). Subjekt ist Bischof Laurentius, das Präpositionalobjekt yfir honum ‚über ihm‘ verweist auf den Priester Snjólfr. Der genaue Inhalt des Sprechaktes ist nicht bekannt, es handelt sich aber wahrscheinlich um Laurentius’ Vergebung. Gemäss der Saga wirkt der Sprechakt. Der Beleg erinnert an jenen im Gísls þáttr Illugasonar, in dem Jón ein Gebet über Sigurðr und Auðunn liest (vgl. Kap. III.2.2.4.d–e.), so dass anzunehmen ist, dass Laurentius ein bestimmtes Gebet rezitierte.
Diese Reihe von Belegen ohne Akkusativobjekt und somit ohne Werte für das Attribut TEXT gibt interessante Anhaltspunkte zum Frame, weil sie diverse Werte zu anderen Attributen liefern: zum Attribut LESER djákni ‚Diakon‘, munkr ‚Mönch‘ und klerkr ‚Kleriker‘, zur STIMME rétt ‚richtig‘ sowie bezt ‚sehr gut‘, fagrligast ‚sehr schön‘, fátt ‚wenig, fehlend‘ und réttligr ‚richtig‘ im Kontext, zur ZEIT morgin ‚Morgen‘, tíðir ‚Stundengebet‘ und hátíðardagar ‚Feiertage‘ und zum ORT kirkja ‚Kirche‘. Der RAHMEN skóli ‚Schule‘ ist nur im Kontext erwähnt. Es bestehen zahlreiche Constraints zwischen diesen Werten und jenen für das Attribut TEXT: Der Wert munkr beschränkt die Werte auf Texte der monastischen Lektüre, die Werte zu ORT und ZEIT auf die Texte der jeweiligen Gottesdienste und der RAHMEN skóli auf die Lektüre in der Schule. Zudem offenbaren die Belege Constraints zwischen LESER, STIMME und RAHMEN; weil Geistliche in der Ausbildung das Lesen erst üben müssen, können bei ihnen keine positiven Werte zur STIMME vorausgesetzt werden. Bei einem ausgebildeten Geistlichen darf man Defaultwerte wie richtig, hörbar und schön erwarten. Dass dies nicht unbedingt zutrifft, demonstrieren die Belege aus der Jóns saga helga (vgl. Kap. III.2.1.a. und 2.2.1.). Der RAHMEN stellt gewisse Anforderungen an die STIMME, denn die Texte in der Liturgie müssen entsprechend gelesen werden.
2.4.8. lesa im religiösen Rahmen
Bis auf den Text decken sich die Attribute der Belege ohne Akkusativobjekt weitgehend mit jenen des religiösen Rahmens mit Akkusativobjekt ab: Es gibt den LESER mit den zusätzlichen Werten biskup ‚Bischof‘, messudjákni ‚Hilfspriester‘ und klerkr ‚Kleriker‘, den TEXT mit den Werten bœn ‚Gebet‘, canticum audite ‚Gesang Audite‘, evangelium bzw. guðspjall ‚Evangelium‘, expositiones ‚Auslegungen‘, lectio ‚Tischlesung‘, psaltari ‚Psalter‘ und tíðir ‚Stundengebet‘. Die Werte gehören auch zu den jeweiligen Attributen wie TEXTSORTE, TITEL oder INHALT des Attributframes TEXT oder zum RAHMEN. Dies verdeutlicht das Präpositionalobjekt við tíðir, welches das Stundengebet als Rahmen hervorhebt. Verbunden mit dem TEXT ist auch das Attribut TEIL mit dem Wert þriðjungr ‚Drittel‘. Zum Attribut STIMME, welches das Lexem rǫdd bezeichnet, werden weniger Werte genannt. Die einzige Füllung ist das Adverb opinberliga, im Kontext gibt es die Adjektive fagr ‚schön‘ und hár ‚hoch‘. Das Adverb demonstriert wieder, dass gewisse Constraints bestehen und zwar zwischen LESER, STIMME, TEXT und RAHMEN, weil der Hilfspriester das Evangelium in der Messe nicht öffentlich lesen darf. Beim liturgischen Lesen sind Werte für das Attribut ZEIT häufig. Der Attributframe umfasst verschiedene weitere Attribute wie ZEITPUNKT fyrsta hringing ‚Primgeläut‘, óttusǫngshringing ‚Matutingeläut‘, -DAUER lengi ‚lange‘ oder FREQUENZ hvern dag ‚jeden Tag‘, dagliga ‚täglich‘ jafnan ‚immer‘, tvá tíma ‚zweimal‘, welche die Werte für den TEXT und RAHMEN wieder einschränken, beispielsweise hringing für das jeweilige Stundengebet oder lengi für die Meditation. Der RAHMEN hat neben við tíðir noch die beiden Füllungen í messu ‚in der Messe‘ und í sótt ‚bei der Krankheit‘, wobei letzterer Wert sótt metonymisch für die Erbauung eines Kranken steht. Die Füllungen für das Attribut ORT wie fyrir borði ‚vor dem Tisch‘, í kór ‚im Chor‘ und das im Kontext erwähnte Schlafzimmer (svefnstofa) geben wieder Anhaltspunkte zum RAHMEN, TEXT oder der STIMME. Das einzige Attribut, welches neben TEIL bei den Belegen ohne Akkusativobjekt fehlt, ist der AUFTRAGGEBER mit dem Wert biskup.
Im Kontrast zur Kollokation lesa bréf zeigt sich, dass im religiösen Rahmen Attribute wie ZEIT, STIMME und RAHMEN häufiger als Ergänzungen belegt sind, weil zwischen ihnen und auch dem TEXT entscheidende Constraints bestehen. Auf das Attribut ZUHÖRER verweist nur die Ergänzung yfir e-m mit dem Wert prestr, weil die intendierten Zuhörer des religiösen Lesens vor allem Gott, der Heilige Geist, Maria und Heilige sind und die nicht intendierten Zuhörer sich aus dem Rahmen ergeben.
2.4.9. lesa sǫgu ‚eine Geschichte lesen‘
Neben den Rahmen der Korrespondenz und Liturgie werden Heiligenlegenden im Rahmen der Erbauung vorgelesen, wie folgender Beleg der Kollokation lesa sǫgu zeigt, der nur in der A-Redaktion überliefert ist, weil an der Stelle die B-Redaktion eine Lakune aufweist: „sagdi Einar diakne byskupinum heilagra manna sogur. aa norrænu edur stundum las latinu sögur þar til“ (LSB 101). ‚Diakon Einarr erzählte dem Bischof [Laurentius] Geschichten heiliger Leute in der nordischen Sprache oder las manchmal zusätzlich lateinische Geschichten‘ (Übers. KM). Subjekt ist der Diakon Einarr als LESER. Das Akkusativobjekt enthält das Kompositum latínusǫgur für den TEXT, mit dem Kopf sǫgur als Wert für die TEXTSORTE und dem Modifikator latína als Wert für die SPRACHE. Der Kopf sǫgur ist eine Ellipse der zuvor genannten Konstituente heilagra manna sǫgur ‚Geschichten heiliger Leute‘, deren Genitivattribut ein Wert für den INHALT ist. Das Adverb stundum ‚manchmal‘ ist ein Wert für das Attribut ZEIT. Der ZUHÖRER Bischof Laurentius ist im Dativobjekt des Verbs segja ‚sagen‘ enthalten, welches möglicherweise auch von lesa abhängig sein könnte, obwohl Dativobjekte bei diesem Verb selten sind. In der Laurentius saga biskups gibt es neben diesen nur noch einen Beleg (vgl. Kap. III.2.4.10.). Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der semantische Kontrast zwischen den Verben segja und lesa. Die nordischen Heiligenlegenden erzählt Diakon Einarr, während er die lateinischen vorliest, obwohl diese Gattung in beiden Sprachen schriftlich überliefert ist. Möglicherweise liegt es an Einars Lateinkompetenz, dass er bei den lateinischen Legenden sich auf einen geschriebenen Text stützte, während er die nordischen frei erzählen konnte.
2.4.10. lesa lǫg ‚Gesetze lesen‘
Neben lesa sǫgu gibt es auch einen Beleg der Kollokation lesa lǫg in der B-Redaktion, an einer Stelle, wo die A-Redaktion eine Lakune aufweist: „Nu er þar til ad taka ad Laur(entius) var med Jorunde erchibyskupe j Nidar ȯse, og studeradi jafnan j kyrkiunnar logum, er meistare Johannes flæmingie las honum“ (LSB 17). ‚Nun ist davon zu erzählen, dass Laurentius beim Erzbischof Jǫrundr in Nidaros war, und studierte da immer in den Gesetzen der Kirche, welche ihm Magister Johannes flæmingi vorlas‘ (Übers. KM).1 Subjekt ist meistari Johannes flæmingi ‚Magister Johannes der Flame‘. Die Relativpartikel er im Akkusativobjekt verweist auf lǫg ‚Gesetze‘ im Hauptsatz mit dem Genitivattribut kirkjunnar ‚der Kirche‘, welches die Gesetze auf den Bereich des Kirchenrechts eingrenzt. Das Personalpronomen honum im Dativobjekt verweist auf Johannes’ Schüler Laurentius.
Diese Lehrer-Schüler-Konstellation beim Lesen erinnert an die Beispiele von Hugo von St. Viktor und Johannes von Salisbury mit einem lesenden Lehrer, dessen Rolle durch den Titel meistari ‚Magister, gelehrter Mann, Lehrer‘ (vgl. Baetke 2002: 415) verdeutlicht wird, und einem zuhörenden Schüler. Auch syntaktisch stimmt es insofern überein, als dass der Lehrer Subjekt von lesa ist und der Schüler das Dativobjekt. Die seltene Konstruktion lesa e-t e-m bedeutet sicher wie oben bei lesa sǫgu e-m ‚jdm. etw. vorlesen‘ (vgl. Kap. III.2.4.9), in der obigen Unterrichtssituation möglicherweise auch ‚jdn. etw. (Schriftliches) lehren‘. Da es sich um einen Einzelbeleg handelt, kann nicht entschieden werden, ob diese Bedeutung konventionell ist. Auch im ONP (lesa) lassen sich keine Belege in einer vergleichbaren Situation finden, weil sie in eine allgemeine Vorlesesituation gehören wie jene mit dem Präpositionalobjekt fyrir e-m. In der Hulda beispielsweise wurde Gregorius das Evangelium vorgelesen („ok var honvm lesít gvðspíall“ Louis-Jensen [in spe]: 303) und in der Þorláks saga helga liess sich Bischof Þorlákr oft schriftliche Erzählungen vorlesen („Þorlakur byskup liet optliga lesa sier boksaugur“ Helgason 1978: 273). Sicher ist jedoch, dass hier wieder ein anderer Rahmen, der Unterricht, hinzukommt. Er ist aber nicht vergleichbar mit den obigen Belegen ohne Akkusativobjekt, wo das Lernziel des Unterrichts das Lesen und nicht das Studium des Kirchenrechts ist.