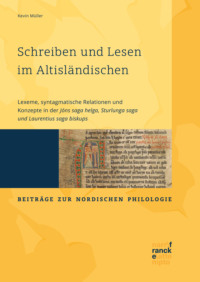Kitabı oku: «Schreiben und Lesen im Altisländischen», sayfa 27
2.4.11. lesa vers ‚Verse lesen‘
Die TEXTSORTE vers ‚Vers‘ kam weiter oben schon als Modifikator von versabók ‚Versbuch‘ vor (vgl. Kap. III.2.2.2.a.). Vers ist auch als Akkusativobjekt von lesa in der Laurentius saga biskups einmal in der B-Redaktion belegt (in der A-Redaktion gibt es eine Lakune), wo der Priester Laurentius nach Nidaros zum Erzbischof Jǫrundr kommt, der Laurentius dazu auffordert, ihm zu beweisen, dass er schreiben und dichten kann:
Enn kom til vor ȧ morgin og sẏn oss letr þitt, og ef þú kannt nockud ad dẏckta. Næsta dag epter kom sẏra Laur(entius) til erchi byskups, halldandi ȧ einne rollu̇. Erchi byskupinn leẏt ȧ og lofadi letrid, og mællti, les fyrer oss þad er þu̇ hefur dẏcktad. hann las þar af vers er hann hafdi giort til fru̇ Hallberu̇ abbadẏsar ad Stad. Er hu̇n gȯd kona sagdi erchi byskupinn er þu̇ hefur so lofad hana. þad hallda menn satt ä Jslandi sagdi Laur(entius) (LSB 16).
„Und komm morgen zu Uns und zeig Uns deine Schrift, und ob du etwas dichten kannst.“ Am nächsten Tag danach kam Priester Laurentius zum Erzbischof und hielt eine Rolle in der Hand. Der Erzbischof schaute darauf und lobte die Schrift und sprach: „Lies Uns vor, was du gedichtet hast!“ Er las davon einen Vers, den er über die Äbtissin Frau Hallbera von Stad gemacht hatte. „Sie ist eine gute Frau“, sagte der Erzbischof, „wenn du sie so lobst.“ „Dies halten die Leute in Island für wahr“, sagte Laurentius (Übers. KM).
Lesa ist in diesem Abschnitt zweimal belegt: Beim ersten Beleg ist das Subjekt wegen des Imperativs leer, aber es ist eindeutig Laurentius, der in der direkten Rede angesprochen wird. Der ZUHÖRER ist der Erzbischof im Präpositionalobjekt fyrir oss ‚vor Uns‘. Neben Laurentius und dem Erzbischof werden keine weiteren Personen erwähnt. Entweder weist das Pronomen im Plural auf weitere Personen hin oder es handelt sich um einen Pluralis Majestatis. Der Erzbischof ist gleichzeitig AUFTRAGGEBER, weil er den Befehl gegeben hat. Das Akkusativobjekt ist das Pronomen þat ‚das‘, ergänzt durch den Relativsatz er þú hefr diktat ‚was du gedichtet hast‘, was also der von Laurentius verfasste zu lesende Text ist. Daraus gibt es folgende Konstruktion lesa e-t fyrir e-m ‚jemandem etw. vorlesen‘ mit den Rollen LESER, TEXT und ZUHÖRER. Der zweite Beleg hat zwei Füllungen mit dem ersten gemeinsam, nämlich das Subjekt und das Akkusativobjekt, welches hier nun durch das Substantiv vers besetzt ist. Der ZUHÖRER, welcher aus dem ersten Beleg bekannt ist, bildet eine Leerstelle, dafür kommt der vorher schon erwähnte SCHRIFTTRÄGER rolla ‚Rolle‘, auf den das Proadverb þar af ‚davon‘ verweist (vgl. Kap. III.2.2.4.a.). Das Verb erhält also andere Ergänzungen, welche sich zu einer Konstruktion lesa e-t af e-u ‚von etwas ablesen‘ zusammenfassen lassen, mit den Attributen LESER, TEXT und SCHRIFTTRÄGER.
2.4.12. Der Frame von lesa in der Laurentius saga biskups
Die grosse Zahl der Belege von lesa in der Laurentius saga biskups ergibt einen Frame mit zahlreichen Attributen und Werten. Den Kern des Frames bilden die beiden Attribute LESER als Agens und TEXT als Thema. Die Werte für das Attribut LESER sind verschiedene Ränge von Geistlichen vom Hilfspriester bis zum Bischof, im Folgenden alphabetisch aufgeführt: biskup ‚Bischof‘, djákni ‚Diakon‘, klerkr ‚Kleriker‘, lærðr maðr ‚Gelehrter‘, meistari ‚Magister, (Lehr-)Meister‘, messudjákni ‚Hilfspriester‘, munkr ‚Mönch‘ und prestr ‚Priester‘. Die Tatsache, dass nur Geistliche als Leser vorkommen, bedeutet nicht, dass nicht auch Laien in dieser Zeit lasen wie etwa in der Sturlunga saga. Belege von lesenden Laien fehlen lediglich, weil die Laurentius saga biskups in einem vorwiegend geistlichen Milieu handelt. Der Rang des Geistlichen ist für gewisse Rahmen entscheidend wie etwa jener des Hilfspriesters, der das Evangelium in der Messe nicht lesen darf.
Das Thema steht zwar für das Attribut TEXT, aber es sind darin häufig Werte für Attribute des Attributframes enthalten wie SCHRIFTTRÄGER, TEXTSORTE, INHALT, TEIL oder TITEL. Das jeweilige Lexem wird folglich metonymisch zum Text verschoben. Oft werden weitere Werte des TEXT-Frames im Kontext erwähnt. Die Werte lassen sich einem oder mehreren Attributen des Attributframes zuordnen: Für das Attribut SCHRIFTTRÄGER sind bréf ‚Brief‘ und psaltari ‚Psalter‘ belegt, wobei bréf auch einen Wert für die TEXTSORTE und psaltari für den TEXT an sich darstellen kann. Nur ein Beleg hebt den SCHRIFTTRÄGER rolla ‚Rolle‘ im Präpositionalobjekt af e-u als solchen besonders hervor und grenzt ihn klar vom TEXT im Akkusativobjekt ab. Das für den Schriftträger Brief stereotype Siegel (innsigli) wird nur ein einziges Mal im Kontext genannt, ist aber nie eine Ergänzung von lesa. Dies verdeutlicht, dass bei lesa das Lesen bzw. Vorlesen des Textes im Zentrum steht, während die Materialität des Schriftträgers sekundär ist. Neben bréf gibt es eine Reihe von Werten für das Attribut TEXTSORTE wie Komposita mit dem Kopf bréf und den Modifikatoren bann ‚Bann‘, bannsetning ‚Exkommunikation‘, órskurðr ‚Urteil‘ und stefna ‚Vorladung‘ als Werten für den INHALT. Ein weiterer Wert für die TEXTSORTE ist saga ‚Saga, Geschichte‘, der gleichzeitig einen Wert für das Attribut INHALT bilden kann. Der Modifikator latína ‚Latein‘ ist ein Wert für das Attribut SPRACHE und das Genitivattribut heilagra manna ‚heilige Leute‘ einer für das Attribut INHALT. Gleichermassen kommen die Substantive bœn ‚Gebet‘ und lǫg ‚Gesetz‘ als Werte sowohl für die Attribute TEXTSORTE als auch INHALT in Frage. Zu letzterem gibt es das Genitivattribut kirkjunnar ‚der Kirche‘, um das Gesetz der Kirche vom weltlichen zu unterscheiden. Die Lexeme boðskapr ‚Geheiss‘, expositiones ‚Auslegungen‘ und skilríki ‚Beweis‘ finden hingegen nur beim Attribut INHALT Anschluss. Da hier mehrere Lexeme wegen ihrer Polysemie verschiedene Attributanschlüsse erlauben, wäre es in einem weiteren Schritt nötig ihre Frames noch zu analysieren. Die zahlreichen Metonymien und Polysemien liegen in der Natur des Textes, welcher in schriftlicher Form auf einem Schriftträger existiert und einen bestimmten Inhalt hat.
Neben diesen Metonymien gibt es auch tatsächlich einen Wortschatz, um bestimmte Texte zu identifizieren. Diese Kriterien erfüllt schon das Substantiv psaltari ‚Psalter‘, das einen Kodex bezeichnet, welcher die biblischen Psalmen enthält. Somit kann psaltari auch als Bezeichnung für den darin enthaltenen Text gelten. Dasselbe trifft auf folgende Lexeme zu, welche als Wert für das Attribut TITEL in Frage kommen: audite (Anfang eines Psalms), Augustini bœn ‚Augustinus-Gebet‘, Davids psaltari ‚biblische Psalmen‘, evangelium, guðspjall ‚Evangelium‘, kirkjunnar lǫg ‚Kirchengesetz‘, rumor pestiferus (Anfang eines Briefes), várrar frú psaltari ‚Marienpsalter‘. In Verbindung mit dem Psalter steht das Attribut TEIL mit dem einzigen Wert þriðjungr ‚Drittel‘, welcher nicht mit jenem des Schreibframes gleichzusetzen ist, wo Textteile aus Vorlagen neu zusammengesetzt werden. Das Drittel bildet eher den Teil eines Zyklus in der Meditation, was der zusätzliche Wert hvern dag ‚jeden Tag‘ des Attributs ZEIT vedeutlicht.
Im Kontext von lesa werden auch drei Autoren genannt: der Kirchenvater Augustin, der biblische König David und Papst Gregor der Grosse, welche jedoch nie das Akkusativobjekt besetzen, d.h. die in modernen Sprachen typische metonymische Verschiebung vom Autor zum Text kommt noch nicht vor.
Weil lesa in fast allen Belegen ‚vorlesen‘ bedeutet, ist die Stimme des Lesers Voraussetzung dafür, dass die Zuhörer den Text wahrnehmen können. Auf das Attribut STIMME, für welches in der Laurentius saga biskups das Lexem rǫdd belegt ist, referieren verschiedene Adverbien: hátt ‚laut‘, opinberliga ‚öffentlich‘, rétt ‚richtig‘, skýrt ‚klar‘ und snjallt ‚gewandt‘. Die modale Funktion verdeutlicht auch das Interrogativadverb hversu ‚wie‘. Im Kontext sind noch weitere Werte für die STIMME erwähnt wie die Adjektive fagr ‚schön‘ und hár ‚laut‘, sowie die Adverbien bezt ‚am besten, sehr gut‘, fagrligast ‚am schönsten, sehr schön‘ und réttliga ‚richtig‘. Auch bei diesem Attributframe kommen wieder verschiedene Attribute zum Zuge wie HÖRBARKEIT (hátt ‚laut‘, skýrt ‚klar‘), ÄSTHETIK (fagr, fagrligast ‚schön‘), RHETORISCHE GEWANDTHEIT (snjallt ‚gewandt‘) und RICHTIGKEIT (rétt, réttliga ‚richtig‘, lat. ferialiter ‚dem Feiertag entsprechend‘). Was die RICHTIGKEIT wohl beinhaltet, beschreibt ein Beleg aus einer norwegischen Urkunde von 1345 im ONP (lesa): „Oc sua sem þat var lesett tysuor firir honum rette han þa klærken j sumum ordum þeim sem lass han æi sem scrifuatt var“ (Dipl. Norv. V, 135). ‚Und als ihm das zweimal vorgelesen worden war, korrigierte er den Kleriker in einigen Wörtern, die er nicht so las, wie es geschrieben war‘ (Übers. KM). Das Verb rétta ‚berichtigen, korrigieren‘ ist eine Derivation des Adjektivs réttr ‚recht, richtig‘ (vgl. Baetke 2002: 497, Blöndal 2008: 756), so dass der Beleg in einer morphologischen und semantischen Beziehung zum Wert rétt steht. Die Richtigkeit besteht folglich darin, dass die mündliche Wiedergabe durch den Leser mit der schriftlichen Vorlage übereinstimmt.
Werte für das Attribut ZUHÖRER ergeben sich in den meisten Fällen aus dem Kontext oft als Subjekt von heyra ‚hören‘, der Konversion von lesa, oder eines anderen verbum audiendi. Jedoch referieren das Dativobjekt, sowie die Präpositionalobjekte fyrir und yfir e-m auf das Attribut ZUHÖRER. Diese Ergänzungen schliessen allerdings nicht alle Zuhörer mit ein, sondern nur den intendierten Empfänger der Botschaft, welcher in der Laurentius saga biskups nicht nur der Präposition yfir vorbehalten ist. Das Dativobjekt ist nur einmal als Ergänzung gesichert, so dass seine Funktion nicht ohne Zweifel von den Präpositionalobjekten abgegrenzt werden kann. Die Werte für das Attribut ZUHÖRER sind wiederum diverse geistliche Ränge, die dem vorwiegend geistlichen Milieu der Saga geschuldet sind: ábóti ‚Abt‘, biskup ‚Bischof‘, brœðr ‚Brüder, Mönche‘, djákni ‚Diakon‘, erkibiskup ‚Erzbischof‘, kórsbrœðr ‚Chorherren‘ und prestr ‚Priester‘.
Zu den Zuhörern gehört auch immer der AUFTRAGGEBER, als Subjekt der Kausativkonstruktion láta lesa mit den Werten biskup, erkibiskup, prestr. Ein Sonderfall sind die Belege, in denen der Bote im Auftrag des Absenders einen Brief verliest, wo die von lesa abhängige Konstruktion eptir boð e-s ‚auf jemandes Befehl‘ auf den Absender verweist, der beim Verlesen nicht anwesend ist.
Die Werte des Attributs ZUHÖRER ergeben sich auch aus dem RAHMEN, auf den die thematische Rolle Ort verweist wie í messu ‚in der Messe‘, í sótt ‚bei Krankheit‘, oder við tíðir ‚beim Stundengebet‘ oder das Thema wie tíðir ‚Stundengebet; Messe, Gottesdienst‘, heilags anda tíðir bzw. tíðir af helgum anda ‚Stundengebet für den Heiligen Geist‘, Maríu tíðir bzw. tíðir várrar frú ‚marianische Antiphon‘, und sálutíðir ‚Fürbitte für die Verstorbenen, Seelenmesse‘. Da das Stundengebet auch Teil der individuellen Andacht ist, sind Zuhörer – zumindest natürliche – nicht immer gegeben. Der Wert des Attributs RAHMEN beschränkt folglich jene der Attribute ZUHÖRER, aber auch LESER, STIMME und TEXT, da im Rahmen der Messe bestimmte Personen, bestimmte Texte auf eine bestimmte Weise lesen. Die in der Laurentius saga biskups belegten Werte beschränken sich wieder auf religiöse Bereiche der Liturgie, Andacht und Erbauung.
Das Attribut ORT ist ebenfalls entscheidend. Auf ihn verweisen als Ergänzung ein Adverb inni ‚innen‘, sowie diverse Präpositionalobjekte wie at Hólum ‚in Hólar‘, á/í/yfir kór ‚auf/in/über dem Chor‘, á Mǫðruvǫllum ‚in Mǫðruvellir‘, á stað ‚am Ort, in der Kirche, auf dem Bischofssitz‘, fyrir borði ‚vor dem Tisch‘, í kirkju ‚in der Kirche‘. Die Werte sind bei diesem Attribut mehrheitlich sakrale Orte, welche andere Attribute teilweise beschränken, wie beispielsweise die Kirche, wo die Messe gelesen wird, was die Attribute RAHMEN, TEXT, LESER und STIMME einschränkt. Das Adverb inni ‚innen, d.h. in der Sakristei‘ steht im Gegensatz zu úti ‚aussen, d.h. in der Kirche‘. Bezogen auf tíðir bedeutet das, dass Bischof Laurentius alleine in der Sakristei das Stundengebet liest, während die übrigen Geistlichen es in der Kirche lesen. Der Wert borð ‚Tisch‘ schränkt jenen für den RAHMEN lectio ‚Lesung‘ zur Tischlesung ein. Der ORT schränkt auch den ZUHÖRER ein, wie etwa kór die Chorherren. Der im Kontext genannten ORT svefnstofa ‚Schlafzimmer‘ weist auf individuelles Lesen hin, schränkt also wieder die STIMME ein. Der ebenfalls im Kontext erwähnte Wert skóli ‚Schule‘ kann auch zum RAHMEN gehören und schränkt sowohl LESER auf Lehrer und Schüler, als auch den TEXT ein, der im Unterricht vorliegt. Diese Beispiele zeigen, dass die Constraints sehr von den jeweiligen Werten und ihren Konzepten abhängt. Um allgemeingültige Constraints festzulegen, müssten auch ihre Frames genauer untersucht werden.
Neben dem ORT ist auch die ZEIT in bestimmten Rahmen massgebend. Dieses Attribut hat wieder einen eigenen Frame mit diversen Attributen wie ZEITPUNKT mit den Werten eptir guðspjall ‚nach dem Evangelium‘, eptir tíðir ‚nach dem Gottesdienst‘, meðan óttusǫngshringingar ‚während des Matutingeläuts‘ und um morgin ‚am Morgen‘, DAUER mit dem Wert lengi ‚lange‘ und FREQUENZ mit den Werten dagliga ‚täglich‘, iðuligast ‚sehr häufig‘, jafnan ‚immer‘, hátíðardaga ‚an Feiertagen‘, hvern dag ‚jeden Tag‘, sjaldan ‚selten‘, stundum ‚manchmal‘ und tvá tíma ‚zweimal‘. Das Attribut ZEIT kommt nur in einem religiösen Rahmen vor, weil in diesem gewisse Texte zu gewissen Zeitpunkten, wiederholte Male und in einem gewissen Ausmass gelesen werden. Der RAHMEN schränkt einerseits die FREQUENZ und DAUER ein, weil in der Liturgie, Andacht, Busse und Meditation gewisse Texte über eine gewisse DAUER und in einer bestimmten FREQUENZ gelesen werden. Andererseits schränkt der ZEITPUNKT den RAHMEN ein, weil je nach Zeitpunkt des geistlichen Alltags in bestimmten RAHMEN gelesen wird, wie in der Messe oder dem Stundengebet.
Handlungen dienen einem gewissen Zweck, dieser kommt jedoch nie als Ergänzung vor. Anders verhält es sich mit den verba scribendi, die ein Attribut ZWECK haben. Im Kontext lässt sich nur der Wert betran/-un ‚Besserung‘ nachweisen. Das ONP (lesa) enthält jedoch einen Beleg aus der Tveggja postula saga Jóns ok Jakobs hins eldra mit einem Präpositionalobjekt til e-s, das auf dieses Attribut verweist: „bok sem þu hefir lesit til dyrðar Jacobi“ (SÁM1, fol. 74ra). ‚das Buch, das du zu Ehren des Jakobus gelesen hast‘ (Übers. KM). Der darin enthaltene Wert lautet dýrð ‚Ehre‘.
Der Frame von lesa in der Laurentius saga biskups enthält fast alle Attribute der Jóns saga helga (ohne die einmal belegten Attribute GEFAHR, INTENTION, QUELLE und ZIEL) und besteht fast aus denselben Attributen wie jener in Sturlunga saga, welche zusätzlich die Attribute SPRACHE und SCHRIFT als Ergänzungen hat, was aber keineswegs bedeutet, dass diese nicht auch zum Frame der Laurentius saga biskups gehören, da Lesen immer eine Schrift und eine Sprache voraussetzt. Bei der SCHRIFT muss man von einem Defaultwert latínu stafróf ‚lateinisches Alphabet‘ ausgehen und die Werte der SPRACHE sind Constraints unterworfen, weil durch den TEXT oder RAHMEN eine Sprache vorgegeben sein kann.
Die Laurentius saga biskups hat darüber hinaus das Attribut SCHRIFTTRÄGER als Ergänzung von lesa, welches auch in den anderen beiden Sagas zum Frame gehört. Es ist deshalb anhand dieses kleinen Korpus schwierig Aussagen über einen Wandel im Konzept zu geben, weil der Inhalt der Sagas heterogen ist.
2.5. Der Frame von lesa
Der Frame des Verbs lesa besteht aus einer Vielzahl von Attributen. Im Zentrum steht der Kernframe, welcher in allen drei Sagas aus dem LESER als Agens und dem TEXT als Thema besteht. Diese beiden Attribute enthalten meistens Werte eines Attributframes, was beim TEXT wegen der zahlreichen Metonymien besonders deutlich ist. Der TEXT-Frame besteht aus den Attributen TEXTSORTE, INHALT, SCHRIFTTRÄGER und TITEL, welche alle metonymisch zum TEXT verschoben werden können. In den Attributframe gehören wohl auch AUTOR und SPRACHE, auch wenn diese nicht als Thema vorkommen. Die SPRACHE ist nur in der Sturlunga saga im Präpositionalobjekt á e-t als Ergänzung belegt und wird mit dem Lexem tunga ‚Zunge, Sprache‘ bezeichnet. Die zahlreichen Komposita und Genitivattribute im Thema verbinden zwei oder mehrere dieser Attribute. Einen Sonderfall stellt das Attribut SCHRIFT dar, welches nur einmal in der Sturlunga saga als Thema belegt ist. Dies spricht dafür, dass dieses Attribut bei einer Leerstelle einen Defaultwert latínu stafróf ‚lateinisches Alphabet‘ bekommt. Dies bestätigt auch ein Blick ins ONP (lesa) zu Belegen der Kollokation lesa rúnar in der Egils saga Skalla-Grímssonar und Grettis saga (vgl. Einarsson 2001: 139, Jónsson 1936: 217). Rúnar muss nicht zwingend Runen bedeuten, sondern kann für irgendeine Schrift stehen (vgl. Baetke 2002: 507). Die Schriftträger kefli ‚Holzstäbchen‘ und tálkn ‚Walknochen‘ sind aber typisch für Runeninschriften. Der Wert rúnar ist ebenfalls eine Abweichung vom Defaultwert.
Das im Schreibframe häufige Attribut TEIL wird einmal in der Laurentius saga biskups als hlutr bezeichnet und hat einmal den Wert þriðjungr ‚Drittel‘ im Sinne von einem Teil eines Lesezyklus belegt. Es kommen also nur bestimmte Werte des Attributframes als Thema von lesa vor, andere sind nur im Kontext zu finden, oder sind in anderen Ergänzungen von lesa enthalten. Zwischen diesen Werten dieser Attribute bestehen gewisse Constraints, wie zwischen TEXT und SPRACHE, sowie zwischen TEXT und SCHRIFTTRÄGER.
Der SCHRIFTTRÄGER kommt in dieser Saga zudem konzeptuell unverschoben als Ergänzung im Präpositionalobjekt af e-u vor. Dieses Präpositionalobjekt verweist allerdings nicht nur auf den SCHRIFTTRÄGER, sondern auch auf den STOFF. Für beides gibt es im ONP (lesa) Belege: In der Óláfs saga Tryggvasonar en mesta ist mit af bók ‚aus dem Buch‘ eindeutig der SCHRIFTTRÄGER gemeint (vgl. Halldórsson 1958–2000: II, 349). Die Konstruktion heyra e-n lesa sǫgu af bók ‚jdn. aus einen Buch vorlesen hören‘ erinnert zudem stark an lego librum ab illo bei Hugo von St. Viktor. Der aural reader ist in der Regel das Agens von heyra und nicht lesa. Auf den Schriftträger verweist auch die Konstruktion lesa e-t á bók/í bók (vgl. Cederschiöld 1879: 2, Cook/Tveitane: 196, Glauser 2010: 328, Johnsen/Helgason 1941: II, 752), die an vergleichbare Konstruktionen bei den verba scribendi erinnert.
Auf den STOFF verweisen hingegen die Präpositionalobjekte af páfa Stephano ‚von Papst Stephanus‘ in den Exempla (vgl. Gering 1882: 44) und af várum lausnara ‚von unserem Erlöser‘ in Stjórn (vgl. Unger 1862: 39). Lesa verhält sich diesbezüglich in der Valenz wie die verba scribendi. Das äussert sich auch in der Konstruktion lesa e-t í bókum/ritningum af e-m/-u, welche die Attribute TEIL, TEXT/SCHRIFTTRÄGER und STOFF verbindet und in der Kláruss saga und Lazaruss saga belegt ist (vgl. Cederschiöld 1879: 2, Loth 1969: 171).
Auch der LESER hat einen Attributframe, in dem besonders häufig Werte für geistliche und akademische Ränge enthalten sind, welche zu Attributen wie STAND, die BILDUNG und der RANG passen und etwas über die Lesekompetenz oder -legitimation aussagen. Schüler erweisen sich im Lesen noch als ungeübt, an einen Priester werden gewisse Erwartungen an die Lesekompetenz gestellt. Einem Hilfspriester ist es noch verboten, in der Messe zu lesen, oder der Magister nimmt die Rolle des Lehrers im Unterricht ein. Es bestehen also diverse Werteconstraints zwischen LESER und TEXT, SPRACHE, STIMME oder RAHMEN. Der Leser muss den Text entziffern, verstehen, mündlich dem Rahmen entsprechend wiedergeben. In liturgischen Rahmen bestimmt der Weihegrad, ob die Person lesen darf. Diese Constraints bestimmen auch die unterschiedlichen Lesepraktiken, welche sich in verschiedenen Konzepten äussern. Dazu gehören ENTZIFFERN, INDIVIDUELL LESEN, VERLESEN, VORLESEN und auch (AUSWENDIG) REZITIEREN. Das Entziffern setzt voraus, dass der Leser den Text dekodieren kann, individuelles Lesen hängt vom Rahmen ab, ebenso Verlesen und Vorlesen, wie weiter unten noch zu sehen ist. Das Rezitieren aus dem Gedächtnis hängt vom Gedächtnis des Lesers ab, wie auch von der Lesepraxis gewisser Texte.
Es gibt keinen Beleg, bei dem mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass mit einer hörbaren Stimme gelesen wird. Dies bestätigt häufig das Verb heyra ‚hören‘, die Konversion von lesa, von dem sowohl der Leser selbst, als auch mindestens eine anwesende Person Subjekt sein kann. Als Bezeichnung für das Attribut STIMME gibt es das Lexem rǫdd. Die Werte zu diesem Attribut werden syntaktisch als Modaladverbien realisiert. Die ZUHÖRER ergeben sich fast immer aus dem Kontext. Zudem können die Präpositionalobjekte fyrir e-m und yfir e-m sowie das Dativobjekt auf INDENDIERTE ZUHÖRER referieren. Daraus ergibt sich implizit eine Intention des Lesens, nämlich dass eine Person das Gelesene hört. Dies wird auch in der Sturlunga saga im Konsekutivsatz svá at þér heyrið ‚so dass ihr hört‘ verdeutlicht. Das Attribut INTENTION kommt in der Jóns saga helga am deutlichsten zur Sprache im Präpositionalobjekt með heilagri græðgi ‚mit heiliger Gier‘, womit eine weitere Intention hinzukommt. Eng verbunden mit der INTENTION ist der ZWECK, der in den Präpositionalobjekten til betranar ‚zur Besserung‘ und til dýrðar ‚zu Ehren‘ ergänzt wird. INTENTION und ZWECK sagen auch aus, welchen Sprechakt der Leser an den Zuhörer richtet.
ZUHÖRER ist in der Regel auch der AUFTRAGGEBER als Causer. Eine Ausnahme stellt der Absender von Briefen dar, welcher die Lesung in Auftrag gibt, aber nicht selbst anwesend ist. Auf ihn wird einmal mit der Konstruktion eptir boði e-s ‚nach jds. Gebot‘ verwiesen. In einem religiösen Rahmen fehlt der AUFTRAGGEBER oft. Das Lesen liturgischer Texte steht aber auch in einem Auftrag, der im Rahmen der kirchlichen Organisation geschieht. Dass dieser auch von Individuen innerhalb der Organisation ausgeht, zeigt im ONP (lesa) folgender Beleg aus der Guðmundar saga biskups: „Skipar biskup Skalholtensis sira Guðmundi hæsta rödd yfir alla kennimenn, næst biskupinum, hvat lesa skal eða sýngja í hverri stöðu eða framgöngu“ (Vigfússon et al. 1878: 23). ‚Der Bischof von Skálholt gibt dem Priester Guðmundr nach dem Bischof die höchste Stimme über alle Geistlichen, was man an jeder Stelle und bei jedem Verlauf lesen oder singen soll‘ (Übers. KM).
Die thematische Rolle Ort verweist auf zwei weitere entscheidende Attribute, RAHMEN und ORT, weil zwischen ihren Werten und jenen der anderen Attribute, wie TEXT, STIMME, und ZUHÖRER wieder diverse Constraints bestehen. Die Stimme ist von der Anwesenheit von Zuhörern abhängig, aber auch vom Rahmen, weil liturgische Texte auch ohne Zuhörer rezitiert werden. Gleich verhält es sich mit dem Attribut ZEIT in einem religiösen Rahmen, dessen Werte jene der Attribute TEXT, STIMME oder RAHMEN beschränken können. So werden gewisse liturgische Texte zu gewissen Zeitpunkten und in wiederholtem Masse in einem gewissen Rahmen auf eine gewisse Weise rezitiert. Die Constraints sind alle abhängig von den jeweiligen Werten, so dass keine allgemeinen Regeln festgehalten werden können. Hierzu ist eine systematischere Analyse der Konzepte der jeweiligen Werte wie auch der Attributframes nötig.
Die Analyse der Belege in diesem Korpus hat viele mögliche Attribute im Kontext zu Tage gefördet und sie an anderer Stelle als Ergänzung des Verbs lesa bestätigt. Eine Ausnahme bildet das postulierte Attribut GEFAHR, welches nur im Kontext der Jóns saga helga belegt ist. Die Suche müsste in anderen Texten weitergeführt werden. Im Zusammenhang mit Sprechakten, wie jene Belege mit dem Präpositionalobjekt yfir e-m demonstriert haben, muss allerdings auch bedacht werden, dass die Gefahr nicht nur vom Lesen, sondern auch von der Aufnahme von Informationen unabhängig vom Medium herrühren könnte. Das Gedächtnis wird in einem Beleg der Jóns saga helga als Wert für das Attribut ZIEL genannt, kann aber nicht als selbständiges Attribut im Leseframe betrachtet werden, sondern gehört in den Attributframe des LESERS.
Die Konzepte von lesa sind zwar äusserst vielfältig, der oben zusammengestellte Frame hilft aber, mithilfe der Attribute LESER, TEXT, TEIL, SCHRIFT, SPRACHE, SCHRIFTTRÄGER, RAHMEN, STIMME, ZUHÖRER, AUFTRAGGER, ORT, ZEIT, ZIEL, ZWECK und INTENTION mit den entsprechenden Werten eine Struktur zu finden. Die meisten dieser Attribute bleiben Leerstellen, haben aber oft Anhaltspunkte im Kontext, oder die Werte sind Constraints unterworfen. Diese Struktur ermöglicht es die nötigen Werte zu sammeln, um das jeweilige Konzept zu finden.