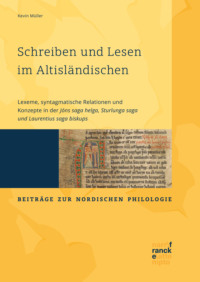Kitabı oku: «Schreiben und Lesen im Altisländischen», sayfa 28
3. lesa upp
Das Partikelverb lesa upp scheint eine Parallele zu lat. prælegere zu sein, weil es eindeutig ‚vorlesen‘ bedeutet, sich aber semantisch nicht klar von lesa abgrenzen lässt (vgl. Kap. III.1.). Baetke (2002: 376) übersetzt es mit ‚etw. vorlesen‘. Fritzner (1886–96: II, 485f.) betrachtet es als Synonym von lesa im Sinne der Bedeutung 3 „lesen“. Es fragt sich, wie sich die Konzepte von lesa und lesa upp unterscheiden. Laut ONP (lesa) ist lesa upp seit dem zweiten Viertel des 13. Jh. belegt. Etymologisch geht lesa upp – wie andere Lexeme der Schriftlichkeit z.B. bréf oder skrifa (vgl. Blöndal 2008: 78, 862) – wahrscheinlich auf mnd. uplesen „herlesen, recitare“ (vgl. Schiller/Lübben 1969: V, 117) zurück. Ein mhd. Vorbild ûflësen ‚auflesen, -heben‘ (vgl. Lexer 1872–78: II, 1696) kommt für einen schriftlichen Kontext hingegen aus semantischen Gründen nicht in Frage. Es gibt aber durchaus zahlreiche Belege, wo lesa upp ‚auflesen, -heben‘ bedeutet (vgl. ONP: lesa). Lesa upp ist innerhalb des hier untersuchten Korpus nur in der Sturlunga saga und der Laurentius saga biskups belegt.
3.1. Sturlunga saga
Die Sturlunga saga hat drei Belege (a. bis c.), die alle in den jüngeren Teilen der Kompilation vorkommen (vgl. Kap. I.3.3.): a) in der Svínfellinga saga (Ende des 13. Jahrhunderts), b) in der Þorgils saga skarða (1275–80) und c) in der Þórðar saga kakala (Mitte des 13. Jahrhunderts). Dies stimmt also mit dem Alter der Belege im ONP (lesa) überein.
Der erste Beleg ist in der Króksfjarðarbók überliefert: a) „Var þa fundr stefndr fiolmennr at Hesta-þings-hamri; voro þar upp lesin konungsbref, ok jattu allir fusliga at […]“ (StS2 133). ‚Es wurde eine Versammlung mit vielen Leuten in Hestaþingshamarr einberufen. Da wurden Königsbriefe verlesen und es stimmten alle bereitwillig zu, dass […]‘ (Übers. KM). Lesa upp ist passiv mit dem Kompositum konungsbréf (Pl.) im Subjekt als TEXT, dessen Modifikator konungr auf den ABSENDER verweist. Das Proadverb þar referiert entweder auf den ORT Hestaþingshamarr oder auf den RAHMEN mit dem Wert fundr ‚Versammlung‘. Das Adjektiv fjǫlmennr ‚mit vielen Leuten‘ deutet auf viele ZUHÖRER hin, auf die der Quantifikator allir ‚alle‘ nochmals verweist.
Der zweite Beleg ist nur in den Abschriften der Reykjarfjarðarbók erhalten: b) „Í þessu kom Þórarinn kaggi sendr af Heinreki biskupi, las hann þar upp bréf. Stóð þat á bréfi því, at […]“ (StS2 272) ‚In diesem [Augenblick] kam der Priester Þórarinn kaggi, vom Bischof Heinrekr gesandt. Er las da einen Brief vor. Auf diesem Brief stand, dass […]‘ (Übers. KM). Lesa upp ist aktiv, mit dem Boten Þórarinn kaggi als LESER im Subjekt. Das Akkusativobjekt enthält bréf als Wert für den TEXT. Das Proadverb þar ‚da‘ verweist wie bei obigem Beleg a) auf das Substantiv fundr als Wert für den RAHMEN, welches in der Saga ein paar Sätze weiter vorher ebenfalls zusammen mit dem Adjektiv fjǫlmennr belegt ist: „Riðu þeir þá til fundar, var þá komit fjǫlment“ (StS2 272). ‚Sie ritten dann zur Versammlung, und es kamen da viele Leute‘. Dieser Rahmen impliziert somit eine grosse Anzahl ZUHÖRER.
Der dritte Beleg ist wieder in der Króksfjarðarbók überliefert: c) „Ok aa stefnunni lét Þorðr lesa upp rollu langa, er hann hafði laatið rita vm skipti þeira Hauk-dæla ok Sturlunga“ (StS2 100). ‚Und an der Versammlung liess Þórðr [kakali] eine lange Rolle verlesen, die er über die Händel der Haukdœlir und Sturlungar hatte schreiben lassen‘ (Übers. KM). Lesa upp ist in der Kausativkonstruktion mit láta + Inf. enthalten und hat Þórðr kakali als AUFTRAGGEBER im Subjekt. Das Agens ist eine Leerstelle und das Akkusativobjekt enthält das Lexem rolla ‚Schriftrolle‘ als Wert für den SCHRIFTTRÄGER, welcher metonymisch zum TEXT verschoben ist. Der INHALT skipti ‚Händel‘ ist im Kontext erwähnt. Zu lesa upp gehört noch das Präpositionalobjekt á stefnunni mit dem Substantiv stefna ‚Versammlung‘ als Wert für das Attribut RAHMEN, der wiederum ZUHÖRER impliziert, zu denen neben Þórðr kakali u.a. auch der norwegische König Hákon und Gizurr Þorvaldsson gehören (vgl. StS2 100). Da der RAHMEN hier explizit in einem Präpositionalobjekt vorkommt, ist anzunehmen, dass bei den ersten beiden Belegen diese Position, welche durch das Proadverb þar besetzt ist, für ebendiesen steht.
Das Verb lesa upp besteht wie lesa aus einem Kernframe mit den Attributen LESER als Agens und TEXT als Thema. Es ist nur der Priester Þórarinn kaggi als LESER erwähnt, so dass prestr ‚Priester‘ den einzigen Wert zu diesem Attribut darstellt. Die Werte für den TEXT sind die metonymisch verschobenen SCHRIFTTRÄGER bréf ‚Brief‘ und rolla ‚Rolle‘. In allen drei Belegen kommt die thematische Rolle ORT vor, zweimal als Proadverb þar und einmal als Präpositionalobjekt á stefnunni ‚an der Versammlung‘, so dass das Proadverb wahrscheinlich auf das im Kontext erwähnte stefna und das synonyme fundr verweist. Die Versammlung impliziert eine Gruppe von Zuhörern, so dass lesa upp eindeutig lautes Lesen ist. Die einmal belegte Kausativkonstruktion erwähnt mit dem Sturlungen Þórðr kakali auch einen AUFTRAGGEBER, so dass bei diesem Attribut ein Wert sturlungr angesetzt werden kann. Der Auftrag geht somit von einer sozial höher gestellten Person aus.
3.2. Laurentius saga biskups
In der Laurentius saga biskups ist lesa upp bréf in den beiden Redaktionen unterschiedlich verteilt belegt. Vier Belege kommen in beiden Redaktionen vor, neun nur in A und fünf nur in B. In der B-Redaktion stehen anstelle von lesa upp öfters andere Verben. Die grössere Anzahl Belege in dieser Saga erfordert eine feinere Aufteilung. Als erstes werden jene mit dem am häufigsten vorkommenden Thema bréf analysiert. Diese Reihe lässt sich noch einmal in Belege ohne Präpositionalobjekte (Kap. 3.2.1.), in Kausativkonstruktionen (Kap. 3.2.2.) und mit Präpositionalobjekten (Kap. 3.2.3.) unterteilen. Zum Schluss folgt noch eine Gruppe mit dem Thema hlutr (Kap. 3.2.4.).
3.2.1. lesa upp bréf ‚einen Brief verlesen‘
In diese Gruppe gehören vier Belege. Der erste Beleg hat lesa nur in der A-Redaktion die Partikel upp, in der B-Redaktion fehlt sie hingegen (vgl. Kap. III.2.4.1.3.a.). Die Situation ist aber die gleiche: Bischof Jǫrundr und Bruder Bjǫrn schicken den Priester Snjólfr mit einem Brief nach Munkaþverá, den er dort Bischof Laurentius und Herrn Þórðr vorliest: a) „las Sniolfur vpp bref Biarnar *visitatoris ad hann gaf orlof til ad […]“ (LSB 40) ‚Snjólfr verlas den Brief vom visitator Bjǫrn, dass er die Erlaubnis gab, zu […]‘ (Übers. KM). Subjekt ist Snjólfr, so dass das Attribut LESER den Wert prestr bekommt. Das Akkusativobjekt enthält das Substantiv bréf, einen Wert für das Attribut Text. Die Werte biskup und herra des Attribut ZUHÖRER lassen sich aus dem Kontext inferieren (vgl. LSB 40).
Der zweite Beleg kommt ebenfalls nur in der A-Redaktion vor, während in der B-Redaktion stattdessen byrja upp ‚beginnen‘ steht. Dem Bischof Laurentius wird in der Sakristei (skrúðhús) das Ornat abgelegt, als die Diakone Þórðr und Gregorius eintreten und Laurentius einen Vorladungsbrief (stefnubréf) des Bischofs Jón vorlesen (lesa) wollen, was Laurentius ihnen jedoch verbietet. Þórðr ignoriert aber das Verbot: b) „og so sem Þordur ætladi vpp at lesa brefit stock byskup vpp og burt af skrudhusinu. og aller klerkar med honum“ (LSB 112). ‚Und als Þórðr vorhatte, den Brief vorzulesen, sprang der Bischof auf und verliess die Sakristei und alle Geistlichen mit ihm‘ (Übers. KM). Subjekt ist der Diakon Þórðr und Akkusativobjekt bréf als Ellipse von stefnubréf. Die ZUHÖRER Bischof Laurentius, die Geistlichen, welche ihm das Ornat ablegen, und Diakon Gregorius sind aus der Situation bekannt. Bei Þórðs erstem Versuch, den Brief zu verlesen, wird das Verb lesa verwendet, so dass lesa upp eine Rekurrenz von lesa darstellt. Dies deutet auf eine mögliche Synonymie hin, da die Situation beider Verben dieselbe ist.
Der dritte Beleg ist in beiden Redaktionen bis auf die Graphie gleich. Bischof Jǫrundr stellt da folgende Bedingung, welche nach der A-Redaktion zitiert ist: c) „en þu sker j sundur þetta bref. sem þu hefur nu vpp lesit oss til saka“ (LSB 46). ‚Aber du zerschneidest diesen Brief, den du Uns zur Anklage vorgelesen hast‘ (Übers. KM). Das Personalpronomen þú ‚du‘ bezieht sich wieder auf den LESER Laurentius. Die Relativpartikel er im Akkusativobjekt verweist auf den Brief (bréf). Das Verb skera í sundr ‚zerschneiden‘ betont seine Materialität. Das Personalpronomen oss ‚Uns‘ kann entweder als Dativobjekt von lesa upp abhängen und stünde somit für den ZUHÖRER, oder es gehört zum Präpositionalobjekt til saka ‚zur Anklage‘, welches einen Wert für den ZWECK nennt. Die Anklage ist ein Sprechakt, die gegen Bischof Jǫrundr gerichtet ist. Er ist somit sowohl Inhalt dieses Sprechaktes als auch intendierter Zuhörer der Lesung.
Der vierte Beleg ist in beiden Redaktionen ähnlich überliefert. Das Zitat richtet sich nach der B-Redaktion, weil dort anstelle der AcI-Konstruktion in der A-Redaktion ein at-Satz steht, der leichter zu analysieren ist. Bruder Bjǫrn berichtet den Chorherren in Trondheim Folgendes: d) „[…] at hann hefdi morg þau bref erkibiskups upp lesit aa Jslandi“ (LSB 47). ‚[…] dass er viele Briefe des Erzbischofs in Island verlesen habe‘ (Übers. KM). Das Personalpronomen hann ‚er‘ im Subjekt bezieht sich auf Priester Laurentius. Das Akkusativobjekt bréf ist ein Wert für das Attribut TEXT. Dritte Ergänzung ist das Präpositionalobjekt á Íslandi ‚in Island‘, was auf das Attribut ORT referiert. Der Wert Ísland steht im Kontrast zum Auftenthaltsort der Chorherren im norwegischen Trondheim. Da es sich um mehrere Brieflesungen handelt, sind auch die Situationen unterschiedlich.
3.2.2. láta lesa upp bréf ‚einen Brief verlesen lassen‘
Die schon in der Sturlunga saga bezeugte Kausativkonstruktion láta lesa upp hat in der Laurentius saga biskups zwei Belege. Der erste Beleg unterscheidet sich in der A- und B-Redaktion im Akkusativobjekt, das in der A-Redaktion das Substantiv boðskapr ‚Geheiss, Gebot‘ als Wert für die BOTSCHAFT enthält, in der B-Redaktion bréf. Die Situation ist aber in beiden Redaktionen dieselbe: Bischof Jǫrundr ruft Priester Laurentius und andere Geistliche (kennimenn) in die Sakristei (skrúðhús) und lässt den Brief bzw. das Geheiss des Erzbischofskandidaten und der Chorherren verlesen. Das folgende Zitat stammt aus der B-Redaktion: a) „let hann þa lesa upp bref ercibiskups efniss ok kors br(ædra)“ (LSB 57). ‚Er liess dann den Brief des Erzbischofskandidaten und der Chorherren vorlesen‘ (Übers. KM). Das Personalpronomen hann im Subjekt verweist auf Bischof Jǫrundr. Das Attribut AUFTRAGGEBER bekommt somit den Wert biskup. Das Agens ist eine Leerstelle. Das Akkusativobjekt bréf (bzw. boðskap in der A-Redaktion) enthält Werte für das Attribut TEXT. Die Werte für das Attribut ZUHÖRER, Priester Laurentius und die anderen Geistlichen lassen sich aus dem Kontext inferieren (vgl. LSB 57).
Der zweite Beleg ist nur in der A-Redaktion überliefert, weil in der B-Redaktion die Partikel upp fehlt (vgl. Kap. III.2.4.1.1.b.). Hier lässt der Priester Koðrán Briefe des Erzbischofs einer Gruppe von Gelehrten (lærðir menn) vorlesen. In folgendem Satz kommt lesa upp gleich zweimal vor: 1. als Partizip Präteritum und 2. in einer Kausativkonstruktion mit láta + Inf.: b) „og epter vpp lesinn brefin. þau sem sira Kodran [l]et vpp lesa. skaut hann aa lanngri tolv“ (LSB 62). ‚Und nach dem Vorlesen der Briefe, welche der Priester Koðrán vorlesen liess, fügte er eine lange Rede hinzu‘ (Übers. KM). Subjekt ist der Priester Koðrán als AUFTRAGGEBER. Das Agens ist wieder eine Leerstelle und das Akkusativobjekt enthält das Substantiv bréf als Wert für den TEXT. Die Gelehrten (lærðir menn) als ZUHÖRER ergeben sich wieder aus dem Kontext (vgl. LSB 62).
Somit lassen sich bei diesen beiden Belegen folgende Attribute und Werte zusammenfassen: AUFTRAGGEBER als Causer mit biskup und prestr, sowie TEXT als Thema mit bréf und boðskapr. Für den Leser als Agens lassen sich keine Werte nachweisen. Aus dem Kontext lassen sich die Werte kennimenn und lærðir menn für das Attribut ZUHÖRER und skrúðhús für das Attribut ORT inferieren.
3.2.3. lesa bréf upp fyrir/yfir e-m ‚einen Brief vor/über jdm. verlesen‘
Wie lesa hat auch lesa upp die Präpositionalobjekte fyrir und yfir e-m als Ergänzungen, welche in der Sturlunga saga nicht bezeugt sind. Die Laurentius saga biskups hat dafür drei Belege. Der erste Beleg enthält nur in der A-Redaktion lesa upp, an dessen Stelle lesa in der B-Redaktion steht (vgl. Kap. III.2.4.1.4.g.): a) „Sidann var lesid vpp a kor j predikacioni og so fyrer brædrum aa Modrv vollum“ (LSB 130). ‚Dann wurde [der Brief] im Chor in der Predigt und dann vor den Brüdern in Mǫðruvellir vorgelesen‘ (Übers. KM). Das Subjekt fehlt zwar, aber das Partizip Präteritum lesit kongruiert im Genus und Numerus mit dem zuvor genannten Substantiv bréf als Wert für den TEXT. Daneben gibt es vier Präpositionalobjekte: 1. á kór ‚im Chor‘ für den ORT, 2. í praedicationi ‚in der Predigt‘ für den RAHMEN, 3. fyrir brœðrum ‚vor den Brüdern‘ als ZUHÖRER und 4. á Mǫðruvǫllum als zweiten ORT. Die beiden Werte für den ORT sind nicht gleich zu behandeln. Ersterer bezeichnet den Ort in der Kirche von Hólar und letzterer einen zweiten Ort im Unterschied zu Hólar. Wo genau und in welchem Rahmen der Brief in Mǫðruvellir verlesen worden ist und vor welchen Zuhörern in Hólar, bleibt offen.
Der zweite Beleg ist nur in der B-Redaktion erhalten, weil die A-Redaktion an der Stelle eine Lakune aufweist. Bischof Jǫrundr befiehlt dem Priester Laurentius, einen Exkommunikationsbrief (bannsetningarbréf) nach Mǫðruvellir zu bringen, von dem es heisst: b) „[…] huert hann skilldi upp lesa fyrir Sigurdi. ef hann uilldi eigi af ganga stadnum“ (LSB 12). ‚[…], welchen er vor Sigurðr verlesen sollte, wenn er den Ort nicht verlassen wollte‘ (Übers. KM). Das Personalpronomen hann ‚er‘ im Subjekt verweist auf Laurentius als LESER, das Interrogativpronomen hvert ‚welches (n. Sg. Nom./Akk.)‘ im Akkusativobjekt kongruiert mit dem Kompositum bannsetningarbréf (n. Sg.), dessen Modifikator bannsetning ‚Exkommunikation‘ auf die BOTSCHAFT referiert. Das Präpositionalobjekt fyrir Sigurði ‚vor Sigurðr‘ verweist auf den Thingvorsteher (lǫgmaðr) Sigurðr Guðmundsson, der nicht nur ZUHÖRER, sondern vor allem Inhalt des Sprechaktes ist, weil er exkommuniziert werden sollte. Im Folgenden der Erzählung rekurriert lesa upp ohne Partikel. Die Situation ist dort detaillierter beschrieben, weil diverse zusätzliche Werte gegeben werden: messa für den RAHMEN, kirkja für den ORT, hátt und skýrt für die STIMME, sowie Sigurðr und die anderen Leute in der Kirche für die ZUHÖRER (vgl. Kap. III.2.4.1.3.h.). Die beiden Werte für die STIMME sind Adverbien und haben syntaktisch dieselbe Funktion wie das Adverb upp, so dass dieses möglicherweise einen Wert für die STIMME darstellt.
Der dritte Beleg unterscheidet sich in den beiden Redaktionen nur unwesentlich. Der Priester Laurentius muss im Auftrag des Erzbischofs drei Chorherren exkommunizieren und bekommt in der A-Redaktion folgende Anweisung: c) „þetta bref skalltu vpp lesa. yfer kor i kirkiunne“ (LSB 19). ‚Diesen Brief sollst du über dem Chor in der Kirche verlesen‘ (Übers. KM). Das enklitische Personalpronomen -tu ‚du‘ im Subjekt bezieht sich auf Laurentius als LESER. Im Akkusativ ist das Lexem bréf als Wert für den TEXT enthalten. Das Präpositionalobjekt yfir kór ‚über dem Chor‘ nennt zwar den Chor als ORT, der aber metonymisch für die Chorherren (kórsbrœðr) steht, welche sowohl ZUHÖRER als auch Inhalt des Sprechakts sind. Ein zweiter Wert für den Ort ist im Präpositionalobjekt í kirkjunni ‚in der Kirche‘ enthalten. Bei diesem Beleg rekurriert lesa upp im Folgenden wieder ohne Partikel, als erzählt wird, wie Laurentius den Auftrag des Erzbischofs ausführt (vgl. LSB 20). Dabei werden wieder zwei Werte hátt ‚laut‘ und snjallt ‚gewandt‘ für die STIMME gegeben und das konverse Verb heyra ‚hören‘ verdeutlicht die Chorherren als ZUHÖRER im Subjekt (vgl. Kap. III.2.4.1.3.g.). Die Adverbien hátt und snjallt haben wieder dieselbe Funktion wie das Adverb upp.
In dieser Reihe ergeben sich folgende Attribute und Werte: LESER als Agens mit prestr, TEXT als Thema mit bréf, der ZUHÖRER als Präpositionalobjekt fyrir/yfir e-m mit brœðr, kórsbrœðr und lǫgmaðr, ORT als Lokaladverbiale mit kirkja, kór und Mǫðruvellir, sowie RAHMEN als Präpositionalobjekt í e-u mit praedicatio. Die Rekurrenzen ohne Partikel bestätigen mit ihren Werten für die STIMME, dass lesa upp für lautes Lesen steht.
3.2.4. lesa upp hluti ‚Teile verlesen‘
Weitere drei Belege haben das Thema hlutr ‚Teil‘, für das die Attribute TEXT und TEIL in Frage kommen. Der erste Beleg unterscheidet sich in den beiden Redaktionen. Die Situation ist aber die gleiche: Der Priester Laurentius hält in einem Brief die Nachlässigkeit und das ungesetzliche Vorgehen Bischof Jǫrunds fest, das er ihm darauf vorliest. Als erstes wird die Stelle in der A-Redaktion analysiert: a) „las Laur(encius) þa vpp. þa alla hlute. sem hann hafdi saman lesith. af uan rækt. og o logligvm fram ferdum. byskups“ (LSB 46). ‚Laurentius las alle Teile vor, die er von der Nachlässigkeit und den ungesetzlichen Vorgehensweisen des Bischofs gesammelt hat‘ (Übers. KM). Subjekt ist der Priester Laurentius als LESER. Das Akkusativobjekt enthält das Substantiv hlutr als Bezeichnung für das Attribut TEIL. Der INHALT dieser TEILE wird im angehängten Relativsatz paraphrasiert. Das im Relativsatz erwähnte Verb lesa saman bedeutet hier ‚zusammenlesen, i.S.v. sammeln‘ – dieser Bedeutung ordnet es Fritzner (1886–96: II, 485f.) ebenfalls zu, was Lesen beim Sammeln schriftlicher Argumente aber nicht ausschliesst. Im Kontext wird Bischof Jǫrundr als ZUHÖRER genannt und das Lexem bréf als Wert für den SCHRIFTTRÄGER und die TEXTSORTE.
Die B-Redaktion schliesst denselben Zuhörer im Präpositionalobjekt fyrir honum ‚vor ihm‘ mitein: b) „las L(aurenci)us þa upp fyrir honum alla þa hluti er hann hafdi saman sett. af vandrækt ok o logligvm fram ferdum biskups“ (LSB 46) ‚Laurentius verlas vor ihm dann alle Teile, die er verfasst hatte, von der Nachlässigkeit und den ungesetzlichen Vorgehensweisen des Bischofs‘ (Übers. KM). Die Werte der jeweiligen Attribute sind sonst mit jenen in der A-Redaktion identisch.
In der A-Redaktion rekurriert das Verb lesa upp noch einmal. In der B-Redaktion steht an dessen Stelle kunngera ‚kundtun‘. Laurentius sagt: c) „vil eg og ecki leynast fyrer ydur herra byskup ad þessa hluti alla. mun eg vpp lesa fyrer erchibyskupi“ (LSB 46). ‚Ich will vor Euch, Herr Bischof, nicht verheimlichen, dass ich all diese Teile dem Erzbischof vorlesen werde‘ (Übers. KM). Der LESER und der TEXT sind hier identisch wie oben, aber im Präpositionalobjekt fyrir erkibiskupi ‚vor dem Erzbischof‘ kommt ein neuer Wert für das Attribut ZUHÖRER hinzu.
Bei dieser Gruppe tritt also ein zusätzliches Attribut TEIL als Thema mit der Bezeichnung hlutr auf. Ein Wert bréf für das Attribut TEXT lässt sich nur im Kontext nachweisen. Das Attribut LESER als Agens hat wieder den Wert prestr und das Attribut ZUHÖRER als Präpositionalobjekt fyrir e-m die Werte biskup und erkibiskup.
3.3. Der Frame von lesa upp
Die grössere Zahl der Belege in der Laurentius saga biskups gibt ein vielfältigeres Bild, das aber weitgehend mit jenem der Sturlunga saga übereinstimmt. Der Kernframe besteht wieder aus den Attributen LESER als Agens und TEXT als Thema. Beim Attribut LESER kommt zum Wert prestr ‚Priester‘, noch djákni ‚Diakon‘ hinzu. Beide stehen für niedere geistliche Ränge. Der Wert bréf ‚Brief‘ für das Attribut TEXT ist in der Laurentius saga biskups ebenfalls häufig belegt. Rolla ist hingegen nicht bezeugt. Stattdessen kommen noch die Werte bannsetningarbréf ‚Exkommunikationsbrief‘ und boðskapr ‚Geheiss, Befehl‘ hinzu. Im ONP (lesa) ist bréf unter lesa upp auch das häufigste Thema. Nur vereinzelt lassen sich noch andere Werte finden wie bók ‚Buch‘ in der Niðrstigningar saga (vgl. Jónsson 1927: 9) oder lǫg ‚Gesetz‘ in der Ólafs saga helga (vgl. Johnsen/Helgason 1941: I, 258).
Das als Thema vorkommende Substantiv hlutr ‚Teil‘ ist die Bezeichnung für das Attribut TEIL. Dies stellt wohl eine Abweichung vom Stereotyp dar, dass der gesamte Brieftext verlesen wurde.
Das Attribut RAHMEN hat in der Laurentius saga biskups nur einen Wert praedicatio ‚Predigt‘ in einem Präpositionalobjekt í e-u. Aus dem Kontext lässt sich noch der Wert messa ‚Messe‘ inferieren. Diese religiösen Rahmen stehen im Kontrast zu den Werten fundr und stefna ‚Versammlung‘ in der Sturlunga saga, ist aber charakteristisch für die unterschiedlichen Milieus in den beiden Texten. Trotz der unterschiedlichen Werte gehört lesa upp, weil Briefe verlesen werden, in beiden Texten in einen weiteren juristischen Rahmen.
Viel häufiger ist in der Laurentius saga biskups hingegen das Attribut ORT in den Präpositionalobjeken á/yfir kór ‚im/über dem Chor‘, á Mǫðruvǫllum ‚in Mǫðruvellir‘, í kirkju ‚in der Kirche‘. Im Kontext kommt auch zweimal die Sakristei (skrúðhús) als Ort vor. Es handelt sich um sakrale Räume, deren Störung Bischof Laurentius beispielsweise verbietet. Diese Werte hängen eng mit jenen zum RAHMEN zusammen, weil Messe und Predigt in der Kirche stattfinden.
Wie in der Sturlunga saga können Werte für das Attribut ZUHÖRER im aus dem Kontext inferiert werden, wozu Geistliche (kennimenn) und Gelehrte (lærðir menn) gehören. Die Laurentius saga biskups hat zudem das Präpositionalobjekt fyrir/yfir e-m für den INTENDIERTEN ZUHÖRER oder ADRESSAT des Sprechaktes mit den Werten brœðr ‚Brüder, Mönche‘, kór[sbrœðr] ‚Chorherren‘, lǫgmaðr ‚Thingvorsteher‘ und biskup ‚Bischof‘. Ob es sich um Adressaten eines Sprechaktes wie bei der Exkommunikation oder intendierte Zuhörer als Empfänger einer Botschaft handelt, ist vom Kontext abhängig.
Ein Zuhörer ist auch immer der AUFTRAGGEBER, der wie in der Sturlunga saga als Subjekt in Kausativkonstruktionen mit láta + Inf. in Erscheinung tritt. Zum Wert sturlungr kommen in der Laurentius saga noch biskup und prestr hinzu, d.h. es handelt sich nicht ausschliesslich um ranghohe Personen. In die Reihe ranghoher Personen als Auftraggeber passt noch der Wert konungr ‚König‘ aus der Ólafs saga helga (vgl. Johnsen/Helgason 1941: I, 258, ONP lesa).
Die Konstruktion lesa upp bréf e-m til saka enthält ein Dativobjekt, welches entweder als intendierter Zuhörer vom lesa upp abhängt oder als Teil der Anklage vom Präpositionalobjekt til saka ‚zur Anklage‘, das auf das Attribut ZWECK verweist. In beiden Fällen verweist das Dativobjekt auf den intendierten Zuhörer und Teil des Sprechaktes mit dem Wert biskup, so dass es dieselbe Funktion wie die Präpositionalobjekte fyrir e-m und yfir e-m erfüllt. Der Wert sǫk zum Attribut ZWECK passt wieder in den juristischen Rahmen.
Das Attribut STIMME ist in allen Belegen zu lesa upp eine Leerstelle. Die verschiedenen intendierten und sonst anwesenden Zuhörer bestätigen, dass mit hörbarer Stimme gelesen wird. Die Rekurrenz von lesa mit Adverbien als Werten zum Attribut STIMME deutet darauf hin, dass das Adverb upp diese syntaktische Position mit einem bestimmten Defaultwert hörbar füllt. Dem widerspricht aber ein Beleg im ONP (lesa) aus einer isländischen Urkunde von 1341 (vgl. Karlsson 1963: 16), in dem von lesa upp das Adverb opinberliga ‚öffentlich‘ abhängt, das auch als Ergänzung bei lesa belegt ist und dort einen Wert für das Attribut STIMME bildet (vgl. Kap. III.1., 2.3.5.e., 2.4.6.a. und b.). Dies ist aber genau der erwartete Defaultwert, der bei diesem Beleg betont wird.
Ein weiterer Beleg im ONP (lesa) aus einer norwegischen Urkunde von 1299 liefert noch zwei weitere Attribute, welche im vorliegenden Korpus nicht bezeugt sind:
hoeyrdo uer oc at síra þorkell .i. kinzaruik upp las firir folke .i. maríu kirkiu bæde a. latinu oc noroeno .a. sunnu daghen nesta firir maríu mæ(sso) oefre þau bref sem domaranner hafdu sentt honom oc hans cuppanom (Hødnebø 1960: 104).
Wir hörten auch, dass Priester Þorkell in Kinsarvik vor dem Volk in der Marienkirche die Briefe auf Latein und in nordischer Sprache am Sonntag vor Mariä Geburt verlas, die die Richter ihm und seinen Kameraden geschickt hatten (Übers. KM).
Die Werte prestr für den LESER, bréf für den TEXT und kirkja für den ORT sind nichts Neues. Das gilt auch für die syntaktische Funktion als Subjekt, Akkusativobjekt und Lokaladverbiale. Das Präpositionalobjekt fyrir folki ‚vor dem Volk‘ enthält hingegen einen neuen Wert für das Attribut ZUHÖRER. Das Präpositionalobjekt á latínu ok norrœnu ‚auf Latein und in nordischer Sprache‘ konnte in diesem Korpus nur bei lesa und einigen verba scribendi in ähnlicher Form, aber nicht bei lesa upp nachgewiesen werden. Es liefert zwei bekannte Werte für das Attribut SPRACHE, welches im vorliegenden Korpus aber fehlt. Der Brief enthält eine Exkommunikation (vgl. Hødnebø 1960: 104), so dass dieser Beleg mit jenem aus der Sturlunga saga zu vergleichen ist, wo der Bischof die Exkommunikation auf Nordisch verliest (vgl. Kap. III.2.3.3.a.). Das Nennen der Sprachen deutet auf eine Abweichung vom Defaultwert hin, der bei der Exkommunikation latína lauten müsste.
Ein weiteres Präpositionalobjekt á sunnudaginn næsta fyrir Maríu messu øfri ‚am Sonntag vor Mariä Geburt‘ liefert einen Wert für das Attribut ZEIT, genauer den ZEITPUNKT. Beide Attribute sind typisch für den religiösen Rahmen, aber auch für Urkunden. Im letzteren Fall handelt es nicht um ein Ritual, das an einen Zeitpunkt in einem Zyklus gebunden ist, sondern um einen einmaligen Sprechakt, der an einen bestimmten Adressaten, Zeitpunkt und Ort gebunden ist. Das Attribut ZEIT beschränkt sich folglich nicht auf einen religiösen Rahmen, erfüllt aber jeweils eine andere Funktion, weil Constraints zwischen den Werten der Attribute ZEIT, TEXT und RAHMEN bestehen.
Der Frame von lesa upp unterscheidet sich insgesamt nur geringfügig von lesa. Die Werte des Attributs RAHMEN gehören in einen juristischen, öffentlichen Kontext. Dem passen sich auch die Werte des Attributs STIMME an, das bis auf einen Beleg mit dem Wert opinberliga eine Leerstelle bleibt. Die Attribute SCHRIFT und SCHRIFTTRÄGER lassen sich als Ergänzung nicht nachweisen, gehören aber unweigerlich zum Frame.