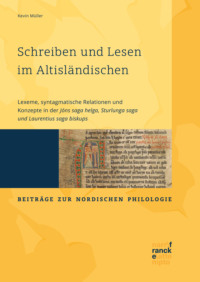Kitabı oku: «Schreiben und Lesen im Altisländischen», sayfa 29
4. lesa yfir
Das Partikelverb lesa yfir hat laut Spurkland (1994: 13) im Kontrast zu lesa eine engere Bedeutung ‚individuell lesen‘. Bei Baetke (2002: 376) bedeutet die Konstruktion lesa yfir e-t ‚etw. durchlesen, studieren‘. Fritzner (1886–96: II, 486) übersetzt es mit „gjennemlæse“ ‚durchlesen‘ zwar ähnlich, die Konstruktion lautet aber lesa e-t yfir, d.h. yfir ‚über‘ ist eindeutig ein Adverb, während die Wortart von yfir bei Baetke nicht eindeutig ist. Es verhält sich tatsächlich so, dass nicht bei allen Belegen sicher beurteilt werden kann, ob yfir Präposition oder Adverb ist. Lesa yfir e-t bzw. e-t yfir ist aber keinesfalls mit lesa yfir e-m zu verwechseln, bei welchem yfir eindeutig eine Präposition ist, welche den Dativ regiert.
Im vorliegenden Korpus ist lesa yfir nur in den jüngeren Texten, der L-Redaktion der Jóns saga helga und der Laurentius saga biskups belegt. Die ältesten Belege im ONP (lesa) stammen von ca. 1280, sind also deutlich jünger als beispielsweise das seit dem zweiten Viertel des 13. Jh. belegten lesa upp. Wie bei lesa upp handelt es sich um eine Entlehnung aus dem Mittelniederdeutschen. Dort ist ein Verb overlesen ‚über-, durchlesen‘ bezeugt (vgl. Schiller/Lübben 1969: IV, 267). Im Mittelhochdeutschen gibt es ausserdem ein Verb überlësen ‚überlesen, ganz durchlesen; lesend, betend aussprechen; überschauen, -zählen‘ (vgl. Lexer 1872–78: II, 1639f.). In einer deutschen Übersetzung des Fliessenden Lichtes der Gottheit der Mechthild von Magdeburg steht mhd. „solt du … úberlesen“ für lat. „perlegeris“ (vgl. Thali 2010: 425). Lat. perlegere bedeutet ‚durchmustern, genau betrachten; ganz herlesen, vorlesen‘ (vgl. Georges 1998: II, 1609) und fehlt bei Green (2007), Parkes (1999) und Saenger (1999). Inwiefern aisl. lesa yfir e-t auch semantisch vom mittelhochdeutschen und evtl. lateinischen Verb, deren Bedeutungsspektrum relativ weit ist, beeinflusst wurde, wird sich im Folgenden zeigen.
In der L-Redaktion der Jóns saga helga ist lesa yfir zweimal belegt. Der eine Beleg gehört in die Szene als der Bischofskandidat Jón dem Papst sein Anliegen, sowie Brief und Siegel des Erzbischofs von Lund, präsentiert. Daraufhin folgt: a) „Nu sem werðligr herra Paschalis pafi hefir yfir lesit bref eRkibyskupsins […] Virdir hann […]“ (JSH 79f.). ‚Nun als Papst Paschalis den Brief des Erzbischofs durchgelesen hat […], scheint ihm […]‘ (Übers. KM). Subjekt ist Papst Paschalis als LESER, das Akkusativobjekt ist bréf als TEXT. Yfir ist bei diesem Beleg eindeutig ein Adverb, weil es vor dem Verb steht. Die Situation erfordert kein für andere hörbares Lesen, weil Jón sein Anliegen bereits vorgetragen hat und kennt (vgl. Kap. III.7.b.), so dass der Papst ihm den Brief nicht noch einmal vorlesen muss.
Beim zweiten Beleg überreichen Norweger dem Bischof Jón und Priester Ríkinni ein Büchlein (bœklingr), in dem das Ereignis (atburðr) geschrieben steht, wie die Juden über Jesus gespottet und ihn gepeinigt hätten. Dieses Ereignis sei den Leuten damals völlig unbekannt (mjǫk ókunnigr) gewesen. Gemeint ist damit die im Mittelalter weit verbreitete Erzählung Flagellacio crucis in Berytho, welche auch auf Isländisch in zwei Handschriften erhalten ist (vgl. Steingrímsson 2003: II, 232f., Anm. 1). Nach der Zusammenfassung dieser Erzählung in der Saga steht: b) „hinn heilagi Iohannes ok Rikinni prestr hofðu *sagðan atburd yfir lesit“ (JSH 94). ‚Der heilige Johannes und der Priester Ríkinni hatten das erzählte Ereignis durchgelesen‘ (Übers. KM). Subjekt sind Jón und Ríkinni als LESER. Das Akkusativobjekt enthält das Substantiv atburðr, eigentlich einen Wert für das Attribut INHALT, welcher hier metonymisch zum TEXT verschoben ist. Yfir ist auch bei diesem Beleg eindeutig ein Adverb, weil es ebenfalls vor dem Verb steht. Die Erzählung war den beiden noch nicht bekannt gewesen sein, so dass sie diese wohl kaum einfach überflogen. Es kann anhand dieses Beleges weiter nicht beurteilt werden, wie Jón und Ríkinni lasen. Dasselbe Problem stellt auch die S-Redaktion, in der das Verb lesa steht (vgl. Kap. III.2.1.c.). Möglicherweise lasen sie das Ereignis gemeinsam oder nacheinander still durch. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie es einander vorlasen.
In der Jóns saga helga ist yfir bei beiden Belegen eindeutig ein Adverb. Das Partikelverb hat nur zwei Ergänzungen: 1. das Subjekt für das Attribut LESER mit den Werten biskup, prestr und páfi, in allen drei Fällen Geistliche, 2. das Akkusativobjekt für den TEXT mit den Lexemen atburðr und bréf. Bei beiden Belegen sind mehrere Personen anwesend, so dass lautes Lesen nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Eine Bedeutung ‚durchlesen‘ (mit oder ohne Stimme) träfe aber bei beiden Belegen zu.
In der Laurentius saga biskups ist lesa yfir dreimal belegt. Der erste Beleg ist in beiden Redaktionen mit unwesentlichen Unterschieden erhalten und hier nach der A-Redaktion zitiert: c) „bref fyrir sagt L(aurencij) byskups feck s[ira Pa]ll herra Jone byskupe. og suo sem hann hafdi þad yfer lesid vard hann miog styggur“ (LSB 111f.). ‚Den vorher genannten Brief des Bischofs Laurentius übergab der Priester Páll dem Bischof Jón. Und als er ihn gelesen hatte, wurde er sehr unwirsch‘ (Übers. KM). Subjekt ist Bischof Jón als LESER und das Personalpronomen þat ‚es‘ im Akkusativobjekt verweist auf das Lexem bréf als TEXT im vorhergehenden Satz. Die Position von yfir vor dem Verb identifiziert dieses wieder als Adverb. Neben dem Boten Páll werden keine anderen anwesenden Personen erwähnt. Es bleibt offen, ob Bischof Jón den Brief über- oder durchlas. Es ist aber unwahrscheinlich, dass er ihn Páll vorlas.
Der zweite Beleg stammt aus der B-Redaktion, weil in der A-Redaktion an der Stelle lesa e-t fyrir e-m steht (vgl. Kap. III.2.4.1.4.b.): d) „[váru] bref ok skilriki tekin ok yfir lesin“ (LSB 49) ‚Die Briefe und Beweise [wurden] genommen und durchgelesen‘ (Übers. KM). Yfir steht wieder als Adverb vor dem Verb. Die Lexeme bréf und skilríki im Subjekt sind Werte für das Attribut TEXT. Da die Beschlagnahmung der Briefe und Beweise in Auftrag der Chorherren geschieht, sind diese wohl auch die LESER. Es handelt sich in diesem Kontext wohl eher um Überlesen als Durchlesen, da die Chorherren nach Beweisen gegen Laurentius suchen.
Der dritte Beleg ist bezüglich LESER weniger eindeutig. Laurentius erhält den Brief des Erzbischofs mit dem Beschluss, dass er zum Bischof gewählt wurde. Die Belegstelle unterscheidet sich in den beiden Redaktionen nur unwesentlich und ist nach der A-Redaktion zitiert: e) „<A>th þessum bodskap settum og yfer lesnum þackade hann Gudi þessa giof og valld sier veitta. og aller þeir sem nalæger voru“ (LSB 85). ‚Nachdem dieser Beschluss feststand und gelesen wurde, dankten er und all jene, die dabei waren, Gott für dieses Geschenk und das Gewähren dieser Macht‘ (Übers. KM). Lesa yfir ist Teil eines Partizipialsatzes. Das Partizip Präteritum yfir lesinn ist Attribut des Substantivs boðskapr ‚Gebot, Geheiss, Auftrag‘ (vgl. Baetke 2002: 60), da in diesem Kontext eher als ‚Beschluss‘ zu verstehen ist und einen Wert für das Attribut TEXT bildet. Das Agens ist aus syntaktischen Gründen eine Leerstelle. Naheliegend ist das Subjekt des Hauptsatzes der frisch gewählte Bischof Laurentius, wobei auch der Bote, Priester Egill Eyjólfsson, infrage kommt. Der Beschluss des Erzbischofs besteht aus zwei Briefen, deren Inhalt darauf paraphrasiert wird. Im einen vergibt der Erzbischof Laurentius seine Taten und im anderen ernennt er ihn zum Bischof von Hólar (vgl. LSB 84). Darauf folgt das obige Zitat (e.), d.h. es wird nicht erwähnt, wie Egill den Brief präsentiert oder übergibt, so dass auch er das Agens sein kann. Dann müsste lesa yfir allerdings ‚laut lesen‘ bedeuten. Dafür spricht auch der keineswegs so enge Rahmen, weil ja nach dem Lesen nicht nur Laurentius Gott dankt, sondern auch alle anderen Anwesenden. Es könnte auch sein, dass der Brief von allen durchgelesen wurde, was die Bedeutung ‚laut lesen‘ wieder ausschlösse. An dieser Stelle kommt aber nicht nur die Konstruktion lesa yfir e-t, sondern auch lesa e-t yfir e-m in Frage. Weniger elliptisch sähe der Satz dann so aus: *[Síra Egill Eyjólfsson] las þennan boðskap yfir [Laurentio] ‚Priester Egill Eyjólfsson las dieses Gebot über Laurentius‘. Laurentius wäre dann Zuhörer und Adressat des Sprechaktes. Die öffentliche, lautstarke Inszenierung eines so wichtigen Sprechaktes wäre auch wahrscheinlicher, als dass er im Stillen gelesen würde.
Die semantische Analyse von lesa yfir e-t ist nicht nur schwierig, weil es im vorliegenden Korpus lediglich fünf Belege gibt, sondern auch weil die Wortart von yfir sich nicht bei allen Belegen eindeutig bestimmen lässt. Deshalb kommt beim letzten Beleg auch die Konstruktion lesa e-t yfir e-m in Frage. Jedoch lassen sich für lesa yfir e-t einige Gemeinsamkeiten festhalten. Es gibt nur zwei Ergänzungen: das Agens, welches die Rolle des LESERS mit den Werten biskup ‚Bischof‘, páfi ‚Papst‘, prestr ‚Priester‘ und wahrscheinlich kórsbróðir ‚Chorherr‘ ausdrückt, und das Thema, welches den TEXT mit den Werten atburðr ‚Ereignis‘, bréf ‚Brief‘, skilríki ‚Beweis‘ und möglicherweise boðskapr ‚Gebot‘ wiedergibt. Bis auf skilríki kommen diese Werte auch im Frame von lesa vor. Im Unterschied zu lesa kommen bei lesa yfir keine liturgischen Texte vor, so dass ein Konzept AUSWENDIG REZITIEREN sicher entfällt. Der Rahmen ist in allen Belegen, soweit es sich beurteilen lässt, klein, so dass es sich nicht um das öffentliche Verlesen vor einer grossen Gruppe von Zuhörern handelt. Bei zwei Belegen (a. und c.) sind nur der Bote und der Empfänger des Briefes anwesend, von denen Letzterer liest. Dies erfordert kein Lesen mit hörbarer Stimme. Wie bei lesa upp könnte das Adverb einen Wert für das Attribut STIMME enthalten. Im Falle von upp handelt es sich um eine deutlich hörbare Stimme, im Falle von yfir könnte es sich hingegen um eine nicht deutlich hörbare Stimme handeln, wie sie für individuelles Lesen ausreicht. Dies liesse sich auch auf die beiden Belege (b. und d.) übertragen, in denen mehrere Personen lesen, wie Jón und Ríkinni sowie die Chorherren, die den Text gemeinsam ohne deutlich hörbare Stimme über- oder durchlesen. Möglicherweise gilt dies auch für Beleg e), wenn der Fall zutrifft, dass alle Anwesenden den Brief des Erzbsichofs durchlasen. Die möglichen Bedeutungen ‚durchlesen‘ und ‚überlesen‘ unterscheiden sich im Aspekt der Genauigkeit, welche im Frame von lesa yfir als Attribut GENAUIGKEIT eine Rolle spielen könnte, das in diesem Korpus nicht als Ergänzung nachgewiesen werden kann. Das ONP (lesa) liefert allerdings folgenden Beleg aus der Rómverja saga: „kom madr i mot honum ok feck honum i hendr eítt bref. ok var læst. ok bad hann lesa yfir skyndiliga. en hann gaf ser æigi tom til“ (Helgadóttir 2010: 384). ‚Es kam ihm [= Julius Caesar] ein Mann entgegen und gab ihm einen Brief in die Hände, der verschlossen war, und bat ihn, ihn eilig durchzulesen. Aber er nahm sich die Zeit nicht‘ (Übers. KM). Lesa yfir ist hier Teil einer AcI-Konstruktion und das Personalronomen hann (Akk. Sg. m.) steht für das Agens. Der Leser ist somit Julius Caesar. Das zweite Akkusativobjekt bzw. das Thema ist eine Leerstelle, die auf bréf im vorhergehenden Satz verweist. Die dritte Ergänzung ist das Adverb skyndiliga ‚eilig, schnell‘ (vgl. Baetke 2002: 570). Dieses Adverb passt semantisch sehr gut zum Attribut GENAUIGKEIT. Das Attribut STIMME kommt hier nicht in Frage, da der Bote sehr wahrscheinlich nicht verlangt, dass Julius Caesar ihm den Brief schnell vorliest. Leider gibt es nicht mehr vergleichbare Belege, aber das Adverb deutet auf einen neutralen Defaultwert oder auf gründlich/genau hin. Es ist in diesem Kontext naheliegend, dass Julius Caesar den Brief still las, da neben dem Boten und ihm, der im Wagen auf dem Weg zum Kapitol sitzt, keine weiteren Personen erwähnt sind (vgl. Helgadóttir 2010: 384).
Die meisten übrigen Belege im ONP (lesa) stammen ebenfalls aus dem Briefverkehr. Das Agens ist der Empfänger des Briefes und neben ihm wird nur noch der Bote als anwesende Person erwähnt. Dies bestätigt die Annahme, dass es sich um stilles Lesen handelt. Dies wird in einem Beleg aus der Alexanders saga besonders deutlich, der bereits bei lesa upp angeführt wurde: „þa før hann ihendr honom þat sama bref biðr hann vpplesa oc meðan Philippus less yvir brevit. þa hyGr konungr at vandlega ef honom bregðe nockot við. oc eigi før hann þat sét“ (Jónsson 1925: 26). ‚Dann gibt er ihm denselben Brief in die Hände, bittet ihn, ihn vorzulesen, und während Philippus ihn durchliest, da schaut der König sorgfältig, ob er sich etwas anmerken lässt. Und er kann nichts sehen‘ (Übers. KM). Subjekt von lesa yfir ist der Arzt (læknir) Philippus. Der König bittet ihn zwar, den Brief vorzulesen (lesa upp), aber Philippus liest ihn still. Der lexikalische Unterschied scheint im Folgenden der Erzählung keine Rolle zu spielen. Der König kennt bereits den Inhalt des Briefes, so dass es auch nicht nötig ist, ihn vorzulesen. Wichtiger ist dem König Philippus‘ Reaktion auf den Brief, weshalb er den Arzt beim (stillen) Lesen genau beobachtet. Die Verben hyggja und sjá stehen für eine optische Wahrnehmung; die Reaktion wird also nicht akustisch über die Stimme wahrgenommen.
Schwieriger zu interpretieren sind einige Paarformeln in isländischen Urkunden aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Dies liegt auch daran, dass das ONP in der Belegreihe yfir nicht nach der Wortart unterscheidet. Zweimal belegt ist sjá ok yfirlesa bréf (vgl. Karlsson 1963: 150, 184), welche das Verifizieren des Dokuments (sjá) und das stille Lesen des Textes (lesa yfir) kombiniert. Dem widerspricht aber sjá ok heyra yfirlesit bréf (vgl. Karlsson 1963: 174). Das Verb heyra deutet nämlich auf eine auditive Wahrnehmung des Lesens hin. Somit bedeutet lesa yfir doch auch ‚vorlesen‘. Die Paarformel vér yfir lásum ok heyrðum yfir lesit bréf (vgl. Karlsson 1963: 358, 393) zeigt aber, dass lesa yfir zweideutig ist. Ersteres bedeutet, wie angenommen, ‚still lesen‘ und gehört zur Konstruktion lesa yfir e-t. Letzteres bedeutet zwar ‚laut lesen‘, ist aber wie möglicherweise der letzte Beleg der Laurentius saga biskups eine Ellipse der Konstruktion lesa e-t yfir e-m, welche das Attribut ZUHÖRER zusätzlich beinhaltet. Da das Subjekt von heyra darauf bereits verweist, kann der nominale Teil des Präpositionalobjekts yfir e-m leergelassen werden. Die Paarformel yfir lesa ok heyra yfir [sér] lesit ist somit synonym mit sjá ok heyra, welche in diesen Briefen ebenfalls vorkommt, fokussiert lexikalisch aber stärker und eindeutiger auf das Lesen. Die Paarformel sjá ok yfir lesa ist aber immer noch nicht eindeutig, weil die Ellipse auch hier gelten kann.
Dieser Abgleich mit Belegen ausserhalb des Korpus bekräftigt die hier erfolgte Analyse: Die Konstruktion lesa yfir e-t ist von lesa e-t yfir e-m semantisch zu unterscheiden. Die Wortart von yfir kann aber nicht immer sicher bestimmt werden. Für jeden Fall muss der Kontext daher genau darauf analysiert werden, ob es mögliche Zuhörer gibt.
Lesa yfir e-t verbindet somit die Attribute LESER (i.S.v. ocular reader) als Agens und TEXT als Thema. Das im ONP (lesa) belegte Adverb skyndiliga ist ein Wert für das Attribut GENAUIGKEIT und deutet auf einen neutralen Defaultwert oder auf einen Wert gründlich/genau hin. Es gibt keine Ergänzungen, die auf die Attribute ZUHÖRER und STIMME hindeuten. Das Attribut GENAUIGKEIT ersetzt also bei lesa yfir genau die syntaktische und semantische Position des Attributs STIMME bei lesa und lesa upp, weil die Stimme bei dieser Art des Lesens keine Rolle spielt.
Das Attribut RAHMEN kommt zwar als Ergänzung nicht vor, der Wert ergibt sich aber aus dem Kontext. Es handelt sich dabei immer um enge, nicht öffentliche Rahmen mit ein bis zwei Personen, von denen meistens eine der Empfänger des Schreibens und die andere der Bote ist, der teilweise dessen Inhalt schon kennt. Vorlesen und sehr wahrscheinlich auch hörbares Lesen können in diesem Rahmen ausgeschlossen werden. Lesa yfir unterscheidet sich also vor allem im Attribut GENAUIGKEIT und in den Werten der Attribute RAHMEN und STIMME von lesa und lesa upp.
5. líta
Das Verb líta ist die altisländische Entsprechung von lat. inspicere ‚(hinein)blicken, -sehen, ansehen; lesen‘ (vgl. Georges 1998, II, 321f.) und mhd. schouwen ‚sehen, schauen, betrachten; besichtigen, prüfen‘ (Lexer 1872–78: II, 778f.), die laut Green (2007: 8) und Saenger (1999: 85) im Latein und Mittelhochdeutschen für stilles Lesen verwendet werden. In der Sturlunga saga gibt es die Konstruktion líta á e-t (vgl. Müller 2018: 158f.). Spurkland (2000: 57) erwähnt das Partikelverb yfirlíta, das im Korpus der vorliegenden Arbeit aber nicht nachzuweisen ist. Die Konstruktion líta á e-t bedeutet in Baetke (2002: 386) ‚anschauen, betrachten‘. Bei Fritzner (1886–96: II, 535f.) ist bezogen auf die Schriftlichkeit vor allem die umständliche Umschreibung 1). „vende eller kaste sine Øine i en vis Retning for at faa Øie paa noget“ ‚seine Augen in eine bestimmte Richtung drehen, um etwas zu betrachten‘ von Belang. Jedoch fehlen in beiden Wörterbüchern wie auch in Lexer für mhd. schouwen eine Bedeutung ‚lesen‘ oder Zitate mit Bezug zu etwas Schriftlichem. ONP (líta) führt dazu unter der Konstruktion líta á e-t nur den Beleg aus der Sturlunga saga an, eine Übersetzung des Verbs fehlt.
In dem hier vorliegenden Korpus lassen sich insgesamt vier Belege mit Bezug zu etwas Schriftlichem finden. Im Präpositionalobjekt á e-t sind die Lexeme bók ‚Buch‘, bréf ‚Brief‘, kvaterni ‚Heft‘ und rolla ‚Rolle‘ enthalten. Je einen Beleg gibt es in der L-Redaktion der Jóns saga helga und der Sturlunga saga, sowie zwei in der Laurentius saga biskups.
Der Beleg der Jóns saga helga gehört in die Szene, in der ein Schreiber (skrifare) zu Jón kommt und ihm ein Buch zeigt, das er selbst für einen Priester geschrieben (skrifat) hat (s. a. Kap. II.5.1.b.). Darauf wird Folgendes erzählt: a) „herra byskup leit innuirdiliga áá bockina. lofadi ok sagdi sua. þetta er god bok“ (JSH 95). ‚Der Bischof schaute das Buch sorgfältig an, lobte es und sagte dann: „Das ist ein gutes Buch“‘ (Übers. KM). Subjekt ist Bischof Jón und im Präpositionalobjekt á bókina ist ein Wert bók für ein Attribut SCHRIFTTRÄGER enthalten, welcher aber auch SKRIPT und TEXT impliziert. Dritte Ergänzung ist das Adverb innvirðiliga ‚genau, sorgfältig, eingehend‘ (vgl. Baetke 2002: 307), das darauf hindeutet, dass Jón das Buch nicht einfach kurz anschaute, sondern eingehend prüfte, was wahrscheinlich auch Lesen beinhaltete. An dieser Stelle kann dieses Adverb noch keinem Attribut zweifelsfrei zugeordnet werden. Da es sich um die Arbeit eines Schreibers handelt, steht hier das Attribut SKRIPT als Resultat der Schreibarbeit sicher im Vordergrund.
In der S-Redaktion tritt in der gleichen Szene anstelle von líta ein weiteres verbum videndi auf: b) „Enn byskvp hyggR at bokinni ok lofvaði miok ok mællti siðan. Goð er þessi bok ok vel ritvð“ (JSH 27f.). ‚Aber der Bischof sieht das Buch genau an und lobt es sehr und sagte darauf: „Gut ist dieses Buch und gut geschrieben“‘ (Übers. KM). Das Verb hyggja at e-u bedeutet „überlegen, nachdenken über; achtgeben, aufpassen auf; nachsehen; betrachten, (genau ansehen)“ (Baetke 2002: 291) und ist in den anderen Sagas des Korpus sonst nicht in einem schriftlichen Kontext belegt. Deshalb ist nicht sicher, ob es sich um eine konventionelle Bedeutung handelt. Es geht aber wie bei líta á um das Überprüfen des Skripts.
In der Sturlunga saga ist líta á e-t einmal in der Reykjarfjarðarbók überliefert:
c) Hann kom til Asgrims ok færdi honum bref; hann sag[diz] [kominn] or Isa-firdi ok vtan or fiordvm, ok sagdi Odd Ola son [hafa] [f]engit ser brefit ok Þordisi Snora dottur. Asgrimr leit [á brefit], ok var þar a kvediv-sending til Asgrims, [þeira Odds ok Þórdísar; en] þat var vmmal a brefinv, at […] (StS1 452).
Er [= Otkell Bjarnason] kam zu Ásgrímr und überbrachte ihm einen Brief. Er sagte, dass er aus Ísafjǫrðr und von draussen aus den Fjorden komme und sagte, dass Oddr Ólason und Þórdís Snorradóttir ihm den Brief gegeben haben. Ásgrímr schaute den Brief an und darauf war ein Grusswort an Ásgrímr von Oddr und Þórdís, aber in dem Brief stand, dass […] (Übers. KM).
Subjekt ist Ásgrímr Bergþórsson, ein Laie, und im Präpositionalobjekt á e-t ist das Substantiv bréf enthalten, das als Wert auf die Attribute SCHRIFTTRÄGER, SKRIPT oder TEXTSORTE zutrifft. Die nachträgliche Erwähnung des Grusswortes und des Inhaltes fokussiert auf den Text des Briefes, so dass das Präpositionalobjekt sicher auf das Attribut TEXT referiert. Der betrachtete Text beinhaltet nicht nur das Skript und seinen Inhalt, sondern auch den Schriftträger. Das Subjekt ist folglich der LESER, im Sinne von Greens (2007: 20) ocular reader.
Die Laurentius saga biskups enthält zwei Belege von líta á e-t. Der erste Beleg ist wegen einer Lakune in der A-Redaktion nur in der B-Redaktion überliefert und gehört in der Erzählung zu einer Szene, in der der Erzbischof das Schreibe-, Dichte- und Lesetalent des Priesters Laurentius prüft und sagt (s.a. Kap. II.6.2.c. und III.2.4.11.):
d) Enn kom til vor ȧ morgin og sẏn oss letr þitt, og ef þu̇ kannt nockud ad dẏckta. Næsta dag epter kom sẏra Laur(entius) til erchi byskups, halldandi ȧ einne rollu̇. Erchi byskupinn leẏt ȧ og lofadi letrid, og mællti, les fyrer oss þad er þu̇ hefur dẏcktad. hann las þar af vers er hann hafdi giort til fru̇ Hallberu̇ abbadẏsar ad Stad. (LSB 16).
Und komm morgen zu Uns und zeig Uns deine Schrift, und ob du etwas dichten kannst. Am nächsten Tag danach kam Priester Laurentius zum Erzbischof und hielt eine Rolle [in seinen Händen]. Der Erzbischof schaute darauf und lobte die Schrift und sagte: “Lies Uns das vor, was du gedichtet hast!” Er las von ihr den Vers, den er zu Ehren der Äbtissin Hallbera von Stad gemacht hatte (Übers. KM).
Subjekt ist der Erzbischof und im Präpositionalobjekt á e-t ist das Substantiv rolla als Wert für ein Attribut SCHRIFTTRÄGER enthalten. Das nachfolgend erwähnte polyseme Lexem letr ‚Buchstabe, Schrift, Inschrift, Geschriebenes, Text, Dokument, Brief‘ (vgl. Fritzner 1886–96: II, 487, ONP letr) und die nachträgliche Aufforderung des Erzbischofs den Text vorzulesen (lesa) demonstrieren, dass das Skript als Resultat von Laurentius‘ Talent als Schreiber im Vordergrund steht. Der inhaltliche Teil des Textes kommt erst beim Vorlesen zum Zug. Der Erzbischof ist sicher ein Wert für den LESER bzw. ocular reader und rolla ist metonymisch verschoben ein Wert für das SKRIPT.
Der zweite Beleg liegt wegen einer Lakune in der B-Redaktion nur in der A-Redaktion vor. Bischof Laurentius exzerpiert Texte und lässt seine Notizen von Diakon Einarr abschreiben:
e) Epter mal tijdina dagliga reikade hann. fyrst for hann þa j sitt studium og studerade hann j bokum. skrifade hann vpp aa vax spialld. nöteranndi þad sem hann | villde hafa serliga vr bokum. og þar epter skrifade Einar diakne vpp j kuaterne edur bok so a[d] byskupinum var til tæk nær hann villde aa lita og þad framme hafa (LSB 101).
Nach der täglichen Mahlzeit schlenderte er ziellos umher. Zuerst begab er sich in sein Studierzimmer und studierte in den Büchern. Er schrieb auf einer Wachstafel auf, indem er notierte, was er aus den Büchern besonders haben wollte und danach schrieb Diakon Einarr es in ein Heft oder ein Buch ab, so dass es dem Bischof zur Verfügung stand, wenn er es anschauen und davon Gebrauch machen wollte (Übers. KM).
Das Personalpronomen hann im Subjekt steht für Bischof Laurentius. Das Präpositionalobjekt á e-t ist elliptisch, dessen Leerstelle auf die davor genannten Lexeme kvaterni ‚Heft‘ oder bók ‚Buch‘ verweist, die beide als Werte für das Attribut SCHRIFTTRÄGER in Frage kommen. Beim Exzerpieren steht der SCHRIFTTRÄGER weniger im Vordergrund als der TEXT, so dass die beiden Schriftträger metonymisch verschoben als Werte zum Attribut TEXT gehören. Laurentius schaut Einars Abschriften nicht nur an, sondern er muss sie lesen, um davon Gebrauch machen zu können, so dass er die Rolle des LESERS bzw. ocular readers einnimmt. Das Skript ist im Falle einer Exzerptsammlung eher sekundär.
Das Subjekt von líta á e-t ist in allen Belegen sicher der LESER mit den Werten biskup ‚Bischof‘, erkibiskup ‚Erzbischof‘, und im Falle von Ásgrímr bietet sich ein Wert leikmaðr ‚Laie‘ an. Das Präpositionalobjekt á e-t enthält die Werte bók ‚Buch‘, bréf ‚Brief‘, kvaterni ‚Heft‘ und rolla ‚Rolle‘, welche primär Schriftträger sind, aber metonymisch verschoben auch Skripte oder Texte darstellen können. Bei den Belegen a) und d) steht das Skript im Vordergrund, bei den Belegen c) und e) hingegen der Text. Je nach Situation stehen materielle, visuelle und inhaltliche Aspekte des Textes im Fokus des ‚Schauens‘. Aus diesem Grund ist TEXT als Attribut vorzuziehen, weil das Skript nur einen Aspekt des Textes bildet. Neben diesem Kernframe bestehend aus LESER und TEXT hat líta á e-t noch eine einmal belegte dritte Ergänzung, das Adverb innvirðiliga. Dieses passt bestens zum Attribut GENAUIGKEIT von lesa yfir (vgl. Kap. III.4.). Bei líta á e-t bezieht sich diese Genauigkeit vor allem auf äusserliche Aspekte wie das Skript, während bei lesa yfir inhaltliche im Vordergrund stehen. In allen Belegen ist der Rahmen klein, es sind höchstens zwei Personen anwesend, von denen in drei Fällen die nicht lesende Person den Text schon kennt. Es handelt sich also sicher um Lesen ohne deutlich hörbare Stimme.
Das ONP (líta) nennt nur, wie oben schon erwähnt, den einen Beleg aus der Sturlunga saga, der sicher in Bezug zur Schriftlichkeit steht. Dies weist darauf hin, dass der Gebrauch von líta als verbum legendi möglicherweise unkonventionell ist, gerade im Kontrast zum häufiger belegten sjá. Líta scheint auch keinen Eingang in die Urkundensprache gefunden zu haben. Gegen einen unkonventionellen Gebrauch sprechen allerdings die Belege aus der Jóns saga helga und Laurentius saga biskups, die im ONP fehlen, sowie die verba videndi anderer Sprachen wie mhd. schouwen oder lat. inspicere, welche ebenfalls als verba legendi verwendet wurden.