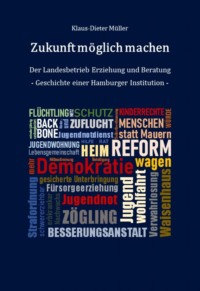Kitabı oku: «Zukunft möglich machen», sayfa 9
Diese, von Verlautbarungen über hehre Ziele getragene Aufbruchsstimmung nutzten einzelne Fachvertreter, die Strukturen der Heimerziehung in Frage zu stellen. Zu den Protagonisten gehörte der Heil- und Sozialpädagoge Andreas Mehringer, der 1945 die Leitung des Münchner Waisenhauses übernahm und dort das „Familienprinzip“ einführte.{234} Darunter verstand er kleine Gruppen von Kindern und Jugendlichen, die einer Familie ähneln sollten. Bereits in den Nachkriegsjahren stellte er öffentlich fest, dass Anstaltskinder oft im Leben versagen würden. In den Anstalten seien besonders „starke, ausgeprägte, originelle Naturen“ gefährdet, denn diese würden den Anstaltsbetrieb stören und zu ihrem Ausschluss zwingen. Er sprach auch die künstlichen Trennungen nach Alter, Geschlecht und erzieherischer Bedarfseinschätzung sowie die zu großen Gruppen als Hauptprobleme an. Möglichen Reformen würde aber der Traditionalismus in der Heimerziehung entgegenstehen. Damit waren die gewachsenen Strukturen des Anstaltslebens und das Selbstverständnis der Heimleitungen und des Personals angesprochen, die eher in scheinbar „boshaften, unerziehbaren“ Kindern das Problem für Konflikte in den Heimen sahen als in der Anstaltsorganisation und in ihrer eigenen Haltung.{235}
Auch im AFET wurden ähnliche Beiträge zur Diskussion gestellt. So stellte der Pädagoge Friedrich Trost 1947 auf einer AFET-Tagung fest, dass in den religiös ausgerichteten Heimen das Ziel religiöser Erziehung im Vordergrund stehe und nicht die Pädagogik für das Kind. Daher sei ein „Kampf gegen das Monopol der kirchlichen Erziehung“ in der Heimerziehung notwendig.
In den Fachdiskussionen weitgehend unwidersprochen war die Einschätzung aus den späten 1950er Jahren, dass die Hälfte der Heimerzieher nicht ausgebildet, der Erzieherbeststand überaltert, die Gruppen zu groß sind und die Erzieher „erschreckend häufig wechseln“.{236}
Aus diesen kritischen Beiträgen entwickelte sich keine, von einer Mehrheit getragene fachliche Auffassung oder gar eine Reformbewegung. Bis weit in die 1960er Jahre hinein sollte es zwischen vereinzelten kritischen Diskussionen in der Fachöffentlichkeit und der Ebene der praktischen Heimerziehung eine tiefe Kluft geben. Und die Praktiker waren stets darum bemüht, die Heimerziehung vor den Augen der Öffentlichkeit zu verbergen. Die Jugendpolitiker setzten einen deutlichen Schwerunkt beim Aufbau der Kinder- und Jugendarbeit und bei anderen, präventiv in der Breite wirkenden Programmen. Die Heimerziehung blieb ein in sich geschlossenes und daher einer Reform nicht zugängliches System.
Die Akteure in der Jugendhilfe und speziell in der Heimerziehung waren zu Reformschritten wohl auch nicht in der Lage. Sie knüpften vielmehr stark an der Fachlichkeit der Vorkriegszeit an, in der sie bereits gewirkt hatten. Senator Eisenbarth und auch Frau Senatorin Karpinski waren ebenso wie die Leiterin des Landesjugendamtes von den 1920er Jahren geprägt. Kurt Röbiger, der bis 1958 Vorgesetzter der Leiterinnen und Leiter der Erziehungsheime war, war in den 1920er Jahren Lehrer im Waisenhaus in der Averhoffstraße. Auch auf der Ebene der Heimleitungen waren beispielsweise Frau Schulze aus dem Heim Gojenberg und Frau Cornils aus der Feuerbergstraße bereits seit Ende der 1920er Jahre im Heimdienst tätig. Ähnlich stellte es sich auch in der Mitarbeiterschaft dar.
Im Bereich der Psychologie und Medizin wirkten die erbbiologisch geprägten Konzepte zur Verwahrlosung und Unerziehbarkeit aus den späten 1920er Jahren und der Zeit des Nationalsozialismus im Nachkriegsdeutschland nach. Der Psychiater Villinger trat als Koryphäe seines Faches zwar etwas gemäßigter auf, und auch die leitenden Heimärzte in Hamburg, Mann und Hülsemann, durften ihre Tätigkeit nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Regimes fortsetzen. Die von ihnen in der Vergangenheit vertretenen Auffassungen und Methoden erfuhren jedoch nur oberflächliche Korrekturen, wie Stil und Inhalt der Gutachten zum Beginn der 1950er Jahre belegen. Erst langsam und vor allem mit neuem Personal änderte sich auch die psychologische und psychiatrische Begutachtungspraxis.{237}
Nach dem Krieg lebte auch die Forderung des AFET wieder auf, ein „Bewahrungs- und Arbeitserziehungsgesetz“ zu verabschieden, um die „Unerziehbaren“ aus den Heimen zu verbannen. Ein solches Gesetz wurde jedoch nie beschlossen. Die „Unerziehbaren“ blieben also in den Heimen, ohne dass neue pädagogische Ansätze Einzug hielten, oder sie wurden wegen mangelnder Erfolgsaussicht der erzieherischen Maßnahmen aus den Heimen entlassen.{238}
Dieser konservativen Tendenz in der Jugendhilfe stand ein kultureller Wandel in den Wirtschaftswunderjahren gegenüber. Die deutsche Jugend begeisterte sich für die amerikanischen Einflüsse wie neue Musikrichtungen, Comics, Kleidungsstile und liberalisierte Geschlechterrollen. Dies erschütterte die von Ordnung geprägte, deutsche Leitkultur. Viele in der Jugendhilfe Tätige konnten diese Veränderungen nicht verstehen und nicht verarbeiten. Fachvertreter sahen in dieser Entwicklung sogar eine Gefährdung junger Menschen, die einen Eingriff des Staates erforderlich machte. Die Zahl der in Heimen betreuten Minderjährigen stieg auch vor diesem Hintergrund ab 1950 an und nahm erst zum Ende des Jahrzehnts wieder ab.{239}
Auf der Ebene der Gesetzgebung gab es ebenfalls wenig Fortschritt. Das Reichjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) von 1922 blieb in seiner Fassung von 1932 auch nach dem Krieg in Kraft. Umfassendere Reformversuche Anfang der 1950er Jahre setzten sich nicht in neues Recht um. Erst 1961 wurde ein novelliertes Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) verabschiedet, das auch die Heimerziehung etwas klarer regelte. Bis zu dieser Novelle war im Gesetz die Fürsorgeerziehung geregelt, die bei einer Gefährdung des Kindes durch das Vormundschaftsgericht angeordnet werden konnte. Neben der eher längerfristigen Erziehung in einem Heim waren auch die eilige und die versuchsweise Fürsorgeerziehung geregelt. Sie sollten den sofortigen Schutz eines Kindes regeln und dessen pädagogische Erreichbarkeit in einem Fürsorgeerziehungsverfahren klären. Eltern konnten aber auch aus ihrem elterlichen Recht heraus mit ihrer Einwilligung oder auf eigenes Betreiben ihr Kind in die Fürsorgeerziehung übergeben und damit auch die Beendigung der Erziehung in einem Heim bestimmen. Für diese freiwillige Erziehungsmaßnahme fand sich im RJWG keine eindeutige Regelung. Die Länder hatten allerdings in ihren Landesfürsorgegesetzen seit Ende des 19.Jahrhundert und später in den Ausführungsgesetzen zum RJWG bereits Regelungen getroffen. In Hamburg, mit seiner langen Tradition seit 1892 auf diesem Gebiet und anders als in anderen Ländern, überwog die Zahl der freiwilligen Erziehungshilfen gegenüber der angeordneten Fürsorgeerziehung daher auch in den Nachkriegsjahren deutlich. Daneben gab es noch einen weiteren Zugangsweg in ein Erziehungsheim: Das Jugendgericht konnte in Jugendstrafsachen eine Unterbringung in einem Jugendheim nach dem Jugendgerichtsgesetz veranlassen.
Das Jugendwohlfahrtsgesetz von 1961 brachte einige wenige Verbesserungen: so wurde etwa die freiwillige Erziehungshilfe einheitlich geregelt. Außerdem wurden die Aufgaben einer Heimaufsicht definiert, die bislang in Deutschland sehr unterschiedlich geregelt waren. In Hamburg gab es seit den 1920er Jahren bereits eine landesjugendamtliche Aufsicht. Neu geregelt war auch, dass die Träger der Heime nur „geeignete“ Kräfte zu beschäftigen hatten, womit jedoch nicht unbedingt ausgebildete Fachkräfte gemeint waren. Es gab einfach zu wenige Fachkräfte, so dass ein Fachkräftegebot gar nicht umzusetzen gewesen wäre.{240} Die Rechtsänderung hatte auf den Alltag in Heimen allerdings kaum Auswirkungen, wie in einem Gutachten aus dem Jahr 2010 festgestellt wurde: „Im Ergebnis bleiben die Umstände, die … die ‚Misere‘ der Heimerziehung kennzeichnen, auch über die Reform von 1961 erstaunlich konstant.“{241}
Die Haltung gegenüber der Jugend, die Heimtraditionen, die ungenügende Finanzierung der Heime und die Ohnmacht des Personals, auch mit schwierigeren Jugendlichen umzugehen, waren die Rahmenbedingungen für einen Heimalltag, der an die Praxis der vergangenen Jahrzehnte anschloss. Kinder und Jugendliche wurden in der Regel streng erzogen und bisweilen eingesperrt, misshandelt, ausgebeutet und kaum individuell gefördert und wenig auf das Leben vorbereitet. Die Misere fing für viele Kinder bereits in den Säuglingsheimen an. Eine weit verbreitete und vom Bundesministerium für Familienfragen noch 1958 vertretene Auffassung war, dass Säuglinge „nicht pädagogisch betreut, sondern lediglich hygienisch gepflegt“ werden müssten. Dadurch erlitten aber viele Kinder erhebliche Entwicklungsrückstände und dauerhafte Schädigungen.{242}
Und die Öffentlichkeit ignorierte die ihr wenig bekannten Zustände in der Heimerziehung weitgehend. In ihrem Bewusstsein waren die Kinder und Jugendlichen und ihr vermeintlicher Unwille, sich angepasst zu verhalten, das Problem. Mit der Strenge des Heims, seinem Strafcharakter, wurde in der Bevölkerung gegenüber Kindern auch gerne mal gedroht: „Wenn du nicht brav bist, kommst du ins Heim!“{243}
Die Untersuchungen über die Heimerziehung von 1945 bis zu Beginn der 1970er Jahre kommen daher zu sehr kritischen Einschätzungen. Der AFET ordnete sich nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes im Mai 1945 „in die repressiven Traditionen der Debatten über ein Bewahrungsgesetz sowie der Konzepte zur Verwahrlosung und Unerziehbarkeit ein.“{244} Die diskutierten, notwendigen Reformen scheiterten vor allem an der „Reformresistenz der Heime, die auf eine Jahrzehnte alte ‚Tradition‘ im Hinblick auf Weltanschauung und eingefahrene ‚Erziehungsmethoden‘ zurückblickten.“{245} Damit waren die Heime bundesweit angesprochen, und zwar alle, also Heime sowohl in freier, oft kirchlicher, als auch kommunaler oder staatlicher Trägerschaft.
In Hamburg fand die Heimerziehung vor allem in den städtischen Heimen statt. Hamburg war allerdings auch nach dem Krieg wie zuvor darauf angewiesen, Kinder und Jugendliche außerhalb der Stadt unterzubringen. So wurden beispielsweise 1966 190 auswärtige Heime durch die Hamburger Jugendbehörde belegt.{246} Die meisten Gebäude der städtischen Heime waren für einen Heimbetrieb nicht oder nur bedingt geeignet. Sie waren vor längerer Zeit für einen Anstaltsbetrieb errichtet worden, wie die Heime in der Feuerbergstraße oder in Wulfsdorf. Einige waren als Villen oder aus anderer Nutzung für einen Heimbetrieb hergerichtet worden, wie etwa das Mädchenheim Schwanenwik. Bis 1970 wurden nur das Kinderheim Niendorf und das Säuglingsheim Poppenbüttel neu gebaut. Die Vereinigung städtischer Kinder- und Jugendheime errichtete 1961 außerdem das Kinderheim Hohe Liedt.{247} In einem, Jahrzehnte später veröffentlichten Bericht heißt es: „Die pädagogische Situation in fast allen Vollheimen war durch viel zu hohe Gruppenstärken, strikte Trennung zwischen Wohn- und Schlafbereichen und große Schlafsäle bestimmt“. Und: “Die schlechte Personalsituation beeinträchtigte die Erziehungsarbeit mindestens ebenso stark wie die schlechten Bedingungen.“{248} Die Jugendbehörde verfügte 1962 über insgesamt 23 Heimschulen, die alle Schulformen außer das Gymnasium bis zur Berufsschule umfassten.{249} Kinder in Heimen besuchten die mit den Heimen räumlich verbundenen Heimschulen, wenn man sie für öffentliche Schulen, die „Ortsschulen“, für nicht zumutbar hielt oder es keine Schule in der Nähe gab. Für die Heimschule wurde auch argumentiert, dass die Heimkinder in den Ortsschulen stigmatisiert würden und für die Verwahrlosten ohnehin ein Milieuwechsel und eine enge Verzahnung der Erziehung im Heim mit der Schule erforderlich seien. Erst in den späten Sechzigerjahren überstieg in Hamburg die Nutzung der Ortsschulen die der Heimschulen, obgleich der Anteil der Heimschulen weiterhin sehr hoch war.{250} In den ersten zwei Jahrzehnten nach Kriegsende blieb der Heimschulbetrieb qualitativ deutlich hinter dem der öffentlichen Schulen zurück. Unterrichtet wurde in Klassen mit mehreren Jahrgängen. Und auch die Schulräume - oft waren dies die Gemeinschaftsräume der Einrichtung -, die Ausstattung mit Lehrmitteln und die Qualifikation des Lehrkörpers und ihrer Vertretung blieben hinter den Standards öffentlicher Schulen zurück.{251} Das Konzept der Heimschule blieb trotz der verstärkten Nutzung öffentlicher Schulen noch die Leitlinie in den Heimen für die so genannten Schwererziehbaren mit geschlossenen Gruppen. So wurde beispielsweise noch Ende der 1970er Jahre im Mädchenheim Feuerbergstraße ein Heimschulgebäude geplant und errichtet.
Die Heime waren und wurden weiterhin nach Alter und pädagogischen Anforderungen differenziert. So wurden das Kinderheim in Dibbersen und das Overbeckheim in Emmelndorf in heilpädagogische Heime mit psychologischem Fachpersonal umgewandelt. Im Hamburger Heimsystem gehörten auch vor dem Entlaufen gesicherte Gruppen im Mädchenheim Feuerbergstraße, in den Jugendheimen Wulfsdorf und Osdorf und in den Durchgangsheimen Hütten und Schwanenwik zum Bestand an Heimen. Die Jugendbehörde wie auch die Hamburger Vormundschaftsrichter vertraten die Auffassung, dass „die Anordnung der Fürsorgeerziehung und sogar die Gewährung der Freiwilligen Erziehungshilfe eine etwa notwendige Freiheitsentziehung einschließen.“{252} Die „gesicherten Gruppen“, in denen Jugendliche eingeschlossen wurden, genügten jedoch weder pädagogisch noch baulich den Anforderungen an diesen Zweck in einem modernen Rechtsstaat: Das Heim „Hütten“ war beispielsweise ein ehemaliges Polizeigefängnis aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.{253} Die Regelungen zur Umsetzung der Freiheitsentziehung im Heimalltag waren seit der Zeit vor dem ersten Weltkrieg zwar ein nie zu Ende diskutiertes Thema, aber faktisch nie geändert worden. Und so war es für die im Gestern verhaftete Jugendhilfe bezeichnend, dass das Heim „Hütten“ nach dem Krieg zwar nach dem ermordeten, jugendlichen NS-Widerstandskämpfer aus der Hamburgischen Verwaltung in Helmuth-Hübener-Haus umbenannt wurde, dieser Name aber nie Eingang in die Alltagskommunikation fand.
In Hamburg gab es außerdem eine Reihe von Jugendwohnheimen, die jungen Menschen nach der Schule und während ihrer Berufsausbildung einen Wohnort boten. Sie waren im System der Heime eine weitere, letzte Station vor der endgültigen Entlassung aus der öffentlichen Erziehung. Die Überweisung eines jungen Menschen in eines der Jugendwohnheime war eine Möglichkeit, den Aufenthalt im Erziehungsheim nach dem Schulbesuch zu beenden. 1966 gab es noch 11 Jugendwohnheime mit insgesamt 600 Plätzen, die zu diesem Zeitpunkt in die Abteilung „Kinder- und Jugendheime“ der Jugendbehörde eingegliedert wurden.{254}
Der seit Jahrzehnten eingefahrene Heimalltag blieb bis weit in die 1960er Jahre hinein für die Öffentlichkeit weitgehend verborgen. Aus heutiger Sicht ist es jedoch möglich, den Heimalltag aus mehreren Perspektiven genauer zu betrachten. Die Sicht der Funktionäre in Verbänden und Behörden wurde oben bereits angerissen und ist aus öffentlichen Darstellungen erkennbar. Die der Heimleitungen und des Personals findet sich in Heimakten und eigenen Schilderungen wieder. Die Perspektive der Betroffenen, also der Eltern, Verwandten und vor allem der Kinder und Jugendlichen selbst, ist erst zu Beginn des folgenden Jahrhunderts durch die Aufarbeitung jener Zeit an den „Runden Tischen“ zur Heimerziehung und über die Entschädigungsfonds ans Licht der Öffentlichkeit gehoben worden. Aus allen Perspektiven ergibt sich ein Bild des Heimalltags mit Licht, aber auch viel Schatten.
„Etwas Geborgenheit fanden alle“
Ein Mitarbeiter im Mädchenheim Feuerbergstraße saß im Herbst 1969 über einem großen Blatt Millimeterpapier und trug die Zahl der Aufnahmen in das Heim vom 21. April 1911 bis zum 30. September 1969 für jedes Jahr in ein Koordinatensystem ein und verband sie zu einer Linie. Berge sind 1937 erkennbar, als das Friedrichsbergprojekt{255} beendet wurde, ebenso 1947, als junge Frauen im Nachkriegschaos aufgegriffen wurden, und in den 1950er Jahren, als Mädchen und junge Frauen vor einem zu laxen Lebensstil bewahrt werden sollten. Unter dem Datengebirge sind Zahlen notiert: 14672 Kinder und Jugendliche waren über Jahrzehnte aufgenommen worden. Zu jenem Zeitpunkt standen Heime bereits in der öffentlichen Kritik, so dass der Kommentar zur Grafik sehr zurückhaltend lautet: „Und wenn nur 1% eine Heimat fand, es wären 146. Und wenn nur 10% dem Heim dankbar sind, es wären 1467, und wenn nur 50% entscheidend geholfen werden konnte, es wären 7336.“ Der Kommentar endet mit den melancholischen Worten: „Etwas Geborgenheit fanden alle“.
Die Gründe für die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen waren damals wie heute im Prinzip die gleichen. Eltern waren der Fürsorge und Erziehung ihrer Kinder, auch schon der sehr bedürftigen Babys und Kleinkinder, nicht gewachsen oder fielen komplett aus. Manche Kinder störten im Familienleben oder fielen durch ihr Verhalten auf. Sie waren in prekären familiären Verhältnissen aufgewachsen und wenig beachtet und gefördert worden. Aus Fallaufzeichnungen des Heimes Feuerbergstraße der 1960er Jahre geht hervor, dass die Mädchen aus schwierigen Familienverhältnissen stammten, Familien zerbrochen waren oder sie bei ebenfalls wenig erziehungsfähigen Großeltern oder Pflegeeltern aufwuchsen. In einem Fall heißt es beispielsweise: „Problematisch ist der Familienhintergrund. … Was Einsicht und Erziehungsfähigkeit betrifft, hat Frau K. unserem Eindruck nach starke Grenzen. Daneben wirkt sie abgerackert, ohne Entschlusskraft und im Grunde recht depressiv. (…) Der Vater, der zeitweise stark trank, zeigte sich als Familientyrann.“{256} In einem anderen Fall wechselte der Lebensort in der Kindheit einer jungen Frau zwischen den geschiedenen Eltern, den Großeltern und einem Heim mehrmals innerhalb der ersten 10 Lebensjahre.{257}
Die Mädchen wurden in der Kindheit meist nicht gefördert, besuchten oft die Sonderschule und erreichten kaum Schulabschlüsse. Bei ihnen wurde in den Gutachten des Heimes mangelnde Konzentrationsfähigkeit, geringe Ausdauer und ein dem Alter nicht entsprechendes Urteilsvermögen und Sozialverhalten festgestellt. So sei beispielsweise das Mädchen M. „innerlich haltlos und verführbar“ gewesen und sei „leicht Versuchungen“ erlegen. Die Einschätzung schloss mit der Aussage über das Mädchen: „Aufgrund seiner Kritiklosigkeit, Gutgläubigkeit und Naivität ist es besonders in sexueller Hinsicht gefährdet.“{258} In Einzelfällen wurde auch eine „Minderbegabung“ oder „Retardierung“ diagnostiziert. Dabei griff man gelegentlich auch auf überholtes Vokabular zurück: „B. ist ein schwachsinniges Mädchen ohne Urteilsvermögen und ohne Einsichtsfähigkeit in das Abnorme ihres Verhaltens.“{259}
Bei einem Teil der Mädchen wurde ein zurückhaltendes Wesen erkannt. Maßstab für die Beurteilung war vor allem die Anpassungsfähigkeit: „Wir lernten in R. ein zurückhaltendes und freundliches Mädchen kennen, das keinerlei Erziehungsschwierigkeiten bereitete.“{260} Oder: „J. fügte sich schnell und gut in die Gruppengemeinschaft ein. Sie ist zurückhaltend. Aufgetragene Arbeiten erfüllt sie bereitwillig und schnell. Freiwillige Arbeiten übernimmt sie gerne. Ihr Zimmer hält sie sauber und ordentlich.“{261}
Bei anderen Mädchen stellte man hingegen eine offensive Persönlichkeit fest, die nach damaliger Sichtweise als „frech“, „arrogant“, „anmaßend herausfordernd“ und „mit aggressivem Ton“ beschrieben wurde. Diese Mädchen verrichteten das Arbeitsprogramm „unwillig“ und „lustlos“ und beteiligten sich an der Ausarbeitung von „Weglaufplänen, bei denen sie auch vor Gewaltanwendung“ nicht zurückschreckten.{262}
Bei den Jungen gab es ähnliche Hintergründe für eine Kindheit und Jugend im Heim. Der achtjährige Günter, der Jahrzehnte später seine Geschichte erzählte, kam 1955 in das Johannes-Petersen-Heim in Volksdorf: „Seine Mutter lehnt ihn ab, behandelt ihn lieblos, verwöhnt aber seine Geschwister. Sein Vater sitzt immer wieder im Gefängnis. Die Eltern lassen sich scheiden. Er schwänzt die Schule.“ Es folgten mehrere Heimwechsel, die der Junge nicht verstand.{263} Ein anderes Beispiel ist Peter aus Barmbek, der „mit seinem Stiefvater immer öfter aneinandergeriet, durch Prügeleien und Klauereien auffiel und schließlich von der Polizei von zu Hause fortgeholt und in ein Kinderheim in Blankenese eingewiesen wurde.“{264}
Im damaligen Heimsystem erfolgte in der Regel eine Beobachtungsphase in einem „Durchgangsheim“, nach der der künftige Ort in einem der Heime festgelegt wurde. Dieser Ablauf entsprach dem, wie er bereits zu Zeiten des Jugendamtsdirektors Petersen galt. In den mittlerweile stark spezialisierten Heimen stellte man dann bisweilen fest, dass das Kind doch nicht zum Heim passte, sich vielleicht nicht erwartungsgemäß verhielt oder entwickelte und spätestens mit dem Eintritt oder der Entlassung aus der Schule war ein erneuter Heimwechsel erforderlich. So kam Arne als 7-Jähriger, für ihn überraschend, aus seiner Pflegefamilie in das Kinderheim in Volksdorf, „später in das St. Elisabeth Heim in Bergedorf, ins Hansingheim in Escheburg. Die letzten Jahre verbrachte er auf dem Bernwardshof in Hildesheim.“{265} Nachdem der 14jährige Peter aus dem Heim in Blankenese weggelaufen und auf St. Pauli aufgegriffen worden war, „ging es in die Erziehungsanstalt ‚Hütten 42‘ in der Nähe des Holstenwalls, danach nach Wandsbek, weiter nach Osdorf, Bergedorf und Wulfsdorf. (…) Seine schlimmsten Jahre verbrachte er im Landesfürsorgeheim in Glückstadt.“{266}
Der Weg in die Heime für schwer erziehbar geltende Jugendliche in der Feuerbergstraße und in Wulfsdorf führte ebenfalls über ein Durchgangsheim. Die meist 14 bis 17-jährigen Mädchen, die in das Heim in der Feuerbergstraße neu aufgenommen wurden, kamen oft über das Durchgangsheim Schwanenwik. Zuvor waren sie durch Bummelei oder Abwesenheit von ihrer Arbeitsstelle aufgefallen, einige hatten Freunde, bei denen sie sich aufhielten. Aber auch eine Überweisung aus anderen Heimen war üblich, wenn sich die jungen Menschen nicht an die dortigen Regeln hielten oder als schwer erziehbar klassifiziert wurden. Eine junge Frau musste zum Beispiel das Jugendwohnheim Mellingstedt verlassen, weil sie sich nicht an die Hausregeln hielt. Auch das Mädchen U. sollte der Weg in die Feuerbergstraße führen. Als knapp 14-jährige kam sie 1962 in ein Heim nach Maschen im südlichen Umland von Hamburg. Bereits nach kurzer Zeit entlief sie von dort und wurde als Reaktion darauf in ein Heim in Bergedorf versetzt. Bereits 1963 entließ man sie zu den Eltern. Nachdem sie 1965 versucht hatte, sich das Leben zu nehmen, wurde sie erneut in dem Heim in Bergedorf aufgenommen. Weil sie sich dort nicht einfinden konnte und abermals entlief, wurde sie in das Mädchenheim Feuerbergstraße eingewiesen. Von dort sollte sie nach ein paar Monaten und „bei einigermaßen positiver Entwicklung als Hausmädchen in das Kinderheim Waldenau versetzt werden.“ {267}
In der Aufnahmestation in der Feuerbergstraße erfolgte eine zwei- bis dreimonatige Beobachtung, die mit einem Gutachten und einer Empfehlung zum weiteren Vorgehen abgeschlossen wurde. In die Begutachtung wurde in den 1960er Jahren auch eine Psychologin einbezogen. Der weitere Weg führte dann in eine andere Einrichtung, oftmals bereits die dritte Station innerhalb weniger Monate, oder in das geschlossene Haupthaus der Feuerbergstraße, der Endstation in der Heimhierarchie für die jungen Frauen.
Wenn sie sich die Jungen im geschlossenen Erziehungsheim Wulfsdorf als unangepasst und „nicht erziehungsfähig“ erwiesen, war eine Einweisung in das Landesfürsorgeheim Glückstadt eine Maßnahme der Hamburger Jugendbehörde. Einzelne Jungen aus anderen Heimen führte der Weg aber auch direkt dorthin. Das Heim an der Elbe unweit von Hamburg war ursprünglich ein Militärdepot, im 19.Jahrhundert dann Zuchthaus und „Korrektionsanstalt“ und ab 1925 „Landesarbeitsanstalt“. Während des NS-Regimes diente es als Konzentrations- und Zwangsarbeiterlager. Ab 1949 wurden dort Jugendliche aufgrund von Straftaten oder bloß unangepassten Verhaltens untergebracht. Zum Heimalltag gehörte es, dass die Jungen in Anstaltskleidung gesteckt wurden, die noch aus der KZ-Zeit stammte. Der Tag war mit Arbeit für die lokale Wirtschaft gefüllt: Fischernetze knüpfen oder in der Landwirtschaft schuften. Eine schulische oder berufliche Bildung gab es nicht. Dafür Erziehung mit Gewalt, Einschließen im Bunker und Abriegelung von der Außenwelt, begleitet von verzweifelten Versuchen, sich das Leben zu nehmen.{268} Das alles war über Erzählungen bekannt. „Glückstadt“ hing daher wie ein Schwert über dem Aufenthalt in Wulfsdorf und anderen Heimen für Jungen.
Der 14-jährige Heinz{269} wurde Ende Oktober 1966 im Landesfürsorgeheim Glückstadt aufgenommen. Heinz hatte bis dahin wenige Jahre die Schule besucht, davon die letzten drei in der Sonderschule. Er verfüge über „keine ausgeprägte Intelligenz“, schätzte man ihn damals ein. Die familiären Verhältnisse waren einfach und für Heinz wenig förderlich. Bereits im Alter von 10 Jahren wurde er in das Kinderheim Averhoffstraße eingewiesen, lief von dort immer wieder weg. Danach erfolgte in kurzen Abständen die Unterbringung in verschiedenen Heimen, darunter die Heime „Hütten“ und Wulfsdorf in Hamburg. Dort wurde er trotz seines noch geringen Alters mit Hilfsarbeiten beschäftigt und schulisch nicht gefördert. Zwischendurch wurde er zu seinen Eltern entlassen. Wie Heinz selbst in einem kurzen Lebenslauf bei der Aufnahme im Heim in Glückstadt berichtete, sei er aufgrund einer Auseinandersetzung mit seiner Mutter im März 1966 für drei Wochen in die „freiwillige FE“ eingewiesen worden. Er verbrachte danach nur noch kurze Zeit im Elternhaus bis man ihn erneut in das Erziehungsheim „Hütten“ einwies. Von dort kam die Anregung zur Verlegung in das Landesfürsorgeheim Glückstadt. In der Heimakte ist vermerkt, dass er immer wieder entwich und „dabei reichlich Dummheiten“ machte, womit kleinere Straftaten gemeint waren. In Glückstadt sollte er „durch den geschlossenen Erziehungsvollzug zur Ruhe gebracht und zur Stetigkeit erzogen werden. Seine Schulfähigkeit sollte geprüft werden.“ Nach der Aufnahme im Heim Glückstadt im November 1966 war Heinz am Jahresende in einen Entlaufungsversuch verwickelt. Die daraufhin für 14 Tage verhängte „Einzelerziehung“, das heißt der Einschluss in einer Zelle, habe den Jungen beeindruckt. „Er war glücklich, daß er wieder in die Heimgemeinschaft genommen wurde“, heißt es in einem Bericht vom Januar 1967. Er arbeitete nun in der Netzstrickerei. Heinz soll versprochen haben, „sich jetzt mehr Mühe zu geben, damit die Erwartungen, die in ihn gesetzt werden, zur Erfüllung gelangen.“ Der Vater bat regelmäßig „höflichst“ um einen „Besuchsschein“ für seine Frau, damit sie Heinz besuchen konnte. Der Besuch wurde in Abständen mehrerer Wochen gewährt. Aus Sicht der Erziehenden im Heim machte Heinz Fortschritte, so dass er „versuchsweise“ in die „Baugruppe“ versetzt wurde. Dort zeigte er „als Anstreicher gute Leistungen“. Er wurde sogar in ein „Außenkommando“ versetzt, eine Gruppe von Jugendlichen, die bei einer Glückstädter Firma arbeitete. Von dort entwich er erneut, und wurde in „Heimstrafe“ isoliert. Das Landesfürsorgeheim Glückstadt bescheinigte Heinz nach 8 Monaten seines Aufenthaltes im Juni 1967 eine grundsätzlich positive Entwicklung, zeigte er doch eine sehr viel bessere „Einstellung zum Gruppenerzieher“ als noch bei seiner Aufnahme. Er verfüge über eine „praktische“ und „soziale Intelligenz“, sei „pfiffig“ und „von guter Lebensschläue“. Der Verlaufsbericht zeigt, wie sehr die Analyse noch von Jahrzehnte alten Vorstellungen geprägt war. Heinz stehe nach der „Typenlehre so etwa zwischen dem zyklothymen und dem schizothymen Menschen“ und gehöre zum „Personenkreis der Schwachbegabten“. Er sei von der äußeren Erscheinung ein typischer „Halbzigeuner, immer etwas viscös, klebrig, manchmal nicht ganz sauber“. Die Schilderungen der Familienverhältnisse und der Person der Mutter waren ebenso abfällig. Man attestierte ihr eine „Affenliebe“ zu ihrem Sohn. Ein Begriff, der vom Hamburger Fürsorger bereitwillig in dessen Aktennotiz übernommen wurde. Das Heim erkannte aber auch, dass Heinz „zu Mitmenschen gesellig, angepasst, kameradschaftlich und vertrauend“ sei.
Zu diesem Zeitpunkt war bereits an eine Entlassung gedacht. Der Fürsorger aus der Hamburger Jugendbehörde, der Heinz im Juni 1967 in Glückstadt besuchte, stellte fest, „dass eine baldige Inarbeitgabe geplant werden muss, weil der Junge mit der geschlossenen Situation auf Dauer nicht fertig wird.“ Die Frage der „Schulfähigkeit“ wurde nicht mehr aufgegriffen. Man hatte Heinz in dieser Beziehung schon vor längerer Zeit aufgegeben. Knapp zwei Monate später erfolgte dann die Entlassung zu den Eltern, obwohl man dort keine positive Entwicklung erwartete.
Heinz startete ohne Schulabschluss ins Arbeitsleben, schaffte aber später nach einer Haftzeit und diversen Anlerntätigkeiten eine Berufsausbildung. Seine Erlebnisse in den Heimen, zu denen auch schwere Misshandlungen gehörten, haben sein Leben stark beeinflusst und ihn nachhaltig belastet.
Im Normalfall wurden die „Zöglinge“, wie die jungen Menschen in Heimen damals noch bezeichnet wurden, bei entsprechendem pädagogischem Erfolg zu ihren Eltern, Verwandten oder in ein Lehrlingsheim entlassen, wenn sie noch nicht volljährig waren. Das Gesetz sah aber auch eine Entlassung vor, wenn sich ein Erziehungserfolg nicht einstellen mochte und der junge Mensch sich damit als unerziehbar herausgestellt hatte. In einer 1960 veröffentlichten Studie wurden 21 Hamburger Fälle untersucht, die in den Jahren 1954 und 1955 wegen so genannter Unerziehbarkeit aus dem Heim entlassen wurden. Diese 21 jungen Menschen waren eine Teilgruppe aus insgesamt 60 Fällen. Die Erfolglosigkeit wurde durch den jeweiligen Erziehungssachbearbeiter in der Behörde festgestellt, in der Regel aus der Ferne aufgrund der Aktenlage. Für die Untersuchung wurden diese 60 Fälle daher noch einmal den Heimleitungen vorgelegt, die diese Fälle einschätzen sollten. Die Zahl verringerte sich auf 24, von denen 21 letztendlich in die Untersuchung eingingen. Die Leiterin der „Studie an 21 Einzelschicksalen“, Alice Borchert, stellte ungünstige Rahmenbedingungen fest, die eine Erziehung negativ beeinflussten: So war in vielen Fällen die Anfangsdiagnose unzutreffend oder mangelhaft, u.a. weil die Informationen über ein Kind oder einen Jugendlichen falsch oder subjektiv gefärbt oder von einer Institution nicht an die andere gegeben worden war. Auch hat sich die Jugendbehörde auf die Informationen Dritter verlassen und sich kein eigenes Bild unter Einbeziehung des Kindes oder des Jugendlichen gemacht. Dies hat zu falschen Heimzuweisungen geführt, die immer wieder durch einen Heimwechsel korrigiert werden sollten. Auch verfügte Hamburg selbst über zu wenige Heimplätze, so dass sich auch hieraus Warteschleifen mit kurzen Aufenthalten ergaben. Besonders Jungen wechselten bei einer Gesamtzeit in Heimen von unter zwei Jahren mehrheitlich vier und mehr Mal den Betreuungsort, zum Teil bereits nach nur wenigen Wochen. Die jungen Menschen wurden in ihrer Individualität oft nicht erkannt und nicht entsprechend pädagogisch betreut. Besonders in den Heimen für Jungen gab es so gut wie keine ausgebildeten Fachkräfte.{270} Auf der Seite der Jugendbehörde sah es nicht viel anders aus. 1957 waren dort 17 Sachbearbeiter für 4600 Kinder in stationärer Erziehungshilfe zuständig und hatten Entscheidungen über die Heimkinder zu fällen. Die Zahl stieg in den Folgejahren weiter an. 1961 waren in der Abteilung „Öffentliche Erziehung“ bereits 24 Sachbearbeiter tätig, von denen aber nur zwei über eine pädagogische Ausbildung verfügten. Erst in der Folgezeit wurde hier eine Verbesserung eingeleitet.{271} Die Untersuchung stellte die Mängel des Heimsystems klar heraus und identifizierte dabei auch eine nicht angemessene Haltung bei den Erwachsenen, die über Kinder entschieden. Ihrer Herangehensweise liege die Annahme zugrunde, „daß der Jgdl. selbst Schuld habe an seinem Schicksal.“ Dies werde durch eine unkritische Übernahme von Aktenmaterial verfestigt, das „ohne weiteres ‚für wahr‘“ gehalten werde. Es sei notwendig, „den Erzieher zu ermutigen, mehr seinem eigenen Urteil zu vertrauen.“{272} Doch an diesen zugewandten, eigenständig urteilenden Fachkräften mangelte es noch erheblich.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.