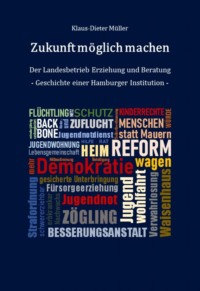Kitabı oku: «Zukunft möglich machen», sayfa 7
Zur Lösung des Unterbringungsproblems wurden seit 1937 vermehrt und vor allem für Hilfsschüler auswärtige Anstalten in Anspruch genommen. Auch im Mädchenheim Feuerbergstraße wurde es eng. Die schulentlassenen Mädchen mussten die Wohnräume zugleich als Arbeitsräume nutzen.{141}
Im Handbuch der Verwaltung des Jahres 1939 ist die Umgestaltung der Heimstruktur zu erkennen: Das „Jugendheim Ochsenzoll“ war beispielsweise ein „Heim für leicht unterwertige, labile oder schwachsinnige Schulkinder“, das Jugendheim Reinbek dagegen eines für „erbwertige Kinder“. Die feine Abstufung ist auch bei der Beschreibung des Jugendheimes Gojenberg zu erkennen, das als „Erziehungsheim für schwierige, aber erbwertige Kleinkinder und kleinere Schulkinder“ bezeichnet wurde. Das Mädchenheim Feuerbergstraße war für „schulentlassene schwererziehbare Mädchen“ zur „Arbeitserziehung“ vorgesehen, das Heim auf dem Gut Wulfsdorf für „schwererziehbare männliche Jugendliche“ zur landwirtschaftlichen Ausbildung.
Die „Ausmerzung der Minderwertigen“, wie der Verwaltungsdirektor der Anstalt Eilbecktal, Dr. Späth, den Selektionsprozess bezeichnete, war einen großen Schritt vorangekommen. Die Kinder und Jugendlichen in den Erziehungsheimen waren zunehmend auf jene reduziert, „die das Niveau eines Volksschülers erreichen und darum die sorgfältige Betreuung des Staates verdienen.“{142} Sie galten als fähig und nützlich, einen Beitrag für das Regime zu leisten. Für die anderen war in der Jugendhilfe kein Platz mehr vorgesehen. Ihnen sollte später ein anderes Schicksal bereitet werden.

Die ersten Vorbereitungen für einen Angriffskrieg begannen bald nach der Machtergreifung 1933, und zwar nicht nur durch Aufrüstung und Ausübung außenpolitischen Drucks, sondern auch durch die mentale Einstimmung der Gesellschaft. Der Eingliederung der Bevölkerung in Organisationen, die das Regime stützen und kampfbereit machen sollten, stand die Marginalisierung und Vernichtung der als minderwertig und daher als gesellschaftliche Last betrachteten Menschen gegenüber. Dieser Prozess spielte sich auch in der Jugendhilfe ab.
Die Nützlichkeit des einzelnen für die Volksgemeinschaft bemaß sich vor allem an seiner Arbeitswilligkeit und -fähigkeit. Der Psychiater Villinger hat schon früh zwei Ursachen für die Arbeitslosigkeit ausgemacht. Er benannte die durch äußere Einflüsse bedingte Arbeitslosigkeit, in die Arbeitswillige getrieben werden können. Davon unterschied er die personenbedingte Arbeitslosigkeit, die durch eine vererbte, charakterliche und damit pathologische Disposition eines Arbeitslosen entstehe. Sie trete als Arbeitsscheu und mangelnde Kompetenz in Erscheinung und gehe sogar oft mit krimineller Neigung einher. Er traf damit den neuen Zeitgeist.
Nach der umfassenden Begutachtung der Fürsorgezöglinge in den 1930er Jahren betrachtete man die meisten von ihnen allenfalls als billige Arbeitskraft, aber nicht mehr als Teil der „Volksgemeinschaft“. So wurden sie weitgehend wegen „schlechter Erbanlagen“, Unerziehbarkeit sowie charakterlicher Mängel von der Einberufung in den Reichsarbeitsdienst (RAD) oder zur Wehrmacht ausgeschlossen. Dies betraf beispielsweise die Mädchen des Jahrgangs 1922 im Heim Feuerbergstraße, die 1940 zur Musterung anstanden. So wurden etliche nicht zum RAD zugelassen, was Enttäuschung bei den Mädchen und auch der Direktorin des Heimes hervorrief. Gleiches erlebten die Jungen im Erziehungsheim Wulfsdorf. Der Reicharbeitsdienst oder die Einberufung zur Wehrmacht waren für die jungen Menschen attraktiv, bedeuteten sie doch die endgültige Entlassung aus dem Heim.{143} Die in den Heimen verbliebenen jungen Menschen waren aber gut genug, um „kriegswichtige Arbeiten“ zu leisten. So hat zum Beispiel das Mädchenheim Feuerbergstraße Arbeiten in der Rüstungsindustrie übernommenen. An der vollen Ausschöpfung dieser Ressource wirkte die Direktorin des Heimes durch Heraufsetzung der täglichen Arbeitszeit und Reduzierung der internen Hausarbeit mit Engagement mit. Sie argumentierte dies mit den „erhöhten Anforderungen, die durch den totalen Arbeitseinsatz des deutschen Volkes an jeden einzelnen deutschen Menschen gestellt werden.“{144} Dazu gehörte auch das Stopfen von Strümpfen für die Wehrmacht, wie ein Mädchen später berichtete: „Ich erinnere mich noch sehr gerne an die Zeiten, wo wir in der Kriegszeit 1200 Paar Strümpfe für Kasernen in der Woche stopfen mussten. (…) Da haben wir oft bis ein Uhr in der Nacht gesessen (…) hat kein Mädchen gesagt, ach, lasst mich mal lieber ins Bett gehen (…) Das war eine ganz schöne Gemeinschaft, das muss ich sagen.“{145}
Das Regime honorierte den Einsatz der Heimzöglinge, die in der Landwirtschaft, in Rüstungsbetrieben oder in anderen kriegswichtigen Bereichen arbeiteten, nicht. Reichsweit waren die Versuche der Heimleitungen, so auch der des Mädchenheimes Feuerbergstraße{146}, und auch des AFET gescheitert, für sie die Essenrationen heraufzusetzen. Die Antwort der amtlichen Stellen war jeweils eindeutig: In dem diesbezüglichen Erlass war eine bessere Ernährung nur für junge Menschen vorgesehen, die als „rassisch wertvolle deutsche Jugend“ galten und an die „besonders grosse Anforderungen in geistiger und körperlicher Hinsicht gestellt werden und die als Führernachwuchs für Partei, Staat und Wehrmacht ausersehen sind.“{147} Konkret waren dies junge Menschen in den Adolf-Hitler-Schulen, den nationalpolitischen Erziehungsanstalten, den Führer- und Führerinnenschulen der Hitlerjugend und weiteren Einrichtungen dieser Art. „Die Insassen der Fürsorgeerziehungsheime können mit diesen Jugendlichen nicht verglichen werden“{148}, wurde abschließend klargestellt.
Auch ein Antrag der Direktorin Cornils aus dem Jahr 1940, die Kinder der Warteschule des Mädchenheimes wegen der verstörenden nächtlichen Fliegerangriffe in die Kinderlandverschickung einzubeziehen, wurde mit der gleichen Begründung abgelehnt: die Kinder seien minderwertig und es daher nicht wert, besonders geschützt zu werden.{149}
Das Heimleben in der Feuerbergstraße hatte sich bis zu den ersten Kriegsjahren auf den Nationalsozialismus eingestellt, wie sich Valeska Dorn erinnert, die von 1939 bis 1942 im Heim leben musste. Dazu gehörte das Antreten in Gruppen auf dem Hof, der Hitlergruß, Strafen im „Bunker“, tägliche Arbeit im Anstaltsbetrieb und die allgemein raue Behandlung, die eben jenen „rassisch Minderwertigen“ zugedacht war. Valeska Dorn erinnerte sich an die Erziehungsdirektorin Cornils als „Oberin“. Das ist bemerkenswert, war dieser Titel doch Ende der 1920er Jahre abgeschafft worden. Er war aber offenbar noch lange Zeit im Alltag gebräuchlich, und passte wohl auch zum Regiment in der Feuerbergstraße.{150}

An einem Tag im Oktober 1944 wurde ein behindertes Kind des Kinderkrankenhauses von der chirurgischen Abteilung Rothenburgsort auf die Infektionsabteilung überwiesen. Es war an Scharlach erkrankt. Die Stationsschwester steckte im Laufe des Tages der Assistenzärztin einen Zettel zu. Die Ärztin las die Worte: „Genehmigung für A.H. liegt vor.“ A.H. waren die Initialen des Kindes. Sie besorgte sich aus der Krankenhausapotheke das Medikament Luminal. Zur Abendzeit begab sie sich dann zusammen mit einer Schwester in das Krankenzimmer des Kindes. Die Schwester hielt das Kind fest und die Ärztin spritzte das Barbiturat in tödlicher Dosis in das Gesäß des Kindes. In der Nacht lief das Kind blau an, hatte Schaum vor dem Mund, „nasenflügelte“ und röchelte, bis es still war. Auf dem Totenschein vermerkte die Ärztin pflichtgemäß: „Todesursache Pneumonie“.{151}
Bereits 1940 war ein Programm zur Aussonderung und physischen Vernichtung von Kindern angelaufen. In einem im Oktober 1939 verfassten, aber auf den 1. September 1939 zurück datierten Schreiben hatte Hitler die Tötung kranker Menschen in den Ermessenspielraum einzelner Ärzte gestellt.{152} Dabei wurde der Begriff des „Gnadentodes“ verwendet. Eine gesetzliche Grundlage zur Euthanasie wurde zwar erwogen, aber aus Geheimhaltungsgründen sogleich wieder verworfen. Damit war nur dieser „Führererlass“ Grundlage für die Tötung von rund 200 Tausend Menschen, Erwachsenen wie Kindern. Das daraufhin anlaufende Euthanasieprogramm wurde von Mitarbeitern der „Kanzlei des Führers“ organisiert. Hierzu wurde der „Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingter schwerer Leiden“ gegründet, der Erlasse zur Durchführung des Programms und insbesondere eine Pflicht zur Meldung von schwer erkrankten Kindern im Alter bis zu drei Jahren herausgab.{153} Ab 1939 waren angeborene Missbildungen zu melden, aber auch „Idiotie sowie Mongolismus“, wodurch ein breiter Spielraum in der Diagnostik eröffnet wurde. Das Meldeverfahren wurde durch Meldeformulare bürokratisch geordnet und in der Folgezeit mehrfach präzisiert. Der Reichsausschuss entschied anhand der Angaben auf den Meldebögen, ob an einem Kind in einer speziellen Anstalt eine „Behandlung“, also eine Tötung, durchgeführt werden durfte. Hierfür wurden die reichsweit etwa 30 „Kinderfachabteilungen“ in besonders ausgesuchten Krankenhäusern gegründet. In Hamburg bestanden im Kinderkrankenhaus Rothenburgsort und in der Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn solche Abteilungen.{154} Die Leitenden Ärzte waren in das Programm und die gewünschte Behandlung eingeweiht und auch willig mitzuwirken. In Hamburg waren dies die Ärzte Wilhelm Bayer für Rothenburgsort und Friedrich Knigge für Langenhorn. Die administrative Verantwortung lag beim Gesundheitssenator Ofterdinger, dem Obersenatsrat Struve zur Seite stand. Ausgangspunkt für die Auswahl der in Betracht kommenden Kinder waren die Amtsärzte, die ebenfalls in das Programm eingebunden waren. Für die Amtsärzte und die beiden Kinderfachabteilungen war der Leiter des Gesundheitsamtes Sieveking zuständig.{155} Ab Mitte oder Ende 1940 – das genaue Datum war auch im Strafprozess nach dem Krieg nicht zu klären – begannen die Tötungen im Kinderkrankenhaus Rothenburgsort, Anfang 1941 ging die Kinderfachabteilung in Langenhorn in Betrieb.{156}
Viele Kinder befanden sich noch in der Obhut der Eltern und für die Einweisung und Behandlung war deren Einverständnis erforderlich. Die Eltern waren also über die Behandlung aufzuklären, wobei man sie offenbar anlog, dass eine Behandlung durchgeführt werden könne, die aber das Risiko berge, dass das Kind nicht überlebte.{157} Nicht alle Eltern waren einverstanden, verweigerten die Einweisung oder holten ihre Kinder aus den Krankenhäusern wieder ab. Sie wurden aber weiterhin zur Behandlung gedrängt. Waren alle Formalien erledigt und lag der Kinderfachabteilung die Tötungsermächtigung vor, konnte sie vollzogen werden. Dies geschah durch die Injektion eines hochdosierten Barbiturats. Die Todesursache wurde in den Todesbescheinigungen mit „Lungenentzündung“ angegeben. Es konnte später nicht genau aufgeklärt werden, wie viele Tötungen vollzogen wurden. Die Anklageschrift im Prozess nach dem Krieg ging von 12 Kindern in Langenhorn und 56 Kindern in Rothenburgsort aus. Es waren aber nach neueren Erkenntnissen vermutlich 22 und 60 Kinder. Allerdings wurden auch Verlegungen von Kindern in andere Anstalten vorgenommen, in denen ebenfalls Tötungen vollzogen wurden.{158}
Die Psychiater des Jugendamtes konnten mit ihrer Begutachtung eine Überweisung in eine Heilanstalt veranlassen. In Hamburg waren dies die Alsterdorfer Anstalten, es kamen aber auch andere Einrichtungen in Betracht. Nach Anlaufen des Euthanasieprogramms wurde der Weg von dort in Einrichtungen veranlasst, die dann eine Tötung verübten. So wurden allein am 7. August 1943 80 Kinder aus den Alsterdorfer Anstalten in die Heil- und Pflegeanstalten Kulmenhof und Eichberg verlegt. Viele von ihnen kamen zuvor aus den Heimen des Landesjugendamtes, etwa aus dem Johannes-Petersen Heim, dem Kleinkinderhaus Winterhuder Weg oder auch der Kindergruppe der Einrichtung Feuerbergstraße.{159} Die Selektion fand bereits in den Aufnahmestationen oder Durchgangsheimen statt, wie der Fall der 17jährigen, geistig behinderten Olga C. zeigt. Bis zum Januar 1943 lebte sie bei ihren Eltern, als die Mutter erkrankte und Olga im Durchgangsheim Schwanenwik untergebracht wurde. Dort erkannte man ihre Behinderung. Bereits nach wenigen Tagen wurde den Eltern das Sorgerecht entzogen, das Mädchen in die Anstalt Langenhorn verlegt und von dort am 22.6.1943 der Tötungsanstalt Hadamar zur Euthanasie ausgeliefert. Die Krankenakte verzeichnete acht Tage später ihren Tod an ‚Pneumonie‘.“{160}
Der im April 1938 geborene Junge Alfred Rahnert{161} wurde wenige Wochen nach seiner Geburt im städtischen Kinderheim im Eißendorfer Pferdeweg aufgenommen. Seine Mutter war nach der Geburt gestorben und sein Vater, der mit Alfreds Mutter eine außereheliche Beziehung unterhalten hatte, wandte sich von dem Kind ab. Er hatte vier Kinder aus seiner Ehe und war mit seinem eigenen Leben schon überfordert. Er litt unter Lähmungen, aus denen die Ärzte für Alfred eine erbliche Vorbelastung ableiteten. Das Baby wuchs im Kinderheim auf. In der damaligen Zeit war man noch der Überzeugung, dass Babys und Kleinkinder vor allem gepflegt werden müssten und keiner weiteren Ansprache bedurften. Im November 1939 fielen dem Heimarzt Dr. Gräfe dann Alfreds Entwicklungsverzögerungen auf. „Er konnte weder sitzen noch sprechen, musste gefüttert werden und war kaum ansprechbar.“ Da Alfred keine „Schwierigkeiten“ bereitete, wurde er im Heim belassen. Ein halbes Jahr später wurde Alfred erneut durch Gräfe untersucht. Er kam nun zu der Feststellung, dass Alfred „seiner Unterwertigkeit wegen und im Interesse der Betreuung der gesunden Kinder nicht tragbar“ und nicht erziehungsfähig sei. Damit hatte er das Kind aufgegeben. Er empfahl die Unterbringung in den Alsterdorfer Anstalten, in die Alfred im Juni 1940 verlegt wurde. In der Eingangsuntersuchung wurde bei Alfred „Debilität“ und später „Imbezillität“ diagnostiziert. Als nach den Bombennächten im Juli 1943 die Anstalten geräumt wurden, gehörte Alfred zu den 52 Jungen, die in die Heil- und Pflegestation Kalmenhof verlegt wurden. In der dortigen Kinderfachabteilung wurde er am 11. November 1943 ermordet.
Widerständige Jugendliche waren ebenfalls Ziel der Aussonderung. In einer Beiratssitzung der Sozialverwaltung vom 6. Februar 1941 führte der Leiter des Landesjugendamtes, Prellwitz, aus, dass „in der Betreuung der nicht besserungsfähigen Jugendlichen seit Jahren eine Lücke klaffte.“{162} Er meinte Jugendliche, die polizeilich auffällig wurden oder sich in den Heimen durch Aufsässigkeit zeigten und als „Unansprechbare“ bezeichnet wurden, die „mit den Mitteln des Jugendamtes nicht zu beeinflussen“{163} waren. Zu dieser Gruppe von Jugendlichen gehörten auch solche, die bereits in den Vorkriegsjahren der nationalsozialistischen Vereinnahmung im Alltag eigene Lebensäußerungen entgegen gesetzt hatten: die aus gutbürgerlichen Kreisen stammende Hamburger Swing-Jugend, die sich in Clubs zu Musikveranstaltungen traf und sich öffentlich oppositionell zeigte. Drohungen mit Zwangserziehung, Folter bei polizeilichen Verhören oder gar Inhaftierungen in der Haftanstalt Fuhlsbüttel oder dem Arbeitslager Farmsen blieben ohne abschreckende Wirkung.{164} Mit dem fortschreitenden Zerfall des Alltagslebens der Familien im Bombenkrieg tummelten sich auch mehr und mehr Jugendliche anderer Milieus auf der Straße und in den Ruinen und entzogen sich der nationalsozialistischen Einvernahme.
Vor diesen jungen Menschen musste die „Gemeinschaft in irgendeiner Form“{165} geschützt werden. Und hierfür hatte die Polizei endlich eine Lösung gefunden, die so genannten Jugendschutzlager für Jugendliche im Alter von 13 bis 22 Jahren, die wie ein Konzentrationslager funktionierten. Ab August 1941 fanden erste Einweisungen aus allen Bereichen des Reiches und auch aus besetzten Gebieten in das für männliche Jugendliche vorgesehene Jugend-KZ im niedersächsischen Moringen statt. An diesem Ort war im 19. Jahrhundert ein Werkhaus gegründet worden. Es diente neben dem Werkhausbetrieb im Jahr 1933 für kurze Zeit als Männer-KZ, danach von 1933 bis 1938 als Frauen-KZ und ab 1940 als Jugend-KZ.{166} 1942 wurde das Lager Uckermark für weibliche Jugendliche gegründet. In diesen „Jugendschutzlagern“ landeten die „asozialen“ und „kriminellen“ Jugendlichen, die als unerziehbar galten oder aus anderen Gründen wie Homosexualität oder ihrer Religionszugehörigkeit in der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft keinen Platz haben durften. Das Jugend-KZ war neben den Pflegeanstalten eine weitere Möglichkeit, die Erziehungsheime zu entlasten, wie Prellwitz 1941 ausführte: „Die Landesjugendämter begrüssen diese Einrichtung, die die Fürsorgeerziehung von mancher nicht erfreulichen Belastung befreit.“{167} Die inhaftierten, jungen Menschen waren einem brutalen Regiment mit Misshandlungen ausgesetzt: Essensentzug, Strafstehen, Bunkerarrest, Stockhiebe und Strafexerzieren. In der angeschlossenen Munitionsfabrik wurden sie zur Arbeit gezwungen. Sie waren außerdem Objekt rassenbiologischer Untersuchungen zum Zweck der Forschung, aber auch zum Zweck der weiteren Selektion, Entscheidung über Zwangssterilisation und Überstellung zum Beispiel in Anstalten mit Tötungsauftrag. Das Jugend-KZ wurde bis Kriegsende betrieben, dann mit einem Gewaltmarsch evakuiert. Die Kranken und Schwachen blieben allerdings im Lager zurück und waren ihrem Schicksal hilflos ausgeliefert. {168}

Bereits neun Monate nach Kriegsbeginn im September 1939 begannen erste Luftangriffe der Alliierten auf Hamburg. Am 18. Mai 1940, kurz nach Mitternacht, warfen die Flugzeuge der britischen Royal Air Force (RAF) die ersten Spreng- und Brandbomben auf Industrieanlagen in Harburg ab. Das eigentliche Ziel war jedoch die Werft Blohm & Voss. Das Bombardement konnte, wie sich auch in den folgenden Angriffen zeigte, nicht zielgenau ausgeführt werden. Und somit wurden auch auf der Anflugroute von Nordwesten her Bomben abgeworfen, die einzelne Gebäude in Eimsbüttel trafen. 34 Menschen ließen in dieser Nacht ihr Leben, darunter auch ein Kind.{169}
Von den 212 folgenden Luftangriffen brannten sich jene des Unternehmens „Gomorrha“ im Jahr 1943 in die Geschichte der Stadt ein. Die Angriffe dienten nicht mehr nur der Ausschaltung von kriegswichtigen Industrieanlagen, sondern auch der Demoralisierung der Bevölkerung. Am Sonntag, dem 25. Juli 1943, wieder kurz nach Mitternacht, flogen fast 800 Flugzeuge von Nordwesten her auf die Stadt zu und zerstörten Eimsbüttel, Altona, Teile des Hafens und verstreut auch andere Stadtteile. Auch die Nikolaikirche in der Innenstadt wurde getroffen. Sie wurde nie wiederaufgebaut; die Ruine ist heute ein Mahnmal. Es folgten noch am Sonntag und dann am Montag Tagesangriffe. Noch verheerender war der Angriff am Mittwoch, den 28. Juli, um Mitternacht. Ziel war diesmal das Gebiet südöstlich der Alster zwischen Hammerbrook und Uhlenhorst. Dieser Angriff löste den „Feuersturm“ aus, der mit dem durch Wind angefachten Feuer nach dem Bombardement die Verwüstung weiter vorantrieb. Ein weiterer Angriff am 30. Juli legte Barmbek in Schutt und Asche. In der Nacht zum 3. August flogen 740 Flugzeuge Hamburg an und starteten den letzten Angriff der Operation „Gomorrha“. Hamburg lag unter einer dichten Wolkendecke, so dass die Bombenlast verstreut über dem Stadtgebiet abgeworfen wurde und größtenteils bereits zerstörte Gebiete traf.{170}
Nach der schrecklichen Feuersturm-Nacht verließen etwa eine Million Menschen die Stadt. Die Vorbereitungen auf die katastrophale Zerstörung waren ungenügend, die Evakuierung daher chaotisch, wie Jörg Friedrich in seiner Darstellung über den Bombenkrieg beschreibt: „Langes Warten auf Verkehrsmittel ließ die Flüchtigen in die Wälder wandern, im Freien übernachten. In den Landgemeinden, die sie passierten, wirkte ihr Anblick erschütternd. Manche im Trainingsanzug, einige barfuß in Hemd und Schlüpfer.“{171} Mit 625 Zügen transportierte die Reichsbahn rund 787 Tausend Menschen aus der Stadt. Auf Elbschiffen verließen 50 Tausend Einwohner ihre Heimat.{172}
Zuvor waren bereits unter 14jährige Kinder in Klassenverbänden in Landheimen untergebracht worden. Von dieser Aktion wurden jedoch nicht alle Kinder erfasst; es waren zu viele. Eltern versuchten daher, ihre Kinder selbst bei Verwandten auf dem Land in Sicherheit zu bringen. Die Kinderlandverschickung des Regimes war außerdem nicht populär, denn die Zielorte waren weit weg, Eltern und Kinder litten unter der Trennung und sie bedeutete eine weitere Beeinflussung der Kinder durch das Regime.{173} Auch einzelne Jugendheime zogen aus Hamburg in Landgebiete um. Andere, wie das Mädchenheim Schwanenwik in Uhlenhorst, blieben weiterhin in Betrieb.
In der Krisensituation, in der funktionsfähige Gebäude für kriegswichtige Personen benötigt wurden, gerieten andere Zielgruppen in den Fokus für eine Evakuierung: die kranken und behinderten Menschen. So wurden aus den Alsterdorfer Anstalten am 7. August 241 Kinder und Erwachsene und am 16.August 228 Frauen zur Ermordung in Heil- und Pflegeanstalten abtransportiert, ebenso am 7. August 97 geistig behinderte Frauen aus der Anstalt Langenhorn. Ältere, überwiegend Menschen aus Heimen, wurden ebenfalls in entlegene Anstalten verlegt. Das Chaos der Aktion bewirkte, dass die ohnehin leidenden Menschen mehrfach weitertransportiert wurden, bis sie irgendwo in überbelegten Anstalten ankamen und nur schlecht versorgt wurden. Viele starben auf dieser Odyssee.{174}
Mit der Zerstörung Hamburgs hatte sich das Alltagsleben von Jugendlichen völlig verändert. Die häusliche Ordnung war für viele zusammengebrochen. Elternteile fehlten, einen Haushalt gab es nicht mehr oder nur eine notdürftige Behausung. Jugendliche schlossen sich zu Gruppen zusammen, hausten in den Trümmern, trafen sich abends in Lokalen und entzogen sich damit auch der Arbeitsverpflichtung. Die Sozialverwaltung beschloss daher am 9. August 1943, diese Jugendlichen über Razzien aufzuspüren und in Zwangsarbeiterkolonnen zusammen zu fassen.{175}
Die Bombenkatastrophe im Sommer 1943 stellte auch an die Verwaltung neue Anforderungen. Die Bevölkerung verteilte sich in der Stadt ungesteuert neu, gleichzeitig mussten aber hunderttausende Lebensmittelkarten ausgegeben und Wohnraum, Brennstoff und Bekleidung zugeteilt werden. Gauleiter Kaufmann ordnete daher an, dass die Verwaltung näher an die Wohnquartiere der Bevölkerung heranrücken sollte. Diese am 25. August angeordnete Verwaltungsreform legte den Grundstein für die Aufteilung des Stadtgebietes in Bezirke und Ortsämter, wie sie nach dem Krieg festgeschrieben wurde. Zugleich wurden sämtliche gewerblichen Groß- und Mittelbetriebe zu Industrieblocks zusammengeschlossen, um die Schäden schnell beseitigen und die wirtschaftlichen Anstrengungen weiter erhöhen zu können. Der Verfall ließ sich aber auch mit diesen Maßnahmen nicht aufhalten. Ein Jahr später wurde die Verwaltung noch einmal nach den Erfordernissen der „totalen Kriegsführung“ umgebaut.{176} Diesmal war auch die Jugendhilfe betroffen. Am 12. Juli 1944 wurde eine neue Behörde eingerichtet, „die sich dem wachsenden Problem verwahrloster Jugendlicher widmen“ sollte. Damit gab es nach ihrer Auflösung im Jahr 1933 erneut eine Jugendbehörde. Hintergrund war die zunehmende Zahl an Jugendlichen, die sich in den Trümmern aufhielt, sich zu Banden zusammenschloss und sich dem „Endkampf“ entzog.{177} Wer nicht schon als junger Mann der Jahrgänge 1925 bis 1928 in den Reichsarbeitsdienst oder die Hitlerjugend integriert war, konnte über den „Erlaß des Führers über die Bildung des Deutschen Volkssturms“ vom 25. September 1944 für den bevorstehenden Kriegsdienst in der Stadt rekrutiert werden. Die vom Erlass betroffenen Jugendlichen waren vollständig unter der Propaganda des Regimes sozialisiert und meldeten sich zu einem hohen Anteil freiwillig für die völlig aussichtslosen Widerstandsaktionen gegen die bevorstehende Besetzung durch die Alliierten.{178} Bereits ab Februar 1943 wurden Oberschüler neben dem Unterricht, ab 1944 auch Lehrlinge als Luftwaffen- bzw. Flakhelfer in der Luftabwehr eingesetzt{179}, so zum Beispiel die Jungen der Albrecht-Thaer-Schule am Sievekingplatz, die auf dem Hochbunker an der Feldstraße eingesetzt wurden.{180} Bei den Flakhelfern stieß das Regime zum Teil auf das durch Heldengeschichten geprägte Prestigestreben der Jungen, aber auch auf Ablehnung. Wer sich dieser Rekrutierung entziehen konnte und auch nicht in einer Anstalt untergebracht oder einem Lager interniert war, musste untertauchen und hauste mit anderen in den Ruinen der Stadt.
Der Stern des Regimes sank unaufhörlich. Nur noch wenige glaubten an den „Endsieg“, viele hatten sich schon lange von der nationalsozialistischen Führung abgewandt. Die Versorgungslage verschlechterte sich mit zunehmender Dauer des Krieges. Im Mädchenheim in der Feuerbergstraße sank die Zahl der Neuaufnahmen, weil junge Frauen dienstverpflichtet wurden. So musste das Personal des Heimes auch auf Hausmädchen verzichten, die bislang ihre Privaträume gereinigt hatten.{181} In den letzten Kriegsmonaten und über das Kriegssende Anfang Mai 1945 hinaus blieb die Versorgung mit Kohle und Gas immer wieder aus, auch die Lebensmittelversorgung war trotz intensiver Nutzung des Gartens weiterhin ein großes Problem. Täglich musste im Heim „für gut 300 Personen gekocht werden, für Säuglinge und Kleinkinder anders als für Erwachsene“, berichtete die Heimleiterin Cornils. Und in der Wäscherei, die auch für andere Heime arbeitete, wurde seit März kalt gewaschen: „Die Wäsche wird ‚glitschig‘, weil sie mehr und mehr verunreinigt, weil nicht gekocht wird und sie wird nicht mehr trocken.“{182} Die Arbeit der Mädchen wurde bis zum Schluss als „kriegswichtig“ eingestuft. Dies bedeutete zwar keine bessere Verpflegung, aber zumindest wurde die Einquartierung einer Kompanie des Volkssturms abgewendet. Senator Paul, „der in jeder Beziehung als Freund und Förderer des Volkssturms bekannt“ war, gestatte ihm im April 1945 nur die Nutzung zweier Räume.{183}
Die Nachrichten, Gerüchte und Fantasien über den sich anbahnenden Zusammenbruch des Regimes und der öffentlichen Ordnung machten vor dem Heim Feuerbergstraße nicht Halt. Die Heimleiterin berichtete, dass „in den letzten Kriegswochen und in den ersten Wochen nach dem Umbruch eine schwere Beunruhigung und eine große Unsicherheit“ zu verzeichnen waren. Die Bereitwilligkeit zur Mitarbeit war einer, die Ordnung gefährdenden Aufbruchsstimmung gewichen: Bei einem Teil der Mädchen habe sich eine „Sensationslüsternheit“ breit gemacht, bei den meisten auch der Wunsch, nach Hause zurückzukehren „und dabei [zu] sein, wenn etwas los ist.“{184}
Am Abend des 3. Mai 1945 war es so weit. Der für Hamburg zuständige, militärische Führer und Gauleiter, Kaufmann, hatte entschieden, Hamburg kampflos an das britische Militär zu übergeben. Am 4. Mai und in den darauffolgenden Tagen wurden die Nazi-Führer verhaftet.{185}
Die Stadt befand sich in einem katastrophalen Zustand. 213 Fliegerangriffe waren im Krieg geflogen worden. 702 Mal verkrochen sich die Hamburger nach einem Fliegeralarm in Kellern und Bunkern.{186} Die Bombardements töteten, soweit dies überhaupt halbwegs genau feststellbar ist, 45 Tausend Menschen und hinterließen etwa 150 Tausend Verwundete. Die zweitgrößte Stadt Deutschlands mit knapp 1,7 Millionen Einwohnern im Jahr 1939 war bei Kriegsende ein Trümmerfeld, in dem etwa 1,1 Millionen Menschen hausten, nachdem durch zwischenzeitliche Evakuierungen im Jahr 1943 der niedrigste Stand bei 800 Tausend lag.{187} Fast 80% des Wohnungsbestandes des Jahres 1939 war bei Kriegsende beschädigt oder ganz zerstört. Wichtige öffentliche Einrichtungen, wie etwa Schulen und Krankenhäuser, aber auch Wirtschaftsanlagen, allem voran jene im Hafen, waren beschädigt oder vernichtet. Baudenkmäler lagen auch in Trümmern.{188} Die Gebäude des Waisenhauses auf der Uhlenhorst wurden beim Großangriff am 28. Juli 1943 schwer getroffen, darunter auch das Verwaltungsgebäude in der Averhoffstraße und das in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene Kleinkinderhaus am Winterhuder Weg.{189} Dagegen überstand das Mädchenheim Schwanenwik das Bombardement im Sommer 1943, obwohl es sich im Zentrum der Zerstörung befand. Und auch bei den nachfolgenden Angriffen bis zum Kriegsende blieb es nahezu unbeschädigt. 43 Millionen Kubikmeter Schutt bedeckten Straßen und Grundstücke. Allein für ihre Bergung veranschlagte man damals 18 Jahre. Man hoffte aber, die Trümmer mit erhöhten Anstrengungen bereits in zehn Jahren beseitigen zu können.{190} Die Versorgung der Bevölkerung war prekär und stellte die britische Militärregierung vor große Herausforderungen.